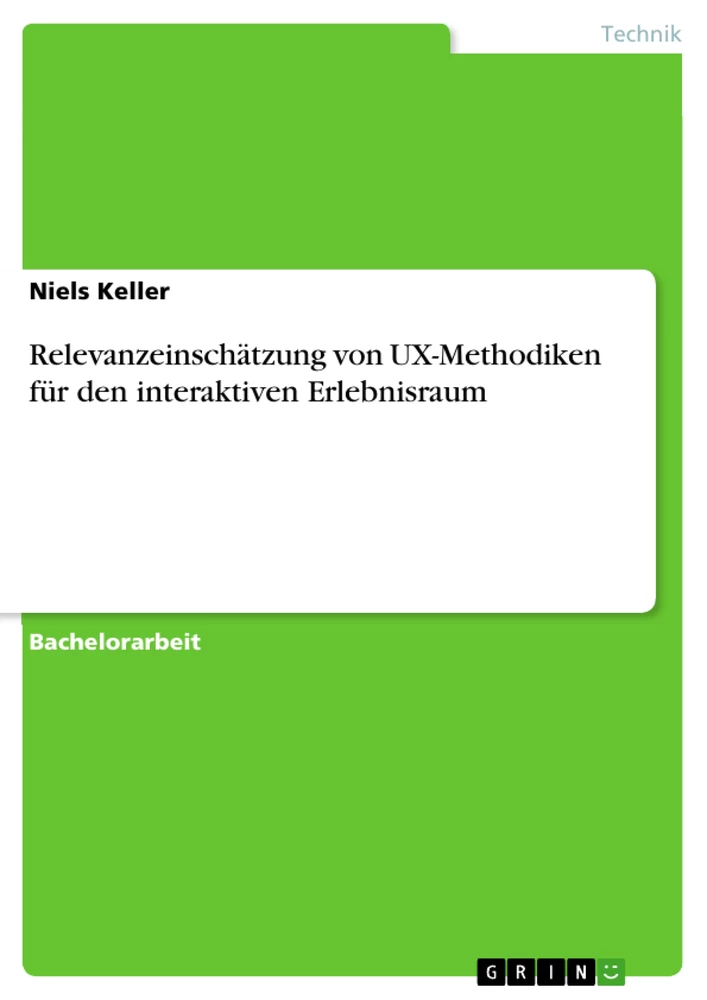
Relevanzeinschätzung von UX-Methodiken für den interaktiven Erlebnisraum
Bachelorarbeit, 2020
53 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hintergründe
- Motivation
- These
- Methodisches Vorgehen
- User Experience im interaktiven Erlebnisraum
- Abgrenzung: Was ist ein interaktiver Erlebnisraum?
- Parameter der UX-Forschung: Was wird eigentlich gemessen?
- Einführung in das Thema User Experience in Bezug auf interaktive Erlebnisräume
- Auf Erlebnisräume übertragbare UX Methodiken
- Anschauungsbeispiel
- Schlemmer x Beats - Ein interaktives Kunsterlebnis
- Bei Schlemmer x Beats angewandte Evaluationstechniken
- Aufbau und Zielsetzung der UX-Evaluation bei Schlemmer x Beats
- Auswertung der durchgeführten Evaluationsmethodiken
- Vorschlag zur Optimierung der Evaluationsstrategie
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Relevanz von UX-Methodiken für interaktive Erlebnisräume, indem sie etablierte Evaluationsmethoden auf ihre Anwendbarkeit auf die neuen Gegebenheiten prüft. Die Studie analysiert zwei Evaluationsinstrumente, Besucherbefragungen und Experteninterviews, und bewertet ihre Anwendbarkeit im Kontext der neuen Gegebenheiten. Durch die Auswertung eines exemplarischen Evaluationsbeispiels werden die Stärken und Schwächen dieser Methoden beleuchtet und ein Schluss gezogen.
- Anwendbarkeit etablierter UX-Methodiken in interaktiven Erlebnisräumen
- Übertragung von UX-Methoden vom zweidimensionalen Bildschirm in den dreidimensionalen Erlebnisraum
- Evaluation und Optimierung von Evaluationsstrategien im Bereich der UX-Forschung
- Relevanz von Besucherbefragungen und Experteninterviews für die User Experience in interaktiven Erlebnisräumen
- Entwicklung einer Grundlage für zukünftige, zielführende Evaluationen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt den Leser in die Thematik ein und beleuchtet die Hintergründe sowie die Motivation für die Arbeit. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Definition und Abgrenzung von interaktiven Erlebnisräumen und untersucht die Parameter der UX-Forschung. Es stellt verschiedene UX-Methodiken vor, die auf Erlebnisräume übertragen werden können. Im dritten Kapitel wird anhand eines konkreten Beispiels, „Schlemmer x Beats“, eine UX-Evaluation analysiert, die im Vorfeld der Arbeit durchgeführt wurde. Die Evaluation wird im Detail betrachtet und es werden Vorschläge zur Optimierung der Evaluationsstrategie gegeben.
Schlüsselwörter
User Experience, Interaktive Erlebnisräume, UX-Methodiken, Evaluationsmethoden, Besucherbefragungen, Experteninterviews, Usability, Evaluation, Schlemmer x Beats.
Häufig gestellte Fragen zu UX im Erlebnisraum
Was ist ein interaktiver Erlebnisraum?
Ein dreidimensionaler Raum (z.B. Ausstellungen, Flagship-Stores), in dem Besucher durch Interaktion mit digitalen oder physischen Elementen eine immersive Erfahrung machen.
Können digitale UX-Methoden auf Räume übertragen werden?
Ja, aber sie müssen angepasst werden, da Faktoren wie Bewegung im Raum, soziale Interaktion und Dreidimensionalität neue Anforderungen an die Evaluation stellen.
Welche Evaluationsinstrumente wurden untersucht?
Die Arbeit prüft primär die Relevanz von Besucherbefragungen und Experteninterviews für die User Experience Forschung.
Was war das Projekt „Schlemmer x Beats“?
Ein interaktives Kunsterlebnis, das als Fallbeispiel diente, um die Anwendbarkeit von UX-Evaluationsmethoden in der Praxis zu testen.
Was wird in der UX-Forschung eigentlich gemessen?
Gemessen werden Parameter wie Usability, emotionale Wirkung, Orientierung im Raum und der subjektive „Erlebnisfaktor“ der Besucher.
Details
- Titel
- Relevanzeinschätzung von UX-Methodiken für den interaktiven Erlebnisraum
- Hochschule
- Hochschule der Medien Stuttgart
- Note
- 1,7
- Autor
- Niels Keller (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2020
- Seiten
- 53
- Katalognummer
- V1194574
- ISBN (eBook)
- 9783346639899
- ISBN (Buch)
- 9783346639905
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Interaktion ux user experience experience design
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Niels Keller (Autor:in), 2020, Relevanzeinschätzung von UX-Methodiken für den interaktiven Erlebnisraum, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1194574
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









