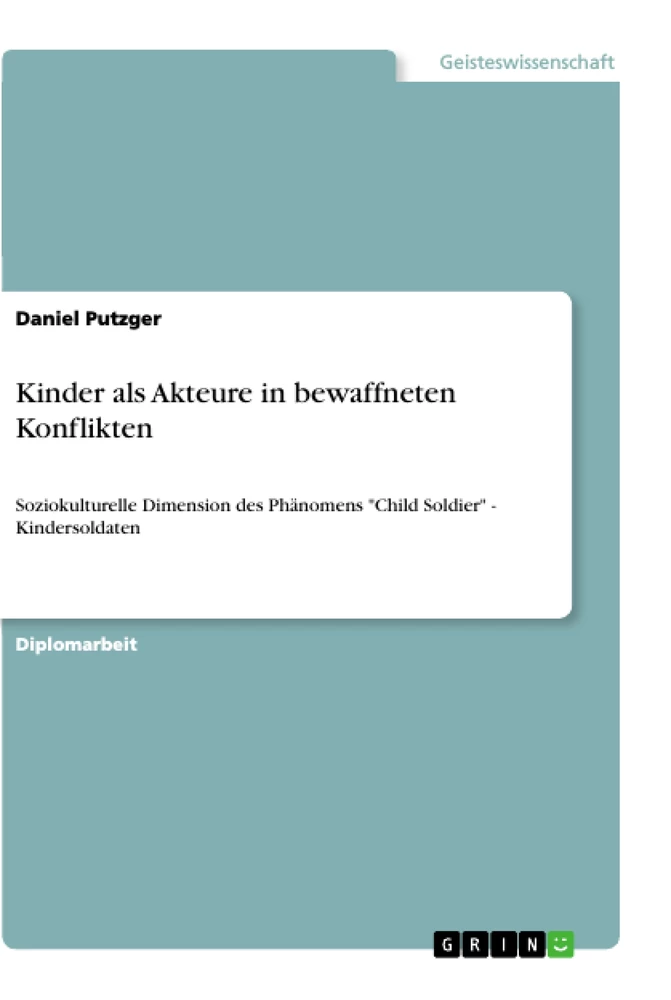
Kinder als Akteure in bewaffneten Konflikten
Diplomarbeit, 2005
90 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Begriffsklärung
- 1.1. Der kulturell differenzierte Terminus des Kindes
- 1.2. Der Kindheitsbegriff
- 1.3. Child soldiers
- 2. Konflikte in traditionellen Gesellschaften
- 2.1. Quellenlage und Interpretation
- 2.2. Abgrenzung der Kindheit
- 2.3. Motive und Ursachen
- 2.4. Zusammenfassung
- 3. Die Rolle des Kindes und seine Erziehung in komplexen Gesellschaften
- 3.1. Das antike Kind
- 3.2. Kinderrolle im Mittelalter
- 3.3. Die Umbruchsepoche der Aufklärung und ihr Kindheitsverständnis
- 3.4. Zusammenfassung
- 4. Minderjährige in Diensten bewaffneter Gruppen bis zum 21. Jahrhundert
- 4.1. Minderjährige in der römischen Berufsarmee der Kaiserzeit
- 4.2. Die Rolle des Knappen im 11. bis 15. Jahrhundert
- 4.3. Kinder in Konflikten des 16. und 17. Jahrhunderts
- 4.4. Kinder im amerikanischen Sezessionskrieg
- 4.5. Schüler in der deutschen Luftabwehr 1943-1945
- 4.6. Reflektion der Rekrutierungsbedingungen
- 4.7. Zusammenfassung
- 5. Strukturelle Veränderung bewaffneter Konflikte und ihre Auswirkungen bezüglich der militärischen Verwendung von Kindern
- 5.1. Die Genfer Abkommen
- 5.2. Entstehung der Kinderrechte
- 5.2.1. Die Bestimmungen der UN-Kinderrechtskonvention
- 5.2.2. Weitere Abkommen zum Schutz des Kindes
- 5.3. Konfliktforschung
- 5.4. Wandel in der Konfliktstruktur und Intensität
- 5.5. Erfassung der Staaten mit minderjährigen Kombattanten
- 5.5.1. Allgemeine Ursachen
- 5.5.1.1. Konfliktdauer
- 5.5.1.2. Kleinwaffen
- 5.5.1.3. Fehlende Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten
- 5.5.1.4. Armut
- 5.5.2. Spezifische Faktoren
- 5.5.2.1. Physiologische Faktoren
- 5.5.2.2. Psychosoziale Faktoren
- 5.5.1. Allgemeine Ursachen
- 5.6. Aufgabenbereiche
- 6. Auswirkungen für die Minderjährigen und gesellschaftliche Relevanz
- 6.1. Psychosoziale Auswirkungen
- 6.2. Demobilisierung und Reintegration
- 6.3. Tendenzen
- 7. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die kulturellen Aspekte der Rekrutierung von Kindersoldaten. Das Hauptziel ist es, soziokulturelle Faktoren zu identifizieren, die die Beteiligung Minderjähriger an bewaffneten Konflikten begünstigen. Die Studie analysiert historische und aktuelle Muster der Sozialisation und der kulturellen Werte, um die Frage nach der zeitlichen Einordnung dieses Phänomens zu beantworten.
- Kulturelle Unterschiede im Verständnis von Kindheit
- Die Rolle des Kindes in verschiedenen historischen Epochen und Gesellschaften
- Der Einfluss von Konfliktdynamiken und Waffentechnologie auf die Rekrutierung von Kindersoldaten
- Psychosoziale Auswirkungen des Einsatzes von Kindersoldaten
- Die Relevanz von Kinderrechten und internationalen Konventionen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema Kindersoldaten vor und präsentiert erschreckende Statistiken über die Anzahl der Kinder, die weltweit als Soldaten eingesetzt werden. Sie betont die mediale Aufmerksamkeit, die diesem Thema seit Mitte der 90er Jahre zukommt, und hebt die scheinbar außergewöhnliche Natur des Einsatzes minderjähriger Kämpfer hervor. Die Arbeit zielt darauf ab, die kulturellen Antagonismen des Phänomens zu untersuchen und soziokulturelle Aspekte zu identifizieren, die die Teilnahme Minderjähriger an bewaffneten Konflikten begünstigen.
1. Begriffsklärung: Dieses Kapitel betont die Notwendigkeit, den Begriff "Kind" und "Kindheit" zu klären, da deren Bedeutung kulturell und zeitlich stark variiert. Es wird auf die Schwierigkeiten hingewiesen, ein universelles Verständnis von Kindheit zu etablieren und die unterschiedlichen Auffassungen von Kindheit in verschiedenen Kulturen und Epochen, wie sie z.B. von Lassahn beschrieben werden, werden erläutert.
2. Konflikte in traditionellen Gesellschaften: Dieses Kapitel untersucht die Rolle von Kindern in bewaffneten Konflikten traditioneller Gesellschaften. Es analysiert historische Quellen und interpretiert die Gründe und Motive für die Einbeziehung von Kindern in diese Konflikte. Die Abgrenzung des Kindheitsbegriffes in diesen Gesellschaften wird ebenfalls diskutiert. Die Zusammenfassung dieses Kapitels bietet einen Überblick über die vorherrschenden Muster und die Herausforderungen bei der Interpretation der Daten.
3. Die Rolle des Kindes und seine Erziehung in komplexen Gesellschaften: Dieses Kapitel verfolgt die Entwicklung der Rolle des Kindes in verschiedenen historischen Epochen komplexer Gesellschaften, beginnend mit der Antike, über das Mittelalter bis zur Aufklärung. Es untersucht, wie sich das Verständnis von Kindheit und die Erziehung von Kindern in diesen Epochen verändert haben und wie diese Entwicklungen möglicherweise die Einbindung von Kindern in bewaffnete Konflikte beeinflusst haben. Das Kapitel schließt mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse.
4. Minderjährige in Diensten bewaffneter Gruppen bis zum 21. Jahrhundert: Dieses Kapitel zeichnet einen umfassenden Überblick über den Einsatz von Minderjährigen in bewaffneten Konflikten von der römischen Kaiserzeit bis zum Zweiten Weltkrieg nach. Es analysiert die Rolle von Kindern in verschiedenen historischen Kontexten, darunter die römische Armee, das mittelalterliche Knappenwesen, Konflikte des 16. und 17. Jahrhunderts, der amerikanische Sezessionskrieg und der Einsatz von Schülern in der deutschen Luftabwehr im Zweiten Weltkrieg. Die Rekrutierungsbedingungen und ihre Veränderungen über die Zeit werden detailliert untersucht und reflektiert.
5. Strukturelle Veränderung bewaffneter Konflikte und ihre Auswirkungen bezüglich der militärischen Verwendung von Kindern: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Wandel der Konfliktstrukturen und ihrer Auswirkungen auf den Einsatz von Kindersoldaten seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Es analysiert die Rolle internationaler Konventionen wie der Genfer Abkommen und der UN-Kinderrechtskonvention. Der Einfluss von Faktoren wie die Vereinfachung der Waffentechnologie und der sozioökonomische Kontext auf die Rekrutierung von Kindersoldaten wird eingehend untersucht.
6. Auswirkungen für die Minderjährigen und gesellschaftliche Relevanz: Dieses Kapitel befasst sich mit den Folgen des Einsatzes von Kindersoldaten für die betroffenen Minderjährigen und deren gesellschaftliche Relevanz. Es analysiert die psychosozialen Auswirkungen, die Herausforderungen der Demobilisierung und Reintegration sowie aktuelle Tendenzen im Umgang mit diesem Problem.
Schlüsselwörter
Kindersoldaten, Child Soldiers, Kindheitsbegriff, kulturelle Unterschiede, bewaffnete Konflikte, traditionelle Gesellschaften, komplexe Gesellschaften, Sozialisation, UN-Kinderrechtskonvention, Genfer Abkommen, Konfliktforschung, Psychosoziale Auswirkungen, Demobilisierung, Reintegration.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Kulturelle Aspekte der Rekrutierung von Kindersoldaten
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die kulturellen Aspekte der Rekrutierung von Kindersoldaten. Ihr Hauptziel ist die Identifizierung soziokultureller Faktoren, die die Beteiligung Minderjähriger an bewaffneten Konflikten begünstigen. Die Studie analysiert historische und aktuelle Muster der Sozialisation und kultureller Werte, um die zeitliche Einordnung dieses Phänomens zu klären.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt kulturelle Unterschiede im Verständnis von Kindheit, die Rolle des Kindes in verschiedenen historischen Epochen und Gesellschaften, den Einfluss von Konfliktdynamiken und Waffentechnologie auf die Rekrutierung von Kindersoldaten, die psychosozialen Auswirkungen des Einsatzes von Kindersoldaten und die Relevanz von Kinderrechten und internationalen Konventionen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Eine Einleitung, die das Thema einführt und die Forschungsfrage formuliert. Kapitel 1 klärt den Begriff "Kind" und "Kindheit" in verschiedenen kulturellen Kontexten. Kapitel 2 untersucht die Rolle von Kindern in Konflikten traditioneller Gesellschaften. Kapitel 3 analysiert die Rolle des Kindes in komplexen Gesellschaften über verschiedene historische Epochen. Kapitel 4 beleuchtet den Einsatz Minderjähriger in bewaffneten Konflikten von der Antike bis zum Zweiten Weltkrieg. Kapitel 5 befasst sich mit dem Wandel der Konfliktstrukturen und den Auswirkungen auf den Einsatz von Kindersoldaten im Kontext internationaler Konventionen. Kapitel 6 thematisiert die Auswirkungen auf betroffene Minderjährige und die gesellschaftliche Relevanz. Schließlich fasst Kapitel 7 die Ergebnisse zusammen.
Welche historischen Beispiele werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht den Einsatz von Kindersoldaten in verschiedenen historischen Kontexten, darunter die römische Armee, das mittelalterliche Knappenwesen, Konflikte des 16. und 17. Jahrhunderts, der amerikanische Sezessionskrieg und der Einsatz von Schülern in der deutschen Luftabwehr im Zweiten Weltkrieg.
Welche Rolle spielen internationale Konventionen?
Die Arbeit analysiert die Rolle internationaler Konventionen wie der Genfer Abkommen und der UN-Kinderrechtskonvention und deren Einfluss auf den Umgang mit dem Problem der Kindersoldaten.
Welche Auswirkungen auf die Kinder werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert die psychosozialen Auswirkungen des Einsatzes von Kindersoldaten, die Herausforderungen der Demobilisierung und Reintegration sowie aktuelle Tendenzen im Umgang mit diesem Problem.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kindersoldaten, Child Soldiers, Kindheitsbegriff, kulturelle Unterschiede, bewaffnete Konflikte, traditionelle Gesellschaften, komplexe Gesellschaften, Sozialisation, UN-Kinderrechtskonvention, Genfer Abkommen, Konfliktforschung, Psychosoziale Auswirkungen, Demobilisierung, Reintegration.
Details
- Titel
- Kinder als Akteure in bewaffneten Konflikten
- Untertitel
- Soziokulturelle Dimension des Phänomens "Child Soldier" - Kindersoldaten
- Hochschule
- Hochschule Zittau/Görlitz; Standort Zittau
- Note
- 1,7
- Autor
- Daniel Putzger (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2005
- Seiten
- 90
- Katalognummer
- V120633
- ISBN (Buch)
- 9783640293117
- ISBN (eBook)
- 9783640293230
- Dateigröße
- 1473 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Kinder Akteure Konflikten
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Daniel Putzger (Autor:in), 2005, Kinder als Akteure in bewaffneten Konflikten, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/120633
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-










Kommentare