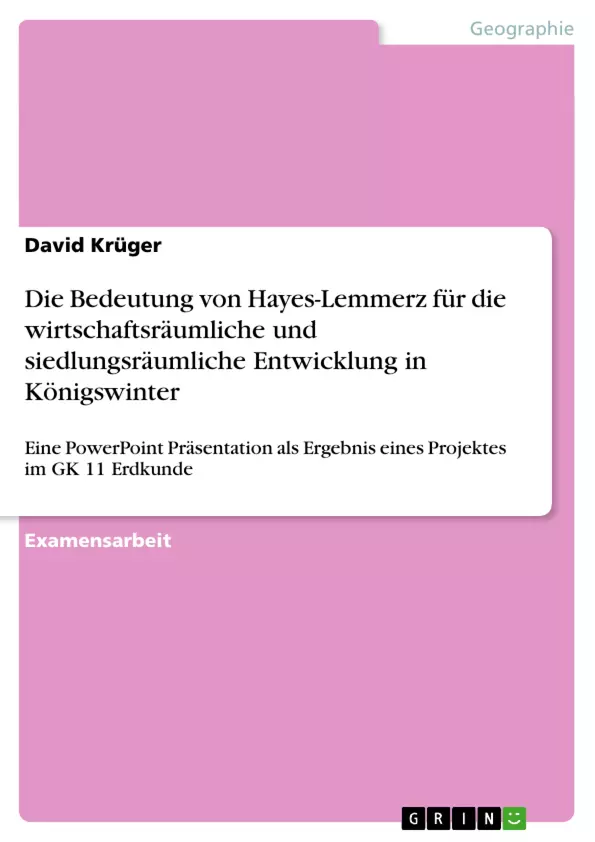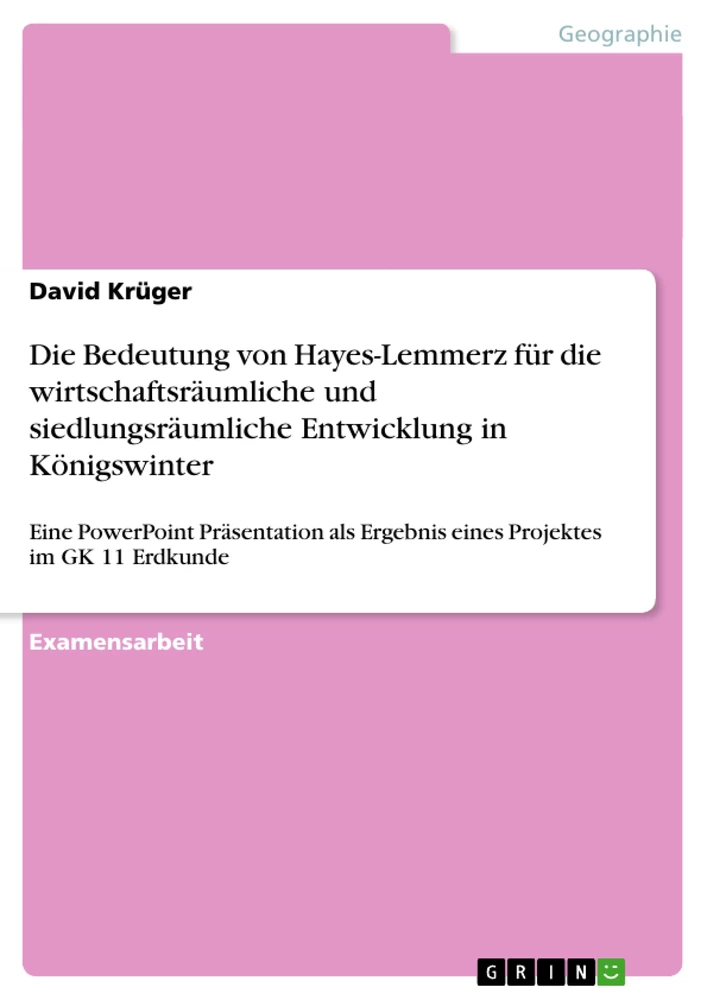
Die Bedeutung von Hayes-Lemmerz für die wirtschaftsräumliche und siedlungsräumliche Entwicklung in Königswinter
Examensarbeit, 2004
50 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Zum Einsatz von Neuen Medien in der Schule.
2.1 PowerPoint
2.2 PowerPoint im Erdkundeunterricht
3. Konzeption des Projektes
3.1 Zur Auswahl des Themas.
3.2 Organisation des Projektes
3.2.1 Der Projektleitfaden als konzeptionelles Gerüst
3.2.2 Organisatorische Rahmenbedingungen.
3.3 Schwerpunkte der Unterrichtsreihe
3.4 Zur Lehrerrolle und den Lehrerfunktionen.
4. Didaktische Umsetzung von PowerPoint für die Anwendung im Projekt.
4.1 Zielvorstellungen
4.2 Konstituierung der Arbeitsgruppen
4.3 Erstellen eines Handlungsleitfadens
4.4 Hilfe zur Selbsthilfe
4.5 Erwartete Schwierigkeiten
5. Durchführung des Projektes
5.1 Tabellarische Übersicht der Projektphasen.
5.2 Darstellung und Reflexion einzelner Projektphasen
5.2.1 Die Einführungs- und Planungsphase.
5.2.2 Die Phasen der Meilensteine
5.2.3 Die Präsentationsphase
6. Bewertung des Projektes und didaktisch-methodische Schlussfolgerungen
7. Anhang.
8. Literatur
1. Einleitung
Bei der vorliegenden Unterrichtsreihe handelt es sich um ein Projekt, das von Schülern und Schülerinnen[1] des Grundkurses 11 Erdkunde über einen Zeitraum von 18 Stunden durchgeführt wurde. Ausgehend von dem konkreten Beispiel des in Königswinter ansässigen Felgenherstellers Hayes-Lemmerz beschäftigte sich der Grundkurs (GK) mit der Fragestellung, inwieweit die Entwicklung des Unternehmens die wirtschaftsräumliche und siedlungsräumliche Entwicklung von Königswinter beeinflusst hat. Die Schüler formulierten hierzu vier Fragestellungen, die sie in vier Gruppen bearbeiteten und in vier selbständig entworfenen PowerPoint-Präsentationen einander vorstellten.
Im Mittelpunkt der Unterrichtsreihe stand die methodische Auseinandersetzung der Lerngruppe mit dem Programm PowerPoint als Präsentationsmedium. Es wird gezeigt, wie die Schüler eigenständig und in Zusammenarbeit die funktionellen Möglichkeiten des Programms erschließen und anwenden können. Neben der didaktischen Auseinandersetzung mit dem Programm PowerPoint und seiner Umsetzung im Unterricht wird innerhalb der vorliegenden Arbeit auch ansatzweise die Konzeption des Projektes beleuchtet und hinsichtlich ihrer Einsatzmöglichkeiten für den schulischen Kontext reflektiert.
In Kapitel 2 wird die Bedeutung der Neuen Medien, insbesondere von PowerPoint, für den schulischen Kontext herausgestellt.
Kapitel 3 erläutert den übergreifenden schulischen Rahmen, in den das Projekt dieses Kurses eingebaut ist.
In Kapitel 4 kommen die Formulierung der Fragestellungen des Projektes durch die Schüler und die Organisation des Projektes sowie die didaktische Einführung von PowerPoint zur Darstellung.
In Kapitel 5 werden der Verlauf der Projektphasen und die Endergebnisse der Präsentationen dargestellt und beurteilt.
In Kapitel 6 folgen eine Bewertung des Kursprojektes und die Ableitung didaktisch-methodischer Konsequenzen für Modifikationen der Projektplanung des. Es geht hierbei um die Frage, ob der angewendete Projektleitfaden des Bildungswerkes der Bayerischen Wirtschaft im schulischen Kontext einsetzbar ist, inwieweit die Medienkompetenz der Schüler im Rahmen des Projektes gesteigert werden konnte und welche Chancen und auch welche Schwierigkeiten der Einsatz von PowerPoint sowohl für das fachliche als auch für das methodische Lernen der Schüler im Erdkundeunterricht bietet.
2. Zum Einsatz von Neuen Medien in der Schule
Die jüngsten Entwicklungen im Bereich der sog. New Economies – also den neuen, zukunftsorientierten Wirtschaftszweigen – zeigen eine zunehmende Digitalisierung vieler Berufssparten.[2] Die Schule darf nicht die Augen vor der sich wandelnden Berufswelt und den daraus resultierenden Anforderungen verschließen, sondern hat diesem Trend Rechnung zu tragen, um den Schülern langfristig eine zukunftsorientierte Schulausbildung bieten zu können.
Die Richtlinien für die Sekundarstufe I und II unterstreichen daher die Bedeutung und die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten von Computern für den Unterricht im Rahmen der formulierten Ziele der „Vorläufigen Richtlinien zur Informations- und Kommunikationstechnologischen Grundbildung“.[3] Auch im Rahmen der Lehrerausbildung wird die Entwicklung einer Medienkompetenz bei diesen als zunehmend wichtig erachtet.[4]
In fast jeder Schule zählt die Ausstattung mit Computern mittlerweile zum Standard, wohingegen die didaktische Erschließung und der tatsächliche Einsatz im Unterricht vielerorts noch Schwierigkeiten bereiten. Der Blick in die schuldidaktische Fachliteratur zeigt ein wachsendes Bemühen um konkrete Unterrichtskonzepte für den Einsatz von Neuen Medien in der Schule.[5] Ob und wie die Nutzung von Hard- und Software in den Unterricht integriert wird, bleibt letztendlich die Entscheidung des Lehrers, die sicherlich zu einem großen Teil von seiner eigenen Medienkompetenz abhängt.
Mit dem Einsatz der Neuen Medien in der Schule verbinden sich große Hoffnungen auf erfolgreiches und in höherem Maße schülernahes Lernen.[6] Die Neuen Medien bieten Möglichkeiten zur Verstärkung des eigenständigen Arbeitens des Schülers, zur stärkeren Individualisierung des Lernens aber auch zur Förderung von Formen der Zusammenarbeit.[7] Gleichzeitig müssen aber auch die Gefahren eines unkritischen Einsatzes der Neuen Medien erkannt werden. Die große Informationsflut, wie sie beispielsweise aus dem Internet auf den Schüler einströmt, kann eine unkritische Übernahme der leicht verfügbaren Informationen durch die Schüler fördern und dazu beitragen, dass sie vom Wesentlichen abgelenkt werden. Oft stellt sich bei Schülern daher eine Konsumhaltung ein, indem sie nur noch Fertigprodukte übernehmen, ohne den Gehalt kritisch zu hinterfragen.[8] Insgesamt gesehen jedoch sollten Lehrer – trotz aller Probleme und auch Ängste vor der Unüberschaubarkeit und Komplexität der Neuen Medien – ihre Chancen und Vorteile erkennen und sie als Erleichterung und Unterstützung für den Unterricht nutzen. Die Herausbildung einer Medienkompetenz bei Schülern erfordert daher eine entsprechende Kompetenz bzw. Schulung auf Seiten der Lehrer, die das, was sie vermitteln sollen, natürlich selbst beherrschen und einsetzen und hinsichtlich der Grenzen, der Gefahren aber vor allem auch der Möglichkeiten kritisch einschätzen können müssen.
2.1 PowerPoint
In der vorliegenden Unterrichtsreihe wird ein Ansatz formuliert, der zeigt, wie Lehrer und Schüler mit dem Präsentationsprogramm PowerPoint von Microsoft gewinnbringend umgehen können und wie Schüler in einem projektartigen Unterricht aufgabenorientiert arbeiten können.
PowerPoint ist heute eines der am häufigsten eingesetzten Präsentationsprogramme für Vorträge und Präsentationen in Wirtschaft und Politik und zunehmend auch im schulischen Umfeld.[9] Das Programm bietet ein breites Spektrum an Möglichkeiten, Effekten und Zusatzfunktionen zur Gestaltung und Visualisierung von Texten, Grafiken und Fotos und lässt sich dennoch relativ einfach handhaben. Krotky sieht jedoch in diesem Zusammenhang eine große Gefahr und merkt kritisch an:
„’Powerpointing’ ist die höhere Kunst, komplexe Sachverhalte in einfache, dafür bunte Schlagworte zu verwandeln. Kurzum: Die Fortsetzung der Verflachung des Denkens (beim Vortragenden) und der Niederschlagung der Kritikfähigkeit (beim Zuhörer und -seher) mit den Mitteln der Präsentations-Grafik. (…) Edward R. Tufte, ein Experte für Informationsdesign, dazu: „Verglichen mit anderen internationalen Publikationen sind Powerpoint-Statistiken die dünnsten (…)´“. Keine Frage: Powerpoint ist für Blender das Instrument par excellence.“[10]
Auch wenn die Anmerkungen Krotkys etwas überspitzt formuliert sein mögen[11], so können allzu viele Effekte in einer PowerPoint Präsentation den Zuschauer zwar beeindrucken, aber auch von den eigentlichen Inhalten ablenken. Wichtig ist daher, dass am Anfang einer Präsentation nicht die Frage stehen darf, wie will ich etwas darstellen, sondern was will ich thematisieren. Pohl macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass die „Präsentation (…) lediglich der Abschluss einer längeren Arbeitsphase (sei), in der zuerst einmal die gesuchten Inhalte definiert, erarbeitet und dargestellt werden müssen. Erst danach folgt die Arbeit an der Präsentation.“[12]
In der vorliegenden Unterrichtsreihe müssen diese Probleme berücksichtigt und mit den Schülern thematisiert werden. Es sollen Wege aufgezeigt werden, wie die Schüler die Programmfunktionen von PowerPoint zwar in ihrer Breite erfassen, sie aber fachlich und methodisch angemessen anwenden können.
2.2 PowerPoint im Erdkundeunterricht
PowerPoint bietet als Präsentationsprogramm für den schulischen Unterricht eine Vielzahl von Möglichkeiten. Ein großer Vorteil gegenüber den traditionellen Präsentationsmedien – z.B. dem Overheadprojektor – liegt in der großen Flexibilität und Vielseitigkeit des Programms. So lassen sich relativ einfach vom Lehrer oder den Schülern selbst erstellte oder gescannte Elemente wie Texte, Fotos, Diagramme, Abbildungen, Screenshots aus dem Internet und sogar akustische Elemente in das Programm einbinden und aufgabenorientiert bearbeiten. Des Weiteren können komplexe Inhalte – wie z.B. Abbildungen oder Diagramme – mit PowerPoint schrittweise aufgebaut und somit „verdaulich“ aufbereitet werden. Weitere Programmfunktionen sind interaktive Schaltflächen zur Erstellung einer flexibel handhabbaren Präsentation, die Zeichenfunktionen (Stiftmodus) zur Markierung während der Präsentation oder die benutzerdefinierte Animation von Grafiken.
Diese Vielseitigkeit der Visualisierungsmöglichkeiten kann sich insbesondere das Fach Erdkunde zu Nutze machen, da gerade in diesem Fach verschiedene Informationsmedien zum Einsatz kommen (z.B. Karten, Diagramme, Fotos, Texte).[13] Harnischmacher und Rahner zeigen in ihrem Beitrag verschiedene Beispiele für die Anwendung von PowerPoint im Erdkundeunterricht.[14] Sie stellen dabei heraus, dass PowerPoint nicht nur ein Präsentationsmedium ist, sondern auch als „interaktives Unterrichtswerkzeug“[15] einsetzbar ist. Somit kann nach Meinung der beiden Autoren das Präsentationsprogramm mehr, als nur effektvoll Grafiken oder Überschriften in Szene zu setzen. PowerPoint kann schüler- und problemorientiertes Arbeiten im Erdkundeunterricht in Gang setzen.[16]
3. Konzeption des Projektes
3.1 Zur Auswahl des Themas
Der Ausgangspunkt für die Planung der Unterrichtsreihe bilden die Bausteine II c, d, f aus den Richtlinien für die Sekundarstufe II für Gymnasien in NRW: Merkmale und räumliche Veränderungen eines heimischen Industriestandortes in einer Welt zusammenrückender Märkte[17]. Gemeinsam mit den Schülern wurden hierzu verschiedene Vorschläge für in Frage kommende Unternehmen aus der Heimatregion zusammengetragen, die für die Lerngruppe in noch erreichbarer räumlicher Entfernung zur Schule liegen. Von den vorgeschlagenen Unternehmen, zu denen z. B. Hennecke in Sankt Augustin, Birkenstock in Bad Honnef oder Haribo in Bonn gehörten, entschieden sich die Schüler schließlich für den Felgenhersteller Hayes-Lemmerz im benachbarten Königswinter.
Dieses Traditionsunternehmen ist ein heimischer Industriestandort, der sich in Königswinter seit seiner Gründung in den 1920er Jahren bis heute von einem kleinen Familienbetrieb zu einem global player im Bereich der Felgenproduktion entwickeln konnte. Die Unternehmensgeschichte ist ein Beispiel für eine erfolgreiche Globalisierung, sie zeigt jedoch auch, welche strukturellen Maßnahmen und Probleme damit zusammenhängen.[18]
Für die Auswahl dieses Unternehmens sprach somit einmal seine wirtschaftliche Bedeutung, die heute weit über die Grenzen des Rhein-Sieg-Kreises bis in den internationalen Markt hineinreicht, dann aber auch seine lokale Lage im Nahbereich der Schule, die eine Recherche vor Ort durch die Schüler möglich machte und somit keine großen organisatorischen Probleme bereitete.[19] Ferner konnte davon ausgegangen werden, dass einige Schüler den Konzern bereits kannten, evtl. über Verwandte oder Bekannte, die bei Hayes-Lemmerz arbeiten oder gearbeitet haben (Lebensweltbezug). Schließlich sprach auch die räumliche Überschaubarkeit des Talbereiches der Stadt Königswinter rund um den Standort Hayes-Lemmerz mit rund 4500 Einwohnern für die Wahl als Untersuchungsstandort.
Die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens ist insbesondere an die Person Paul Lemmerz’ geknüpft, der neben seinem unternehmerischen Geschick stets eine besondere Beziehung zu seiner Heimatstadt Königswinter pflegte. So profitierte Königswinter sowohl vom Standort Lemmerz als Garant für zwischenzeitlich über 3000 Arbeitsplätze als auch von dem Mäzen Paul Lemmerz, dem die Stadt zahlreiche Stiftungen und Schenkungen (z.B. das Paul-Lemmerz-Bad, die Paul-Lemmerz-Schule, Arbeiterwohnungen usw.) verdankt.[20]
Vor diesem Hintergrund ergab sich bei der gemeinsamen Themenfindung mit der Lerngruppe die Fragestellung, inwieweit die Entwicklung von Hayes-Lemmerz in einem Zusammenhang steht mit der Entwicklung Königswinters, d.h. welchen Einfluss sie auf diese hat. Um eine sinnvolle Eingrenzung vorzunehmen, einigte sich die Lerngruppe im gemeinsamen Lehrer-Schüler-Gespräch auf das Thema: „Die Bedeutung der Firma Hayes-Lemmerz für die wirtschaftliche und siedlungsräumliche Entwicklung in Königswinter“. Hierzu wurden dann – orientiert an den jeweiligen Präferenzen der Schüler - folgende vier Themenfelder formuliert:
1. „Die Entwicklung von Lemmerz - Vom Familienbetrieb zum global player“
2. „Lemmerz und Königswinter - Die Spuren von Paul Lemmerz in Königswinter“
3. „Hat die Entwicklung der Firma Auswirkungen auf die Entwicklung des Einzelhandels in Königswinter?“
4. „Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in Königswinter – Umgestaltung von Bereichen des Lemmerz-Geländes“
3.2 Organisation des Projektes
3.2.1 Der Projektleitfaden als konzeptionelles Gerüst
Die Unterrichtsreihe ist konzeptionell als Schulprojekt angelegt, das den Schülern ein hohes Maß an Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit ermöglichen. Sie sollen in ihrer Lernorganisation und Arbeitsdurchführung relativ frei sein und ihren Lernprozess selbständig steuern. Haubrich hebt in diesem Zusammenhang als Hauptmerkmal die Offenheit von Projekten hervor, die die Interessen der Schüler besser berücksichtigen lässt.[21] Dies verlangt eine Planung, die der Lerngruppe einen gewissen Freiraum für eigene Wege und Problemlösungsansätze gewähren muss.
Als theoretisches Gerüst für die Durchführung des Projektes orientieren sich die Schüler an einen Projektleitfaden, der vom Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft herausgegeben wurde.[22] Dort werden vier verschiedene Phasen eines Projektes unterschieden: Definition, Planung, Durchführung und Rückblick.
Zur Definitionsphase gehören die gemeinsame Bestimmung und Eingrenzung des Themas und der Fragestellung, die Festlegung von Zielen sowie die Klärung der Rahmenbedingungen. In einem ersten Projektentwurf wird – nach der gemeinsamen Formulierung des Themas und der Themenfelder durch die Lerngruppe – das Ziel des Projektes festgelegt: eine von den Schülern selbständig erarbeitete PowerPoint-Präsentation, in der die wichtigsten Ergebnisse zusammengetragen werden. Die verschiedenen Präsentationen der vier Arbeitsgruppen werden schließlich in einer gemeinsamen Präsentationsoberfläche zusammengeführt.
Die Planungsphase ist die wichtigste Phase. Hier werden ein eindeutiger Zeitplan und sog. Meilensteine vereinbart, in denen die einzelnen Arbeitsgruppen ihre Arbeitsergebnisse und weiteren Planungsvorhaben als Zwischenergebnis dem gesamten Kurs vorstellen.[23] Hierzu zählt auch die Thematisierung der Möglichkeiten von PowerPoint zur Layout-Gestaltung. Neben der zeitlichen Organisation der Meilensteine müssen in dieser Phase die Verantwortungen in den einzelnen Arbeitsgruppen festgelegt werden. Hierdurch wird sichergestellt, dass jeder Schüler in seiner Gruppe in den Arbeitsprozess einbezogen wird und sich als wichtiger Bestandteil seiner Gruppe versteht. Auf diese Weise werden Motivation und Arbeitsbereitschaft in den Gruppen gesteigert.
Eine detaillierte Planung ermöglicht im Idealfall den reibungslosen Ablauf der Durchführungsphase. Die Schüler bearbeiten hier ihre Themenfelder selbständig und eigenverantwortlich. „Durch Selbsttätigkeit zur Selbständigkeit (zu gelangen)“, nennt Haubrich als ein wichtiges Ziel der Projektarbeit.[24] Den Abschluss der Durchführung bilden dann die Projektergebnisse, d.h. die PowerPoint-Präsentationen der einzelnen Arbeitsgruppen.[25] Hier wird sich zeigen, inwieweit die Schüler inhaltlich und methodisch etwas gelernt haben.
Die letzte Phase, der Rückblick, gibt allen Beteiligten schließlich Gelegenheit, in einem Fazit das Projekt zu bewerten, Schwierigkeiten, Probleme aber auch positive Aspekte aufzuzeigen. Insbesondere für die zukünftige Planung von Projekten kann diese Reflexionsphase wichtige Anstöße geben. Die Auswertung erfolgt in diesem Projekt sowohl durch die Schüler, die dazu einen Evaluationsbogen einzeln und anonym ausfüllen, als auch durch den Lehrer.[26]
3.2.2 Organisatorische Rahmenbedingungen
Für die Umsetzung des Unterrichtsprojektes müssen im Vorfeld verschiedene organisatorische Rahmenbedingungen geschaffen werden.
Neben der Bereitstellung von Arbeitsräumen benötigen die Schüler eine entsprechende technische Ausstattung. Hierzu gehören zunächst PC-Stationen mit Internet-Anschluss, eine lizenzierte Version von PowerPoint[27], ein Scanner, eine Digitalkamera mit dazugehörigen Bildbearbeitungsprogrammen[28] sowie ein Audio-Player[29] für die Bearbeitung von Soundfiles. Dies ist für die Digitalisierung vor allem grafischer Medien und ihre Integration in die PowerPoint-Datei erforderlich. Angesichts der Größe des Grundkurses mit 15 Schülern werden mindestens vier PC-Stationen benötigt, da es zu Lasten des Lernerfolgs geht, wenn an einem Gerät mehr als vier Schüler arbeiten. Für die Phase der Materialrecherche ist es jedoch hilfreich, wenn jeder Schüler einen PC mit Internetanschluss zur Verfügung hat, damit die Gruppen arbeitsteilig und effektiver arbeiten können. Für einen reibungslosen Arbeitsablauf sollten die Computer mindestens mit einem Pentium-III-Prozessor oder einem vergleichbarem AMD-Prozessor und mit mindestens 128 MB Arbeitsspeicher ausgerüstet sein. Ältere Modelle mit geringerer Leistung ermöglichen zwar noch den Einsatz von PowerPoint, verlangsamen jedoch insbesondere das Bearbeiten von Grafik- und Audio-Elementen.
Da der Schwerpunkt der Unterrichtsreihe auf der Auseinandersetzung der Schüler mit PowerPoint liegen soll, habe ich mich dazu entschieden, einen Handapparat[30] für die Lerngruppe vorzubereiten, der grundlegendes Informationsmaterial in Form von Texten, Zeitungsartikeln, Karten, Fotos usw. bereitstellt. Zudem können die Schüler weitere Information aus dem Internet, aus Bibliotheken oder (im Rahmen außerunterrichtlicher Einheiten) durch eine Recherche vor Ort gewinnen. Somit ist einerseits die Möglichkeit zu eigenständiger Recherche gegeben, andererseits gewährleistet, dass bereits eine hinreichende Menge an Material zur Verfügung steht und beim Eintreten von Zeitknappheit nicht die Projektplanung aus den Fugen gerät.
Da alle Schüler aus der Lerngruppe mittlerweile volljährig sind, kann die Organisation und die Durchführung der Arbeit vor Ort ganz in die Hände und in die Verantwortung der Arbeitsgruppen gelegt werden. Somit werden den Schülern ihre Selbständigkeit und Eigenverantwortung für das Gelingen des Projektes implizit deutlich. Da durch die außerunterrichtlichen und außerschulischen Projekteinheiten ein größerer Arbeitsaufwand für die Schüler entsteht, muss im Vorfeld der Planung – in Absprache mit dem Schuldirektor – ein Ausgleich dieser Leistungen – etwa durch eine Befreiung von einigen Stunden erwogen werden.
3.3 Schwerpunkte der Unterrichtsreihe
Es wird deutlich, dass die Planung und Konzeption des Unterrichtsprojektes insgesamt sehr aufwendig und zeitintensiv ist. Neben der inhaltlichen Schwerpunktsetzung, d.h. der inhaltlichen Bearbeitung der Themenfelder verfolgt das Unterrichtprojekt auch einen methodischen Schwerpunkt. Hierzu gehören sowohl die verschiedenen fachspezifischen Arbeitsmethoden, wie beispielsweise Auswertung von Texten, Bearbeitung von Kartenmaterial, Durchführung von Interviews, als auch die Auseinandersetzung mit dem Präsentationsprogramm PowerPoint. Die Analyse und Reflexion der gesamten Unterrichtsreihe würde den Rahmen der Examensarbeit aufgrund der Dichte und Fülle von didaktischen Fragestellungen bei weitem überschreiten. Daher richtet sich der Blick auf die didaktische Umsetzung von PowerPoint für den Erdkundeunterricht am Beispiel des Projektes des GK 11. Es wird gezeigt, wie sich Schüler aufgabenorientiert und selbständig mit dem Präsentationsprogramm auseinandersetzen und seine technischen Möglichkeiten in Hinblick auf ihre Präsentation kennen lernen können. Die Gestaltung der Unterrichtsreihe als Schulprojekt mit eigenständiger Arbeit, Lösung von Aufgaben in Kleingruppen, eigenverantwortlicher Recherche vor Ort sowie die „Belohnung“ der Arbeit durch eine abschließende Präsentation kann Motivation und Aktivität sowie Zusammenhalt und Kooperationsbereitschaft fördern.
Im Folgenden werden daher jene Stunden erörtert, in denen die didaktische Umsetzung von PowerPoint im Mittelpunkt steht.
Die Aneignung und Beschäftigung mit dem Präsentationsprogramm ist hierbei nicht im Sinne einer losgelösten Methodenschulung konzipiert, sondern findet ihre Verankerung in den gemeinsam formulierten Themenfeldern. Diese bilden den inhaltlichen Ausgangspunkt für Konzeption und Ausrichtung der PowerPoint-Präsentation. Den Schülern muss deutlich gemacht werden, dass – bei aller Motivation und bei allem Tatendrang, das Programm kennen zu lernen – zunächst eine gründliche Recherche und Auswertung des Informationsmaterials der Arbeit am PC vorausgehen muss. Erst nach einer sorgfältigen Bestandsaufnahme und Strukturierung der Inhaltsbausteine sollen die Schüler in ihren Arbeitsgruppen überlegen, welche Möglichkeiten das Programm PowerPoint zur Darstellung und Visualisierung ihrer Ergebnisse bietet und wie diese eingesetzt werden können.[31]
[...]
[1] Im Folgenden werden der Einfachheit wegen beide Geschlechter in der Bezeichnung Schüler zusammengefasst.
[2] Vgl. Fraedrich, 2001, S. 2.
[3] Vgl. Richtlinien und Lehrpläne für die Sek I, 1993, S. 99-101 und Richtlinien und Lehrpläne für die Sek II, 1999, S. 7, S. 39f.
[4] Vgl. Seminar- und Ausbildungsprogramm, 2003, S. 7.
[5] Vgl. hierzu Pohl, 2003, Fraedrich, 2001, Harnischmacher und Rahner, 2001.
[6] Vgl. Seminar- und Ausbildungsprogramm, 2003, S. 8.
[7] Vgl. Ebd.
[8] Vgl. Seminar- und Ausbildungsprogramm, 2003, S. 9.
[9] Vgl. Krotky, 2004. Sogar im Irak-Krieg verwendete US-Außenminister Powell das Microsoft-Programm, um die Existenz irakischer Vernichtungswaffen vor der UNO zu präsentieren.
[10] Vgl. Ebd.
[11] Krotky überschreibt seinen Artikel mit der provokanten Frage: Powerpoint macht blöd?
[12] Vgl. Pohl, 2003, S. 12.
[13] Vgl. Haubrich, 1997, S. 254. Haubrich versteht unter „Medien“ den Sammelbegriff für die Begriffe Anschauungsmittel, Darstellungsmittel, Arbeitsmittel, Lernmittel, Unterrichtsmittel.
[14] Vgl. Harnischmacher und Rahner, 2001, S. 32 f.
[15] Vgl. Ebd., S. 36.
[16] Vgl. Harnischmacher und Rahner, 2001, S. 32.
[17] Vgl. Richtlinien und Lehrpläne für die Sek II, 1999, S. 60.
[18] Vgl. Anhang, Kapitel 7.1.: Der Blick in die Presse verdeutlicht die Aktualität und Realitätsnähe des Themas.
[19] Die Entfernung des Firmensitzes in Königswinter zum Gymnasium in Oberpleis beträgt rund 10 Kilometer.
[20] Vgl. Klöhs, Karl Josef: Mensch, Macher und Mäzen, in: Rheinkiesel August 2002.
[21] Vgl. Haubrich 1997, S. 194.
[22] Vgl. Projektmanagement, o.J.
[23] Vgl. hierzu Haubrich, 1997, S. 194: „Informieren Sie sich gegenseitig in gewissen Abständen über gegenseitige Aktivitäten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsergebnisse.“
[24] Vgl. Projektmanagement, o.J.
[25] Vgl. hierzu Haubrich 1997, S. 195.
[26] Vgl. Anhang, Kapitel 7.9.
[27] Verwendet wurde die Version aus dem Microsoft Office-Paket 2000.
[28] Verwendet wurden die Programme Adobe Photoshop und Paint von Windows.
[29] Verwendet wurde Media-Player von Windows.
[30] Vgl. Anhang, Kapitel 7.10.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieses Textes?
Der Text behandelt den Einsatz von Neuen Medien, insbesondere PowerPoint, im Erdkundeunterricht der Sekundarstufe II, am Beispiel eines Projektes mit dem Felgenhersteller Hayes-Lemmerz in Königswinter. Es geht darum, wie Schüler selbstständig mit PowerPoint arbeiten und lernen können und wie die Entwicklung des Unternehmens Hayes-Lemmerz die wirtschaftliche und siedlungsräumliche Entwicklung von Königswinter beeinflusst hat.
Welche Rolle spielt PowerPoint in diesem Projekt?
PowerPoint wird als Präsentationsmedium genutzt, um die Ergebnisse der Projektarbeit darzustellen. Der Text thematisiert die didaktische Auseinandersetzung mit PowerPoint, die Vermittlung von Medienkompetenz und die Chancen und Schwierigkeiten des Einsatzes des Programms im Unterricht.
Wie ist das Projekt organisiert?
Das Projekt ist in vier Phasen unterteilt: Definition, Planung, Durchführung und Rückblick. Die Schüler arbeiten in Gruppen an verschiedenen Themenfeldern und erstellen selbstständig PowerPoint-Präsentationen. Ein Projektleitfaden dient als konzeptionelles Gerüst.
Welche Themenfelder werden im Projekt behandelt?
Die vier Themenfelder sind: Die Entwicklung von Lemmerz - Vom Familienbetrieb zum global player; Lemmerz und Königswinter - Die Spuren von Paul Lemmerz in Königswinter; Hat die Entwicklung der Firma Auswirkungen auf die Entwicklung des Einzelhandels in Königswinter?; Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in Königswinter – Umgestaltung von Bereichen des Lemmerz-Geländes.
Welche Rahmenbedingungen sind für die Durchführung des Projektes erforderlich?
Es werden PC-Stationen mit Internetanschluss, eine lizenzierte Version von PowerPoint, ein Scanner, eine Digitalkamera mit Bildbearbeitungsprogrammen und ein Audio-Player benötigt. Außerdem wird ein Handapparat mit grundlegendem Informationsmaterial bereitgestellt.
Welche Kritikpunkte werden im Text bezüglich PowerPoint geäußert?
Es wird darauf hingewiesen, dass zu viele Effekte in einer PowerPoint-Präsentation von den eigentlichen Inhalten ablenken können und dass die Gefahr besteht, komplexe Sachverhalte zu vereinfachen und die Kritikfähigkeit zu mindern.
Welche Vorteile bietet PowerPoint im Erdkundeunterricht?
PowerPoint bietet Flexibilität und Vielseitigkeit bei der Gestaltung und Visualisierung von Texten, Grafiken und Fotos. Es ermöglicht die schrittweise Aufbereitung komplexer Inhalte und die Integration verschiedener Informationsmedien wie Karten, Diagramme und Fotos.
Welche Rolle spielt der Lehrer in diesem Projekt?
Der Lehrer unterstützt die Schüler bei der Planung und Durchführung des Projektes, stellt die notwendigen Ressourcen bereit und begleitet den Lernprozess. Er fördert die Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit der Schüler und reflektiert die didaktischen Aspekte des Einsatzes von PowerPoint.
Welche Ziele werden mit dem Projekt verfolgt?
Das Projekt zielt darauf ab, die Medienkompetenz der Schüler zu fördern, ihre Fähigkeit zur selbstständigen Arbeit und zur Zusammenarbeit zu stärken, und ihnen einen Einblick in die wirtschaftsräumliche und siedlungsräumliche Entwicklung ihrer Heimatregion zu geben.
Details
- Titel
- Die Bedeutung von Hayes-Lemmerz für die wirtschaftsräumliche und siedlungsräumliche Entwicklung in Königswinter
- Untertitel
- Eine PowerPoint Präsentation als Ergebnis eines Projektes im GK 11 Erdkunde
- Hochschule
- Seminar für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen Rhein-Sieg, Troisdorf
- Veranstaltung
- Referendariat für Sek I und II
- Note
- 1,0
- Autor
- David Krüger (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2004
- Seiten
- 50
- Katalognummer
- V120720
- ISBN (eBook)
- 9783640295326
- Dateigröße
- 2600 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Bedeutung Hayes-Lemmerz Entwicklung Königswinter Referendariat
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 0,99
- Arbeit zitieren
- David Krüger (Autor:in), 2004, Die Bedeutung von Hayes-Lemmerz für die wirtschaftsräumliche und siedlungsräumliche Entwicklung in Königswinter, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/120720
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-