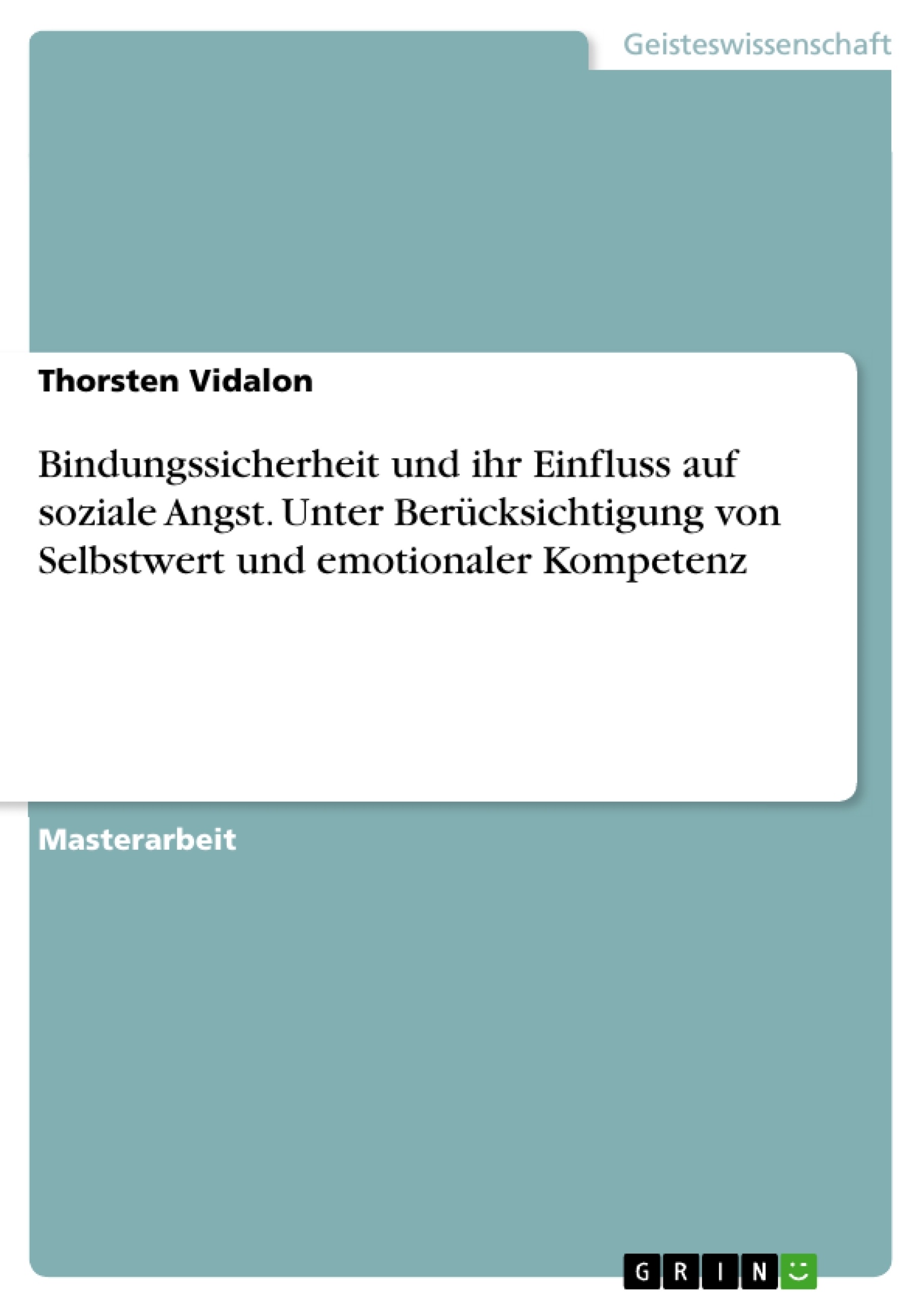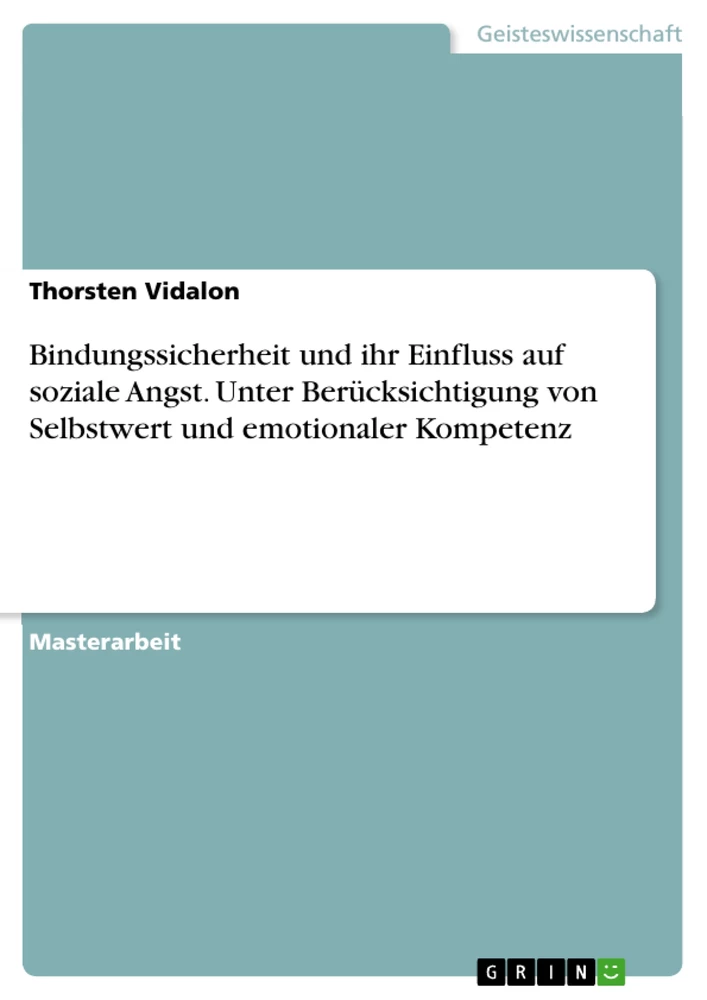
Bindungssicherheit und ihr Einfluss auf soziale Angst. Unter Berücksichtigung von Selbstwert und emotionaler Kompetenz
Masterarbeit, 2021
118 Seiten, Note: 1,2
Psychologie - Klinische Psychologie, Psychopathologie, Prävention
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Theorie
- Einführung
- Bindung
- Bindungstheorie
- Bindungsqualität im Kindesalter
- Bindung und elterliches Erziehungsverhalten
- Bindungsqualität im Erwachsenenalter
- Bindungsstabilität
- Soziale Angst
- Definition
- Diagnostische Kriterien der Sozialen Angststörung
- Epidemiologie der Sozialen Angststörung
- Prävalenz und Komorbiditäten der Sozialen Angststörung
- Beginn und Verlauf der Sozialen Angststörung
- Ätiologie und Risikofaktoren der Sozialen Angststörung
- Genetische Faktoren
- Temperamentsfaktoren
- Soziale Faktoren
- Störungstheorien und Erklärungsmodelle
- Die Kognitive Theorie von Beck
- Das Kognitive Modell von Clark und Wells
- Interpersonelle Modelle
- Selbstwert
- Definition
- Selbstwert und Selbstkonzept
- Formen und Ausprägungen von Selbstwert
- Optimaler Selbstwert
- Prädiktoren und Einflussfaktoren von Selbstwert
- Emotionale Kompetenz
- Definition
- Bereiche der emotionalen Kompetenz
- Entwicklung emotionaler Kompetenz
- Ursachen für Defizite in emotionaler Kompetenz
- Aktueller Forschungsstand
- Bindung und soziale Angst
- Bindung und Selbstwert
- Bindung und emotionale Kompetenz
- Selbstwert und soziale Angst
- Emotionale Kompetenz und soziale Angst
- Selbstwert und emotionale Kompetenz
- Fragestellungen und Hypothesen
- Methoden
- Stichprobenbeschreibung
- Untersuchungsverfahren
- Relationship Scales Questionnaire
- SASKO – Fragebogen zu sozialer Angst und sozialen Kompetenzdefiziten
- Frankfurter Selbstkonzeptskala zur allgemeinen Selbstwertschätzung
- Emotionale-Kompetenz-Fragebogen
- Untersuchungsdesign und Untersuchungsdurchführung
- Auswertungsmethode
- Ergebnisse
- Deskriptive Ergebnisse
- Inferenzstatistische Ergebnisse
- Weiterführende Analysen
- Diskussion
- Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse
- Inhaltliche Einordnung
- Methodenkritische Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Master-Thesis untersucht den Einfluss von Bindungssicherheit auf soziale Angst. Im Fokus stehen die Rolle des Selbstwerts und der emotionalen Kompetenz als potenzielle Mediatoren dieses Effekts.
- Der Einfluss von Bindungssicherheit auf soziale Angst
- Die Rolle des Selbstwerts als Mediator zwischen Bindungssicherheit und sozialer Angst
- Die Rolle der emotionalen Kompetenz als Mediator zwischen Bindungssicherheit und sozialer Angst
- Die Zusammenhänge zwischen Bindungssicherheit, Selbstwert, emotionaler Kompetenz und sozialer Angst
- Die Untersuchung der Angst vor Trennung und der Angst vor Nähe als Aspekte der Bindungssicherheit
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Theorie
- Dieses Kapitel liefert einen umfassenden Überblick über die relevanten theoretischen Konzepte, die für die Untersuchung des Einflusses von Bindungssicherheit auf soziale Angst relevant sind.
- Es werden die Bindungstheorie, die verschiedenen Bindungsqualitäten und ihre Auswirkungen auf das Individuum im Kindes- und Erwachsenenalter erläutert.
- Das Kapitel beleuchtet die Definition, die diagnostischen Kriterien, die Epidemiologie und die Ätiologie von sozialer Angst. Es werden verschiedene Störungstheorien und Erklärungsmodelle vorgestellt, darunter die Kognitive Theorie von Beck und das Kognitive Modell von Clark und Wells.
- Weiterhin wird der Begriff des Selbstwerts definiert und seine Bedeutung für das Selbstkonzept, seine Formen und Ausprägungen sowie Prädiktoren und Einflussfaktoren werden beleuchtet.
- Das Kapitel behandelt den Begriff der emotionalen Kompetenz, ihre Bereiche, ihre Entwicklung und die Ursachen für Defizite in diesem Bereich.
- Zuletzt wird der aktuelle Forschungsstand zu den Zusammenhängen zwischen Bindungssicherheit, sozialer Angst, Selbstwert und emotionaler Kompetenz zusammengefasst.
- Kapitel 2: Methoden
- Dieses Kapitel beschreibt die Methode der Studie, die zur Untersuchung des Einflusses von Bindungssicherheit auf soziale Angst durchgeführt wurde.
- Es werden die Stichprobe, die verwendeten Fragebögen (Relationship Scales Questionnaire, SASKO, Frankfurter Selbstkonzeptskala, Emotionale-Kompetenz-Fragebogen) und das Untersuchungsdesign vorgestellt.
- Zudem wird die Auswertungsmethode der Studie erläutert.
- Kapitel 3: Ergebnisse
- Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Studie, die zur Untersuchung des Einflusses von Bindungssicherheit auf soziale Angst durchgeführt wurde.
- Es werden deskriptive Ergebnisse der verwendeten Fragebögen sowie inferenzstatistische Ergebnisse präsentiert, die die Zusammenhänge zwischen den untersuchten Variablen aufzeigen.
- Weiterhin werden Ergebnisse von weiterführenden Analysen vorgestellt, die den Effekt von Bindungssicherheit auf soziale Angst unter Berücksichtigung des Selbstwerts und der emotionalen Kompetenz genauer beleuchten.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Bindungssicherheit, soziale Angst, Selbstwert und emotionale Kompetenz. Im Fokus stehen die Zusammenhänge zwischen diesen Konzepten und die Rolle des Selbstwerts und der emotionalen Kompetenz als Mediatoren zwischen Bindungssicherheit und sozialer Angst.
Details
- Titel
- Bindungssicherheit und ihr Einfluss auf soziale Angst. Unter Berücksichtigung von Selbstwert und emotionaler Kompetenz
- Hochschule
- SRH Hochschule Heidelberg
- Note
- 1,2
- Autor
- Thorsten Vidalon (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2021
- Seiten
- 118
- Katalognummer
- V1215097
- ISBN (eBook)
- 9783346628008
- ISBN (Buch)
- 9783346628015
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- bindungssicherheit einfluss angst unter berücksichtigung selbstwert kompetenz
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 39,99
- Preis (Book)
- US$ 50,99
- Arbeit zitieren
- Thorsten Vidalon (Autor:in), 2021, Bindungssicherheit und ihr Einfluss auf soziale Angst. Unter Berücksichtigung von Selbstwert und emotionaler Kompetenz, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1215097
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-