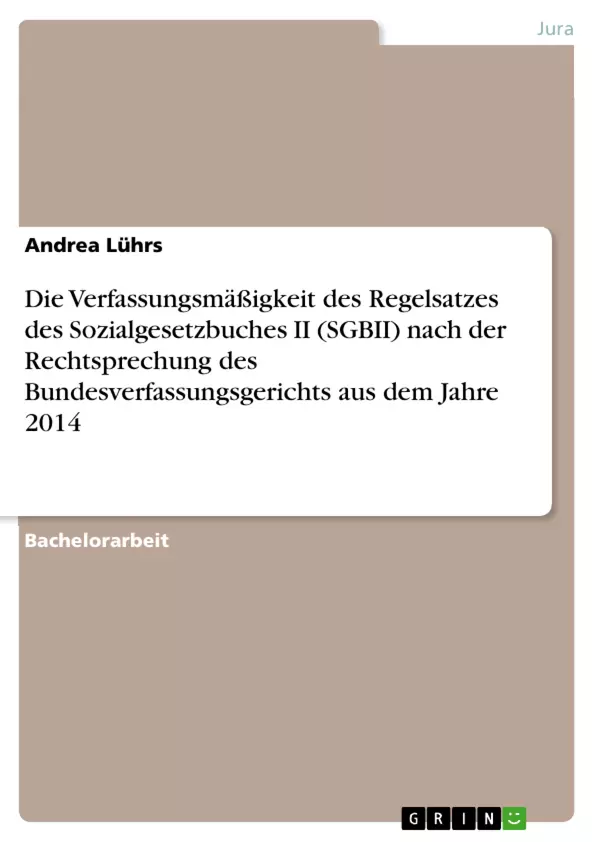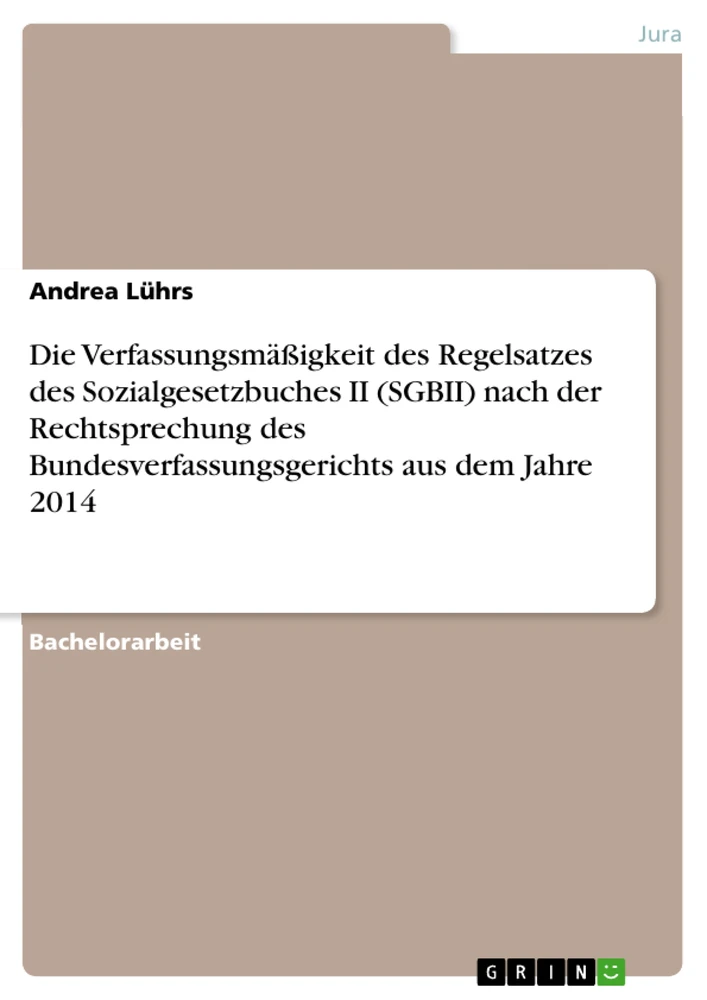
Die Verfassungsmäßigkeit des Regelsatzes des Sozialgesetzbuches II (SGBII) nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 2014
Bachelorarbeit, 2021
49 Seiten, Note: 1,9
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sozialstaatsprinzip
- Leistungsspektrum des deutschen Sozialstaates
- Das Bundesverfassungsgericht
- Entscheidungen zu der Verfassungsmäßigkeit des Regelsatzes nach dem SGB II
- Ergebnis
- Regelbedarf des Sozialgesetzbuch II
- Grundsätzliche Anspruchsvoraussetzungen
- Anspruchsvoraussetzungen: Covid19-Pandemie
- Ermittlung des Regelsatzes
- Regelbedarfsermittlungsgesetz
- Regelbedarfsstufen
- Zusammensetzung des Regelbedarfs
- Abt. 1 Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
- Abt. 6 Gesundheitspflege
- Grundsätzliche Anspruchsvoraussetzungen
- Covid-19-Pandemie
- Erhöhte Regelsätze nach dem SGB II in der Covid–19 Pandemie
- Entwicklung der Preise in der Covid-19-Pandemie
- Entwicklung des Verbraucherpreisindexes für Abt. 1
- Entwicklung des Verbraucherpreisindexes für Abt. 6
- Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit
- Schutzbereich
- Zwischenergebnis
- Eingriff in den Schutzbereich
- Zwischenergebnis
- Unzulässigkeit des Eingriffs
- Verfassungsrechtliche Rechtfertigung
- Ergebnis
- Schutzbereich
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit der Verfassungsmäßigkeit des Regelsatzes nach dem SGB II in der aktuellen Covid-19-Pandemie. Im Fokus steht die Analyse der Abteilungen 1 (Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren) und 6 (Gesundheitspflege) des Regelsatzes im Hinblick auf das Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum. Die Arbeit untersucht die Entwicklung des Regelsatzes im Lichte des Regelbedarfsurteils des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2010 und der aktuellen Preisentwicklung im Kontext der Covid-19-Pandemie. Darüber hinaus werden die grundsätzlichen Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug von Leistungen nach dem SGB II erläutert.
- Verfassungsmäßigkeit des Regelsatzes nach dem SGB II in der Covid-19-Pandemie
- Das Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum
- Die Preisentwicklung im Kontext der Covid-19-Pandemie
- Das Regelbedarfsurteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2010
- Grundsätzliche Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug von Leistungen nach dem SGB II
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Verfassungsmäßigkeit des Regelsatzes nach dem SGB II in der Covid-19-Pandemie ein. Sie erläutert die Relevanz des Themas und die Ziele der wissenschaftlichen Arbeit. Darüber hinaus werden die einzelnen Kapitel der Arbeit vorgestellt.
Im zweiten Kapitel wird das Sozialstaatsprinzip und seine Bedeutung für die Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums dargestellt. Außerdem wird das Leistungsspektrum des deutschen Sozialstaates erläutert.
Das dritte Kapitel behandelt die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungsmäßigkeit des Regelsatzes nach dem SGB II. Es wird insbesondere auf das Regelbedarfsurteil aus dem Jahr 2010 eingegangen und die daraus resultierenden Rahmenbedingungen für die Ermittlung des Regelsatzes dargestellt.
Kapitel 4 befasst sich mit dem Regelbedarf des Sozialgesetzbuches II. Es werden die grundsätzlichen Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug von Leistungen nach dem SGB II sowie die Ermittlung des Regelsatzes erläutert. Die Zusammensetzung des Regelbedarfs, insbesondere die Abteilungen 1 und 6, wird näher betrachtet.
Das fünfte Kapitel analysiert die Covid-19-Pandemie und ihre Auswirkungen auf den Regelsatz nach dem SGB II. Es wird auf die Entwicklung der Preise in der Covid-19-Pandemie, insbesondere für die Abteilungen 1 und 6 des Regelsatzes, eingegangen.
Kapitel 6 untersucht die Verfassungsmäßigkeit des Regelsatzes nach dem SGB II in der Covid-19-Pandemie. Es werden die Schutzbereiche des Grundrechts auf ein menschenwürdiges Existenzminimum, die Eingriffe in diese Schutzbereiche sowie die Rechtfertigung dieser Eingriffe analysiert.
Das Fazit fasst die Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung des Regelsatzes nach dem SGB II.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind: Sozialstaatsprinzip, Regelsatz, SGB II, Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum, Bundesverfassungsgericht, Regelbedarfsurteil, Covid-19-Pandemie, Preisentwicklung, Verfassungsmäßigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Warum wurde der SGB II Regelsatz 2010 für verfassungswidrig erklärt?
Das Bundesverfassungsgericht stellte fest, dass die Ermittlung der Regelsätze nicht transparent und sachgerecht genug war, um das menschenwürdige Existenzminimum sicherzustellen.
Wie wird das menschenwürdige Existenzminimum hergeleitet?
Es leitet sich aus Artikel 1 Abs. 1 Grundgesetz (Menschenwürde) in Verbindung mit Artikel 20 Abs. 1 Grundgesetz (Sozialstaatsprinzip) ab.
Welche Rolle spielte die Covid-19-Pandemie für die Regelsatz-Debatte?
In der Pandemie stiegen die Preise für Lebensmittel und Gesundheitspflege stark an, was die Frage aufwarf, ob die aktuellen Regelsätze noch zur Deckung des Bedarfs ausreichen.
Was sind die Abteilungen 1 und 6 des Regelsatzes?
Abteilung 1 umfasst Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren. Abteilung 6 bezieht sich auf die Gesundheitspflege. Beide sind essenziell für das physische Existenzminimum.
Was ist das Regelbedarfsermittlungsgesetz?
Es ist die gesetzliche Grundlage, nach der die Höhe der Regelbedarfe auf Basis von Einkommens- und Verbrauchsstichproben (EVS) statistisch ermittelt wird.
Gibt es während der Pandemie erhöhte Regelsätze?
Die Arbeit untersucht, ob Einmalzahlungen oder Anpassungen ausreichten, um die pandemiebedingte Inflation bei Grundbedürfnissen auszugleichen.
Details
- Titel
- Die Verfassungsmäßigkeit des Regelsatzes des Sozialgesetzbuches II (SGBII) nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 2014
- Hochschule
- ( Europäische Fernhochschule Hamburg )
- Note
- 1,9
- Autor
- Andrea Lührs (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2021
- Seiten
- 49
- Katalognummer
- V1229041
- ISBN (Buch)
- 9783346682499
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Unter Betrachtung der aktuellen Covid-19-Pandemie
- Schlagworte
- Regelsatz SGBII Verfassungsgemäß Existenzminimum
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Andrea Lührs (Autor:in), 2021, Die Verfassungsmäßigkeit des Regelsatzes des Sozialgesetzbuches II (SGBII) nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 2014, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1229041
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-