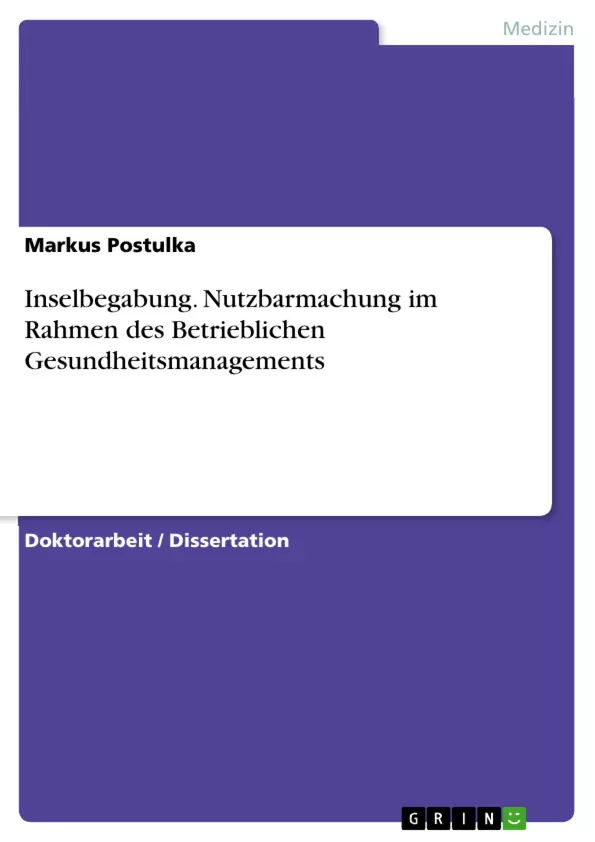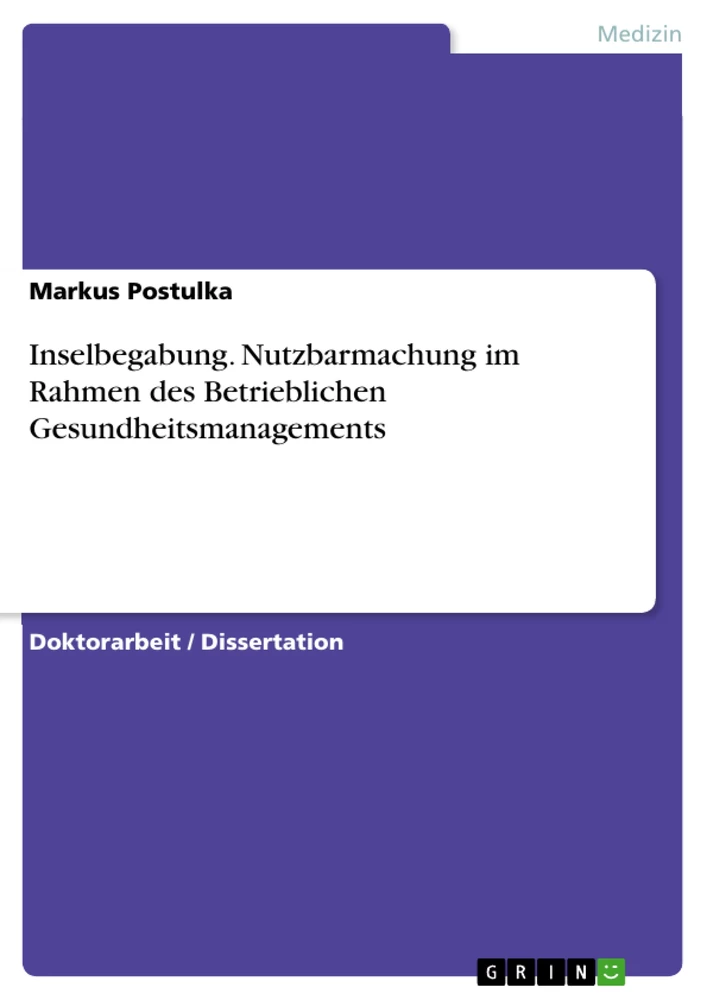
Inselbegabung. Nutzbarmachung im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
Doktorarbeit / Dissertation, 2022
147 Seiten, Note: cum laude
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Hinführung zum Thema
- 1.2 Forschungsziele und Hypothesen
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 1.4 Forschungsdesign
- 2. Inselbegabung
- 2.1 Allgemeine Bestimmung
- 2.2 Forschungshistorie
- 2.3 Prävalenz
- 2.4 Ätiopathogenetische Ansätze
- 2.4.1 Prozedurale Informationsverarbeitung
- 2.4.2 Rechtshemisphärische Kompensation
- 2.4.3 Hereditäre Einflüsse
- 2.4.4 Kognitive Filterfunktion
- 2.4.5 Sonstige
- 2.5 Bewertungskriterien und Erfassung
- 2.6 Kompetenzen und Skills
- 2.7 Risiken und Beeinträchtigungen
- 2.8 Übertragungsversuche
- 2.9 Beispiele
- 3. Das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM)
- 3.1 Entwicklung und Bestimmung BGM
- 3.2 Ziele
- 3.3 Modelle und Ansätze
- 3.3.1 Pathogenese
- 3.3.2 Salutogenese
- 3.3.3 Disability Management
- 3.3.4 Normierte Qualitätsstandards
- 3.3.5 Sozialkapitalansatz
- 3.4 Instrumente
- 3.4.1 Fordern statt Überfordern
- 3.4.2 Gesundes Führen
- 3.4.3 Digitalisierung
- 3.4.4 Psychische Gefährdungsbeurteilung
- 3.4.5 Analyseverfahren und Erhebungsinstrumente
- 3.5 Grenzen
- 3.5.1 Selbstbestimmung und Datenschutz
- 3.5.2 KMU
- 4. Empirie
- 4.1 Aufbau des Fragebogens
- 4.2 Stichprobe
- 4.3 Pretest und Durchführung
- 4.4 Statistische Auswertung
- 4.5 Ergebnisse
- 4.5.1 Beschreibung der Population und deskriptive Auswertung
- 4.5.2 Beschäftigungsfähigkeit von Inselbegabten in Abhängigkeit von der Unternehmensgröße
- 4.5.3 Beschäftigungsfähigkeit von Inselbegabten in Abhängigkeit von der Gewinnorientierung der Organisation
- 5. Diskussion
- 5.1 Hypothese 1
- 5.2 Hypothese 2
- 5.3 Hypothese 3
- 5.4 Hypothese 4
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Dissertation untersucht die Nutzbarmachung von Inselbegabung im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Das Hauptziel ist es, die Beschäftigungsfähigkeit von Menschen mit Inselbegabung zu analysieren und Ansatzpunkte für ein erfolgreiches BGM zu identifizieren. Die Arbeit basiert auf empirischen Daten und analysiert den Einfluss verschiedener Faktoren auf die Beschäftigungsfähigkeit.
- Definition und Charakteristika von Inselbegabung
- Aktuelle Forschungsansätze zur Inselbegabung
- Konzepte und Modelle des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)
- Empirische Untersuchung der Beschäftigungsfähigkeit von Inselbegabten
- Ableitung von Handlungsempfehlungen für das BGM
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses einleitende Kapitel führt in die Thematik der Inselbegabung und deren Relevanz im Kontext des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) ein. Es werden die Forschungsfragen und Hypothesen der Arbeit formuliert und das methodische Vorgehen erläutert. Der Leser erhält einen Überblick über den Aufbau der gesamten Dissertation und die zu erwartenden Ergebnisse.
2. Inselbegabung: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Darstellung des Konstrukts "Inselbegabung". Es werden verschiedene Definitionen und die Forschungshistorie beleuchtet, Prävalenzraten diskutiert und ätiopathogenetische Ansätze, wie prozedurale Informationsverarbeitung, rechtshemisphärische Kompensation und hereditäre Einflüsse, detailliert beschrieben. Die Kapitel erläutern außerdem Bewertungskriterien, Kompetenzen, Risiken und Beeinträchtigungen, sowie Übertragungsversuche und Beispiele zur Inselbegabung.
3. Das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM): Dieses Kapitel liefert einen umfassenden Überblick über das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM). Es werden die Entwicklung und Definition von BGM, die Ziele und verschiedene Modelle und Ansätze (Pathogenese, Salutogenese, Disability Management, normierte Qualitätsstandards und der Sozialkapitalansatz) dargestellt. Der Fokus liegt auf Instrumenten des BGM wie "Fordern statt Überfordern", gesundem Führen, Digitalisierung, psychischer Gefährdungsbeurteilung und den dazugehörigen Analyseverfahren. Schließlich werden die Grenzen des BGM, insbesondere die Aspekte Selbstbestimmung, Datenschutz und die Herausforderungen für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), beleuchtet.
4. Empirie: In diesem Kapitel wird die empirische Untersuchung detailliert beschrieben. Es beinhaltet den Aufbau des verwendeten Fragebogens, die Beschreibung der Stichprobe und die Vorgehensweise bei Pretest und Durchführung der Studie. Die statistische Auswertungsmethode wird erläutert und die Ergebnisse der Untersuchung werden präsentiert, differenziert nach der Beschreibung der Population, der Beschäftigungsfähigkeit von Inselbegabten in Abhängigkeit von der Unternehmensgröße und der Gewinnorientierung der Organisation.
Schlüsselwörter
Inselbegabung, Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM), Beschäftigungsfähigkeit, empirische Forschung, Hypothesentestung, Prävalenz, Ätiopathogenese, Kompetenzen, Risiken, KMU, Datenschutz, Salutogenese, Pathogenese.
Häufig gestellte Fragen zur Dissertation: Inselbegabung und Betriebliches Gesundheitsmanagement
Was ist der Gegenstand dieser Dissertation?
Die Dissertation untersucht die Beschäftigungsfähigkeit von Menschen mit Inselbegabung und analysiert, wie das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) diese fördern kann. Sie basiert auf empirischen Daten und untersucht den Einfluss verschiedener Faktoren auf die Beschäftigungsfähigkeit von Personen mit Inselbegabung.
Welche Themen werden in der Dissertation behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: Definition und Charakteristika von Inselbegabung, aktuelle Forschungsansätze dazu, Konzepte und Modelle des BGM, eine empirische Untersuchung der Beschäftigungsfähigkeit von Inselbegabten und die Ableitung von Handlungsempfehlungen für das BGM.
Wie ist die Dissertation aufgebaut?
Die Dissertation gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung (mit Forschungsfragen, Hypothesen und methodischem Vorgehen), ein Kapitel zur Inselbegabung (Definition, Forschungshistorie, Prävalenz, Ätiopathogenese, Bewertung, Kompetenzen, Risiken und Beispiele), ein Kapitel zum BGM (Entwicklung, Ziele, Modelle, Instrumente und Grenzen), ein empirisches Kapitel (Fragebogen, Stichprobe, Auswertung und Ergebnisse) und abschließend eine Diskussion der Ergebnisse im Bezug auf die aufgestellten Hypothesen.
Welche Methoden wurden in der empirischen Untersuchung verwendet?
Die empirische Untersuchung basiert auf einem Fragebogen. Die Dissertation beschreibt den Aufbau des Fragebogens, die Stichprobe, den Pretest, die Durchführung und die statistische Auswertungsmethode. Die Ergebnisse werden detailliert dargestellt und differenziert nach Unternehmensgröße und Gewinnorientierung der Organisation analysiert.
Welche Ergebnisse liefert die empirische Untersuchung?
Die empirischen Ergebnisse werden in Bezug auf die Beschäftigungsfähigkeit von Inselbegabten in Abhängigkeit von der Unternehmensgröße und der Gewinnorientierung der Organisation präsentiert. Die detaillierte Auswertung und Interpretation dieser Ergebnisse findet in Kapitel 4.5 statt.
Welche Hypothesen werden in der Dissertation untersucht?
Die Dissertation formuliert mehrere Hypothesen, die im Kapitel "Diskussion" (Kapitel 5) einzeln geprüft und im Hinblick auf die empirischen Ergebnisse bewertet werden.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Dissertation?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Inselbegabung, Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM), Beschäftigungsfähigkeit, empirische Forschung, Hypothesentestung, Prävalenz, Ätiopathogenese, Kompetenzen, Risiken, KMU, Datenschutz, Salutogenese und Pathogenese.
Wer sollte diese Dissertation lesen?
Diese Dissertation richtet sich an Wissenschaftler, die sich mit Inselbegabung und Betrieblichem Gesundheitsmanagement beschäftigen, sowie an Praktiker im Bereich Human Resources und Personalentwicklung. Sie bietet relevante Informationen für die Gestaltung von BGM-Maßnahmen im Umgang mit Inselbegabung.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Dissertation enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, welche die Kernaussagen und Ergebnisse jedes Kapitels prägnant zusammenfasst.
Wo finde ich den vollständigen Inhalt der Dissertation?
Der vollständige Inhalt der Dissertation ist nicht in diesem FAQ-Dokument enthalten. Dieses FAQ dient lediglich als Übersicht und Zusammenfassung der wichtigsten Punkte.
Details
- Titel
- Inselbegabung. Nutzbarmachung im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
- Hochschule
- Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
- Note
- cum laude
- Autor
- Dr. Markus Postulka (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2022
- Seiten
- 147
- Katalognummer
- V1234562
- ISBN (eBook)
- 9783346652720
- ISBN (Buch)
- 9783346652737
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- inselbegabung nutzbarmachung rahmen betrieblichen gesundheitsmanagements
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Dr. Markus Postulka (Autor:in), 2022, Inselbegabung. Nutzbarmachung im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1234562
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-