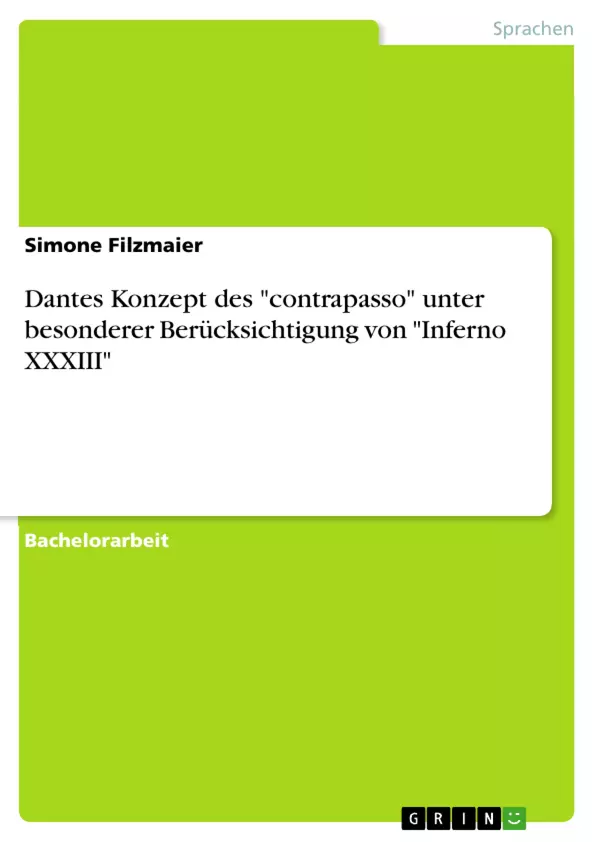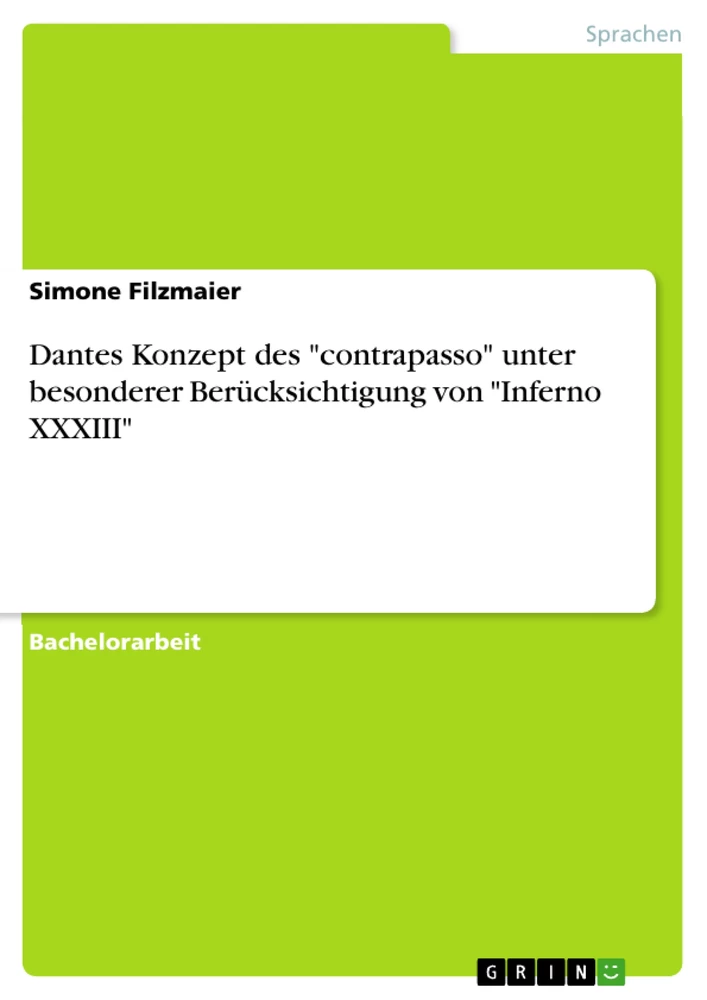
Dantes Konzept des "contrapasso" unter besonderer Berücksichtigung von "Inferno XXXIII"
Bachelorarbeit, 2021
42 Seiten, Note: 2,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Il contrapasso
- 2.1. Das Talionsprinzip der Bibel als Modell der Vergeltung
- III. Inferno: das Leiden in seiner Mannigfaltigkeit
- 3.1. La Tenebra, sofferenza e nudità
- 3.2. Der contrapasso der Analogie und der Antithese
- 3.3. Le pene nell'Inferno
- 3.4. Vergeltung und Belohnung in den weiteren cantiche
- 3.4.1. Purgatorio
- 3.4.2. Paradiso
- IV. Dantes Darstellung des contrapasso im nicht-theoretischen Rahmen
- 4.1. Die Körperlichkeit der Schatten als Merkmal in der Commedia
- 4.2. Die contrapassi in konkreten, ausgewählten Fällen
- 4.2.1. Canto V: Francesca e Paolo
- 4.2.2. Canto XXVIII: Bertran de Born
- 4.2.3. Canto XXXIII: l'episodio e contrapasso di Ugolino Della Gherardesca
- V. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht das Konzept des Contrapasso in Dantes Inferno, insbesondere seine Anwendung im Canto XXXIII. Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung des Contrapasso, analysiert seine Umsetzung in verschiedenen Episoden der Hölle und untersucht die Darstellungstechniken Dantes. Die Arbeit möchte die Gerechtigkeit in Dantes Inferno ergründen und die Beziehung zwischen Sünde und Strafe aufzeigen.
- Das Konzept des Contrapasso und seine historischen Wurzeln
- Die Anwendung des Contrapasso im Inferno
- Die Darstellungstechniken Dantes zur Veranschaulichung des Contrapasso
- Die Beziehung zwischen Sünde und Strafe im Inferno
- Detaillierte Analyse des Canto XXXIII und des Falls Ugolino della Gherardesca
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den Kontext, in dem sich Dante beim Schreiben der Divina Commedia befand. Sie erläutert die Bedeutung des Gefühls der Verlorenheit und die Notwendigkeit einer gerechten Vergeltung für begangene Sünden als Grundlage für den Transfer von Seelen in die Hölle. Die Arbeit konzentriert sich auf die Gerechtigkeit im Inferno und die zentrale Rolle des Contrapasso als Modell dieser Gerechtigkeit.
II. Il contrapasso: Dieses Kapitel behandelt das Konzept des Contrapasso selbst. Es wird auf die biblischen Ursprünge des Talionsprinzips eingegangen und verschiedene Definitionen des Contrapasso, sowohl antike als auch moderne, diskutiert. Der Fokus liegt auf der mittelalterlichen Vorstellung von Gerechtigkeit, welche das dantesche Konzept des Contrapasso beeinflusst hat.
III. Inferno: das Leiden in seiner Mannigfaltigkeit: Dieses Kapitel analysiert die vielfältigen Formen des Leidens in der Hölle. Es untersucht den Contrapasso der Analogie und der Antithese und behandelt die verschiedenen Strafen, die den Sündern auferlegt werden. Ein Vergleich mit den Strafen im Purgatorio und Paradiso wird angedeutet, um die Gesamtheit des Systems zu veranschaulichen.
IV. Dantes Darstellung des contrapasso im nicht-theoretischen Rahmen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die konkrete Darstellung des Contrapasso in ausgewählten Cantos. Es untersucht die Körperlichkeit der Schatten und die Art und Weise, wie Dante das Prinzip des Contrapasso auf individuelle Fälle anwendet. Die Analyse spezifischer Beispiele aus den Cantos V, XXVIII und XXXIII soll die verschiedenen Aspekte und Umsetzungsmöglichkeiten des Contrapasso verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Contrapasso, Divina Commedia, Inferno, Dante Alighieri, Gerechtigkeit, Vergeltung, Sünde, Strafe, Talionsprinzip, Canto XXXIII, Ugolino della Gherardesca, Mittelalter, mittelalterliche Gerechtigkeit.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Dantes Contrapasso im Inferno
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht das Konzept des Contrapasso in Dantes Inferno, insbesondere dessen Anwendung im Canto XXXIII. Sie beleuchtet die historische Entwicklung des Contrapasso, analysiert seine Umsetzung in verschiedenen Episoden der Hölle und untersucht Dantes Darstellungstechniken. Ein Schwerpunkt liegt auf der Gerechtigkeit in Dantes Inferno und der Beziehung zwischen Sünde und Strafe.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: das Konzept des Contrapasso und seine historischen Wurzeln, die Anwendung des Contrapasso im Inferno, Dantes Darstellungstechniken zur Veranschaulichung des Contrapasso, die Beziehung zwischen Sünde und Strafe im Inferno und eine detaillierte Analyse des Canto XXXIII und des Falls Ugolino della Gherardesca.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: I. Einleitung: Einführung in die Thematik, Kontext der Divina Commedia, Bedeutung von Verlorenheit und gerechter Vergeltung. II. Il contrapasso: Das Konzept des Contrapasso, biblische Ursprünge (Talionsprinzip), verschiedene Definitionen. III. Inferno: das Leiden in seiner Mannigfaltigkeit: Formen des Leidens in der Hölle, Contrapasso der Analogie und Antithese, Strafen im Inferno, Vergleich mit Purgatorio und Paradiso. IV. Dantes Darstellung des contrapasso im nicht-theoretischen Rahmen: Konkrete Darstellung des Contrapasso in ausgewählten Cantos, Körperlichkeit der Schatten, Analyse von Cantos V, XXVIII und XXXIII. V. Fazit: Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen.
Welche konkreten Beispiele aus dem Inferno werden analysiert?
Die Arbeit analysiert unter anderem die Fälle von Francesca und Paolo (Canto V), Bertran de Born (Canto XXVIII) und Ugolino della Gherardesca (Canto XXXIII), um die verschiedenen Aspekte und Umsetzungsmöglichkeiten des Contrapasso zu verdeutlichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Contrapasso, Divina Commedia, Inferno, Dante Alighieri, Gerechtigkeit, Vergeltung, Sünde, Strafe, Talionsprinzip, Canto XXXIII, Ugolino della Gherardesca, Mittelalter, mittelalterliche Gerechtigkeit.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit möchte die Gerechtigkeit in Dantes Inferno ergründen und die Beziehung zwischen Sünde und Strafe aufzeigen, indem sie das Konzept des Contrapasso detailliert untersucht und anhand konkreter Beispiele aus dem Inferno veranschaulicht.
Details
- Titel
- Dantes Konzept des "contrapasso" unter besonderer Berücksichtigung von "Inferno XXXIII"
- Hochschule
- Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (Romanistik)
- Note
- 2,0
- Autor
- Simone Filzmaier (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2021
- Seiten
- 42
- Katalognummer
- V1234794
- ISBN (Buch)
- 9783346666239
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Dante Alighieri Inferno Ugolino della Gherardesca Gesang XXXIII Gesang 33 contrapasso contrappasso poena sensus poena damnis Talionsprinzip
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 28,99
- Arbeit zitieren
- Simone Filzmaier (Autor:in), 2021, Dantes Konzept des "contrapasso" unter besonderer Berücksichtigung von "Inferno XXXIII", München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1234794
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-