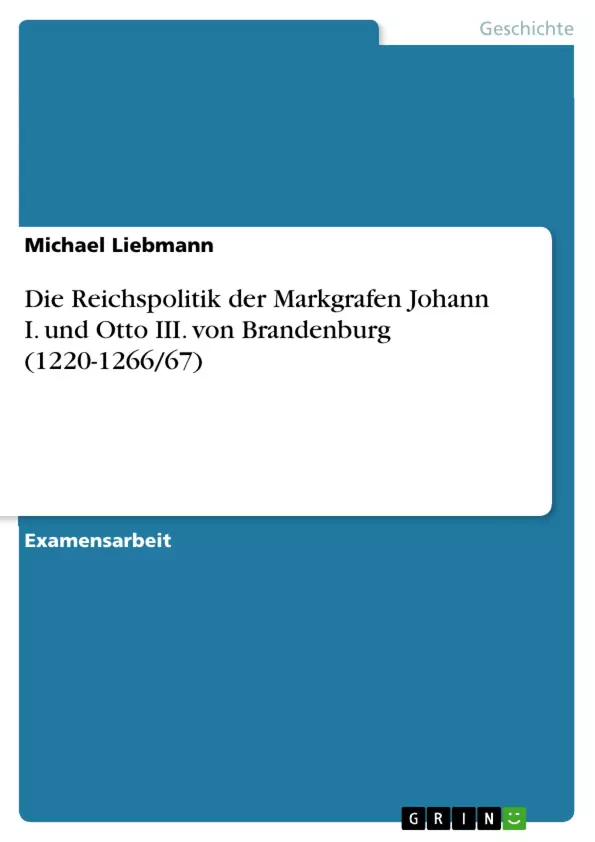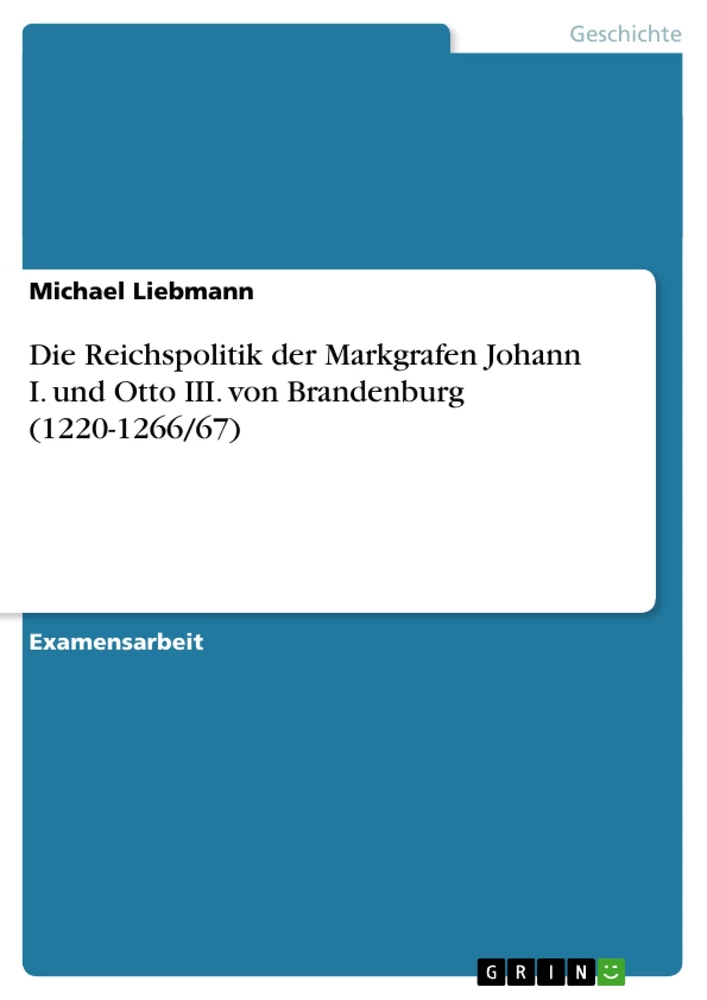
Die Reichspolitik der Markgrafen Johann I. und Otto III. von Brandenburg (1220-1266/67)
Examensarbeit, 1998
121 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Zeit der Unmündigkeit
- Johann und Otto im deutsch-dänischen Konflikt
- Die Markgrafen als Gegner des Kaisers im welfischen Erbgüterstreit
- Die Belehnung mit der Markgrafschaft
- Auswirkungen der Fürstenprivilegien Friedrichs II. auf die Mark
- Die Verfolgung der Häretiker
- Der welfisch-staufische Ausgleich
- Vollstreckung der Reichsacht gegen den Herzog von Österreich
- Johann und Otto als Parteigänger des Kaisers
- Die Anerkennung des Gegenkönigs Wilhelm von Holland
- Der Kampf um die Reichsstadt Lübeck
- Markgraf Ottos Bewerbung um den Königsthron
- Die letzten Regierungsjahre
- Zusammenfassung
- Quellen und Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Reichspolitik der brandenburgischen Markgrafen Johann I. und Otto III. (1220-1266/67). Im Fokus steht die bisher wenig beachtete Rolle der Markgrafen in der Reichspolitik, unter Berücksichtigung des aktuellen Forschungsstandes. Die Arbeit vermeidet eine heroisierende Darstellung und konzentriert sich auf eine detailgenaue Betrachtung der Ereignisse innerhalb eines definierten Zeitrahmens, um einen Beitrag zu einer umfassenderen Strukturgeschichte zu leisten.
- Die Beziehungen der Markgrafen Johann I. und Otto III. zum römisch-deutschen König.
- Die Beteiligung der Markgrafen an wichtigen Reichsereignissen und Konflikten.
- Die territorialpolitischen Aktivitäten der Markgrafen im Kontext der Reichspolitik.
- Die Auswirkungen der Fürstenprivilegien auf die Handlungsspielräume der Markgrafen.
- Die Rolle der Markgrafen im Verhältnis von Fürsten, König und Reich.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit widmet sich der Reichspolitik der askanischen Markgrafen Johann I. und Otto III. von Brandenburg (1220-1267), einem bisher wenig erforschten Aspekt ihrer Regierungszeit. Sie zielt darauf ab, die Rolle der Markgrafen in der Reichspolitik im Kontext des aktuellen Forschungsstandes neu zu beleuchten und ihre Handlungen in Bezug auf den König und das Reich zu analysieren, ohne dabei eine reine „Heldengeschichte“ zu schreiben. Der Begriff „Reichspolitik“ wird dabei präzise definiert und auf die Beziehungen der Markgrafen zum König fokussiert, da dieser im Verständnis der damaligen Zeit das Reich verkörperte. Die Arbeit soll einen Beitrag zu einem breiteren Verständnis der Beziehungen zwischen Fürsten, König und Reich im Hochmittelalter leisten.
Die Zeit der Unmündigkeit: Dieses Kapitel behandelt die Jahre der Vormundschaft über die jungen Markgrafen und beleuchtet die politischen Konstellationen und Einflüsse, die während dieser Phase die späteren Handlungen der Regenten prägten. Es analysiert die Herausforderungen und Möglichkeiten, die sich aus der Unmündigkeit für die Machtausübung und die Gestaltung der Beziehungen zum Reich ergaben. Die Analyse berücksichtigt die Rolle der Vormünder und die komplexen Machtverhältnisse innerhalb des brandenburgischen Herrschaftsbereiches sowie dessen Einbettung in das Reichsgefüge.
Johann und Otto im deutsch-dänischen Konflikt: Dieses Kapitel untersucht die Beteiligung der Markgrafen am deutsch-dänischen Konflikt, analysiert ihre strategischen Entscheidungen und die Motive dahinter. Es beleuchtet die Auswirkungen dieser Konflikte auf die brandenburgische Politik und die Beziehungen zu anderen Reichsständen und dem König. Die Analyse fokussiert auf die jeweiligen Interessenlagen und das Wechselspiel zwischen regionalen und reichsweiten politischen Strategien der Markgrafen. Die Bedeutung des Konflikts für die Positionierung der Markgrafen innerhalb des Reiches wird erörtert.
Die Markgrafen als Gegner des Kaisers im welfischen Erbgüterstreit: Dieses Kapitel analysiert den Konflikt der Markgrafen mit dem Kaiser im Kontext des welfischen Erbgüterstreits. Es beleuchtet die Hintergründe des Konflikts, die beteiligten Parteien und deren jeweiligen Strategien. Die Analyse befasst sich mit den Motiven der Markgrafen, ihrer Positionierung im Konflikt und den Konsequenzen ihrer Entscheidungen für ihre Beziehung zum Kaiser und dem Reich. Es wird untersucht, wie dieser Konflikt die Machtverhältnisse innerhalb des Reiches beeinflusste und die Rolle Brandenburgs darin.
Die Belehnung mit der Markgrafschaft: Dieses Kapitel befasst sich mit den Umständen und den Auswirkungen der Belehnung der Markgrafen mit der Markgrafschaft. Es analysiert die politischen und rechtlichen Aspekte der Belehnung, die Bedeutung der Markgrafschaft innerhalb des Reiches und die damit verbundenen Rechte und Pflichten der Markgrafen. Die Analyse betrachtet die langfristigen Konsequenzen der Belehnung für die Entwicklung Brandenburgs und seine Beziehungen zum Reich. Die Rolle der königlichen Autorität und die Bedingungen der Belehnung werden detailliert untersucht.
Auswirkungen der Fürstenprivilegien Friedrichs II. auf die Mark: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen der von Friedrich II. erlassenen Fürstenprivilegien auf die Mark Brandenburg. Es analysiert die konkreten Inhalte der Privilegien, ihre Interpretation durch die Markgrafen und die daraus resultierenden Veränderungen in der Politik und Verwaltung der Mark. Die Analyse beleuchtet den Einfluss dieser Privilegien auf die Beziehungen der Markgrafen zum Reich und zu anderen Reichsständen und deren Auswirkungen auf die Entwicklung der Markgrafschaft Brandenburg.
Die Verfolgung der Häretiker: Dieses Kapitel analysiert die Rolle der Markgrafen bei der Verfolgung von Häretikern. Es untersucht die politischen und religiösen Motive hinter dieser Verfolgung, die Methoden und die Auswirkungen auf die Bevölkerung der Mark. Die Analyse betrachtet den Kontext der damaligen religiösen und politischen Verhältnisse im Reich und deren Einfluss auf die Handlungen der Markgrafen. Die Bedeutung der Häretikerverfolgung für die Innen- und Außenpolitik Brandenburgs wird erörtert.
Der welfisch-staufische Ausgleich: Dieses Kapitel beleuchtet die Beteiligung der Markgrafen am welfisch-staufischen Ausgleich und deren Positionierung in diesem wichtigen Reichsgeschehen. Es analysiert die Motive und Strategien der Markgrafen, die Auswirkungen des Ausgleichs auf ihre Herrschaft und ihre Beziehungen zum Reich. Die Analyse berücksichtigt die komplexen Machtverhältnisse innerhalb des Reiches und die Bedeutung des Ausgleichs für die zukünftige Entwicklung Brandenburgs.
Vollstreckung der Reichsacht gegen den Herzog von Österreich: Dieses Kapitel untersucht die Rolle der Markgrafen bei der Vollstreckung der Reichsacht gegen den Herzog von Österreich. Es analysiert die Hintergründe der Reichsacht, die Beteiligung der Markgrafen an deren Vollstreckung und die daraus resultierenden Folgen für ihre Beziehungen zum Reich und zum betroffenen Herzog. Die Analyse betrachtet die strategischen Überlegungen der Markgrafen und die Auswirkungen ihrer Handlungen auf die Machtverhältnisse im Reich.
Johann und Otto als Parteigänger des Kaisers: Dieses Kapitel analysiert die Unterstützung der Markgrafen für den Kaiser und untersucht die Gründe für diese Loyalität. Es beleuchtet die konkreten Maßnahmen der Markgrafen zur Unterstützung des Kaisers und die damit verbundenen Auswirkungen auf ihre eigene Herrschaft und ihre Beziehungen zu anderen Reichsständen. Die Analyse betrachtet die strategischen Vorteile und Risiken dieser Unterstützung für Brandenburg.
Die Anerkennung des Gegenkönigs Wilhelm von Holland: Dieses Kapitel untersucht die Anerkennung Wilhelms von Holland als Gegenkönig durch die Markgrafen und analysiert die Motive und die strategischen Überlegungen hinter dieser Entscheidung. Es beleuchtet die Auswirkungen dieser Anerkennung auf die Beziehungen der Markgrafen zum legitimen König und auf die politischen Verhältnisse im Reich. Die Analyse berücksichtigt den Kontext der damaligen Auseinandersetzungen um die Königswahl und die Folgen dieser Entscheidung für Brandenburg.
Der Kampf um die Reichsstadt Lübeck: Dieses Kapitel analysiert die Beteiligung der Markgrafen am Kampf um die Reichsstadt Lübeck, ihre Ziele und Strategien. Es untersucht die Auswirkungen dieses Kampfes auf die Beziehungen der Markgrafen zum Reich und zu anderen Reichsständen, insbesondere zu den norddeutschen Städten. Die Analyse befasst sich mit dem strategischen Kontext des Kampfes um Lübeck und dessen Bedeutung für die Machtpolitik im norddeutschen Raum.
Markgraf Ottos Bewerbung um den Königsthron: Dieses Kapitel analysiert die Bewerbung Ottos um den Königsthron, die damit verbundenen Motive und die strategischen Überlegungen. Es untersucht die Chancen und Risiken dieser Bewerbung, die Reaktion anderer Reichsstände und die Auswirkungen auf die Position Brandenburgs im Reich. Die Analyse berücksichtigt den Kontext der damaligen Königswahl und die Bedeutung dieser Bewerbung für die Geschichte Brandenburgs.
Die letzten Regierungsjahre: (Summary excluded as per instructions)
Schlüsselwörter
Reichspolitik, Askanier, Markgrafschaft Brandenburg, Johann I., Otto III., römisch-deutscher König, Fürstenprivilegien, territoriale Politik, deutsch-dänischer Konflikt, welfischer Erbgüterstreit, Häresie, Reichsgewalt, Königswahl, Landfrieden.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Reichspolitik der askanischen Markgrafen Johann I. und Otto III. von Brandenburg (1220-1267)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Reichspolitik der brandenburgischen Markgrafen Johann I. und Otto III. zwischen 1220 und 1266/67. Der Fokus liegt auf ihrer bisher wenig beachteten Rolle in der Reichspolitik, unter Berücksichtigung des aktuellen Forschungsstandes. Die Arbeit vermeidet eine heroisierende Darstellung und konzentriert sich auf eine detailgenaue Betrachtung der Ereignisse.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Beziehungen der Markgrafen zum römisch-deutschen König, ihre Beteiligung an wichtigen Reichsereignissen und Konflikten, ihre territorialpolitischen Aktivitäten im Kontext der Reichspolitik, die Auswirkungen der Fürstenprivilegien auf ihr Handeln und ihre Rolle im Verhältnis von Fürsten, König und Reich.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu folgenden Themen: Einleitung, Die Zeit der Unmündigkeit, Johann und Otto im deutsch-dänischen Konflikt, Die Markgrafen als Gegner des Kaisers im welfischen Erbgüterstreit, Die Belehnung mit der Markgrafschaft, Auswirkungen der Fürstenprivilegien Friedrichs II. auf die Mark, Die Verfolgung der Häretiker, Der welfisch-staufische Ausgleich, Vollstreckung der Reichsacht gegen den Herzog von Österreich, Johann und Otto als Parteigänger des Kaisers, Die Anerkennung des Gegenkönigs Wilhelm von Holland, Der Kampf um die Reichsstadt Lübeck, Markgraf Ottos Bewerbung um den Königsthron, Die letzten Regierungsjahre, Zusammenfassung und Quellen und Literatur.
Wie wird die Reichspolitik der Markgrafen definiert?
Der Begriff „Reichspolitik“ wird präzise auf die Beziehungen der Markgrafen zum König fokussiert, da dieser im Verständnis der damaligen Zeit das Reich verkörperte.
Welche Rolle spielten die Markgrafen in wichtigen Reichskonflikten?
Die Arbeit analysiert die Beteiligung der Markgrafen an Konflikten wie dem deutsch-dänischen Konflikt, dem welfischen Erbgüterstreit und dem Kampf um die Reichsstadt Lübeck. Es werden ihre strategischen Entscheidungen, Motive und die Auswirkungen dieser Konflikte auf ihre Politik und Beziehungen zu anderen Reichsständen und dem König untersucht.
Wie beeinflussten die Fürstenprivilegien Friedrichs II. die Markgrafen?
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen der Fürstenprivilegien Friedrichs II. auf die Mark Brandenburg, ihre Interpretation durch die Markgrafen und die daraus resultierenden Veränderungen in Politik und Verwaltung. Der Einfluss dieser Privilegien auf die Beziehungen der Markgrafen zum Reich und zu anderen Reichsständen wird analysiert.
Welche Bedeutung hatte die Häretikerverfolgung für die Markgrafen?
Die Arbeit analysiert die Rolle der Markgrafen bei der Verfolgung von Häretikern, die politischen und religiösen Motive, die Methoden und die Auswirkungen auf die Bevölkerung. Der Kontext der damaligen religiösen und politischen Verhältnisse im Reich und deren Einfluss auf die Handlungen der Markgrafen wird berücksichtigt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Reichspolitik, Askanier, Markgrafschaft Brandenburg, Johann I., Otto III., römisch-deutscher König, Fürstenprivilegien, territoriale Politik, deutsch-dänischer Konflikt, welfischer Erbgüterstreit, Häresie, Reichsgewalt, Königswahl, Landfrieden.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Rolle der Markgrafen in der Reichspolitik neu zu beleuchten, ihre Handlungen in Bezug auf den König und das Reich zu analysieren und einen Beitrag zu einem breiteren Verständnis der Beziehungen zwischen Fürsten, König und Reich im Hochmittelalter zu leisten.
Wo finde ich die Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Die Zusammenfassung der einzelnen Kapitel findet sich im Abschnitt "Zusammenfassung der Kapitel" der vorliegenden Arbeit.
Details
- Titel
- Die Reichspolitik der Markgrafen Johann I. und Otto III. von Brandenburg (1220-1266/67)
- Hochschule
- Humboldt-Universität zu Berlin
- Note
- 1,0
- Autor
- Michael Liebmann (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 1998
- Seiten
- 121
- Katalognummer
- V124078
- ISBN (eBook)
- 9783640288052
- ISBN (Buch)
- 9783640288106
- Dateigröße
- 823 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Die Arbeit ist vom bewertenden Professor und dem Landesprüfungsamt Berlin als quantitativ und qualitativ sehr hochwertig beschrieben und mit der Bestnote 1,0 gewürdigt worden. Obwohl schon einige Jahre her, ist sie wissenschaftlich noch nicht überholt, da das Thema m.E. seither nicht mehr bearbeitet worden ist.
- Schlagworte
- Reichspolitik Markgrafen Johann Otto Brandenburg
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 42,99
- Preis (Book)
- US$ 55,99
- Arbeit zitieren
- Michael Liebmann (Autor:in), 1998, Die Reichspolitik der Markgrafen Johann I. und Otto III. von Brandenburg (1220-1266/67), München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/124078
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-