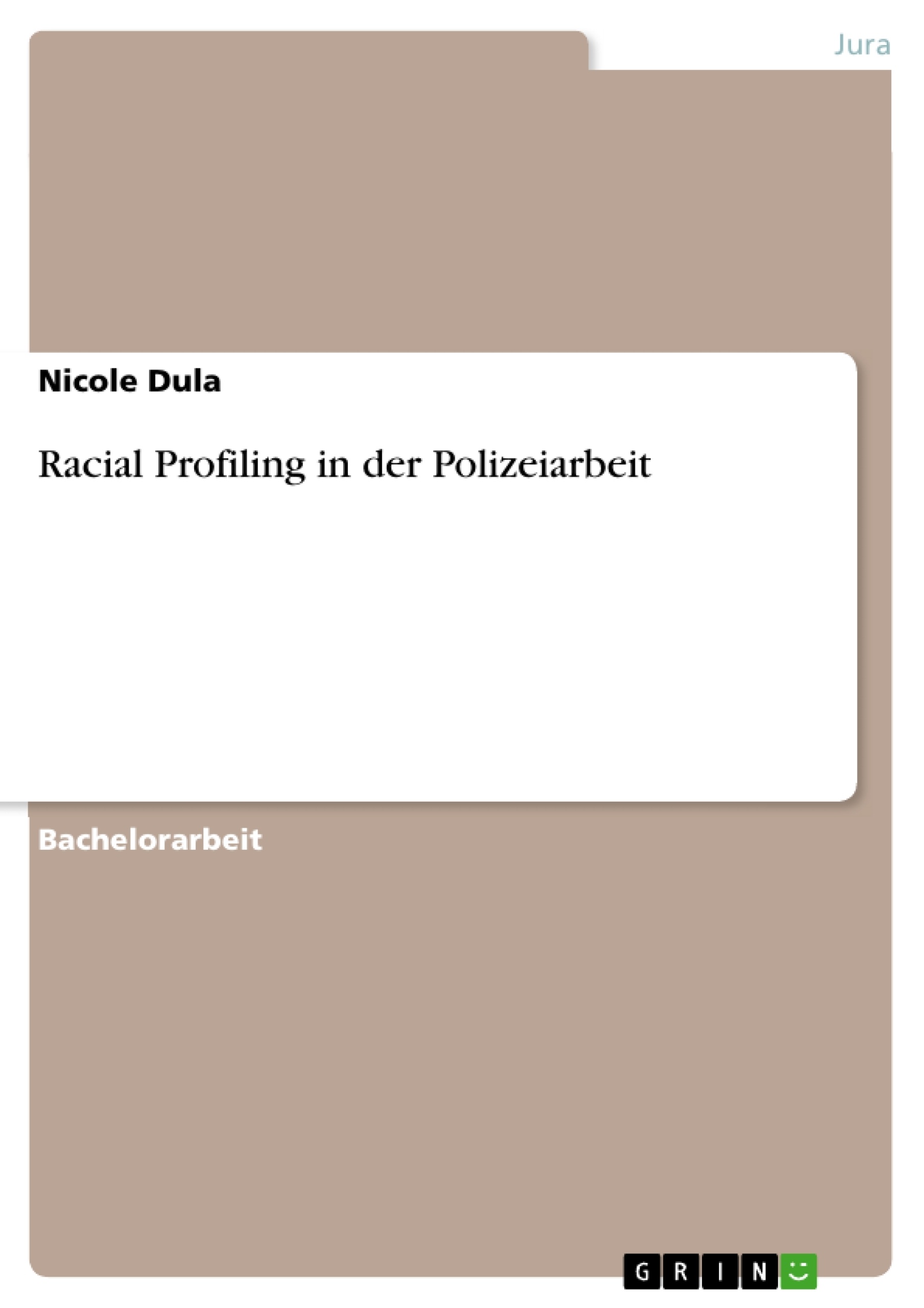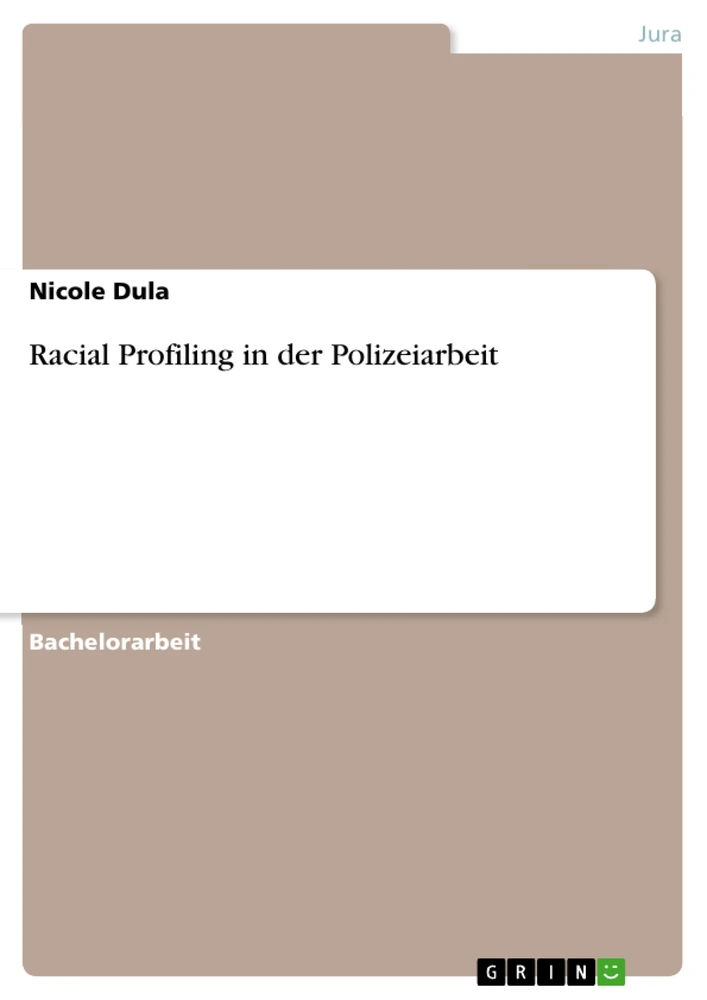
Racial Profiling in der Polizeiarbeit
Bachelorarbeit, 2021
55 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel 1: Einleitung
- Kapitel 2: Die Geschichte von Dula
- Kapitel 3: Die Kultur und Traditionen von Dula
- Kapitel 4: Die Wirtschaft von Dula
- Kapitel 5: Die Herausforderungen von Dula
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Erforschung von Dula, einem einzigartigen Ort mit einer reichen Geschichte, Kultur und Wirtschaft. Das Ziel ist es, die komplexen Aspekte von Dula zu beleuchten und ein tieferes Verständnis für seine Entwicklung und Herausforderungen zu schaffen.
- Die Geschichte und Entstehung von Dula
- Die kulturellen Traditionen und sozialen Normen von Dula
- Die wirtschaftliche Bedeutung und Herausforderungen von Dula
- Die politischen und sozialen Strukturen von Dula
- Die Zukunftsperspektiven und Herausforderungen für Dula
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung
Dieses Kapitel führt den Leser in das Thema ein und stellt die Relevanz von Dula im Kontext der gegenwärtigen Welt dar. Es beschreibt die Forschungsmethodik und die wichtigsten Themen, die in der Arbeit behandelt werden.
Kapitel 2: Die Geschichte von Dula
Dieses Kapitel erforscht die Geschichte von Dula, beginnend mit seinen Ursprüngen bis hin zu seiner Entwicklung in der heutigen Zeit. Es behandelt die wichtigsten Ereignisse, Persönlichkeiten und Einflüsse, die Dula geprägt haben.
Kapitel 3: Die Kultur und Traditionen von Dula
Dieses Kapitel analysiert die kulturellen Traditionen und sozialen Normen von Dula. Es untersucht die Rolle von Religion, Kunst, Musik, Tanz und anderen kulturellen Ausdrucksformen im Leben der Menschen in Dula.
Kapitel 4: Die Wirtschaft von Dula
Dieses Kapitel befasst sich mit der Wirtschaft von Dula. Es analysiert die wichtigsten Wirtschaftszweige, die Arbeitsbedingungen und die wirtschaftlichen Herausforderungen, denen Dula gegenübersteht.
Schlüsselwörter
Dula, Geschichte, Kultur, Traditionen, Wirtschaft, Herausforderungen, Entwicklung, Zukunftsperspektiven.
Details
- Titel
- Racial Profiling in der Polizeiarbeit
- Hochschule
- Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
- Note
- 1,3
- Autor
- Nicole Dula (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2021
- Seiten
- 55
- Katalognummer
- V1243205
- ISBN (Buch)
- 9783346684202
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- racial profiling polizeiarbeit
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Nicole Dula (Autor:in), 2021, Racial Profiling in der Polizeiarbeit, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1243205
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-