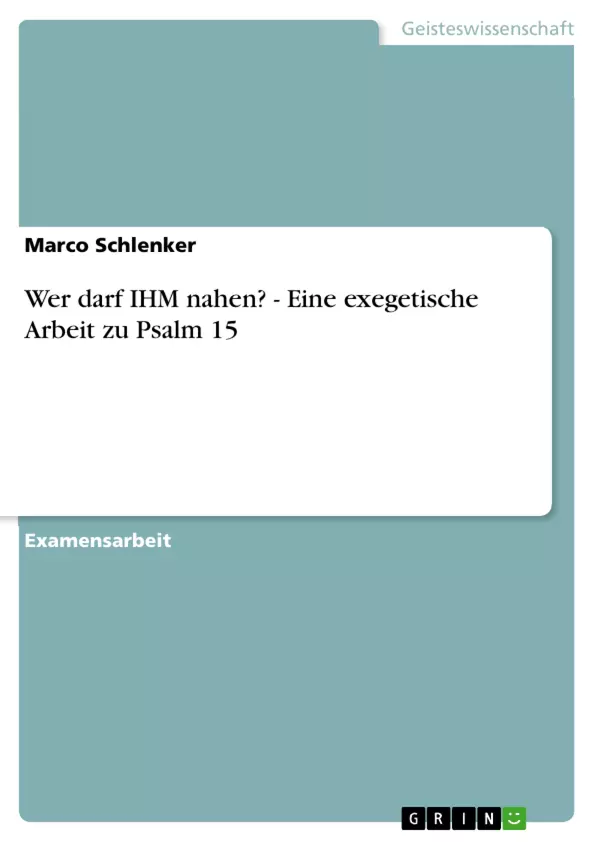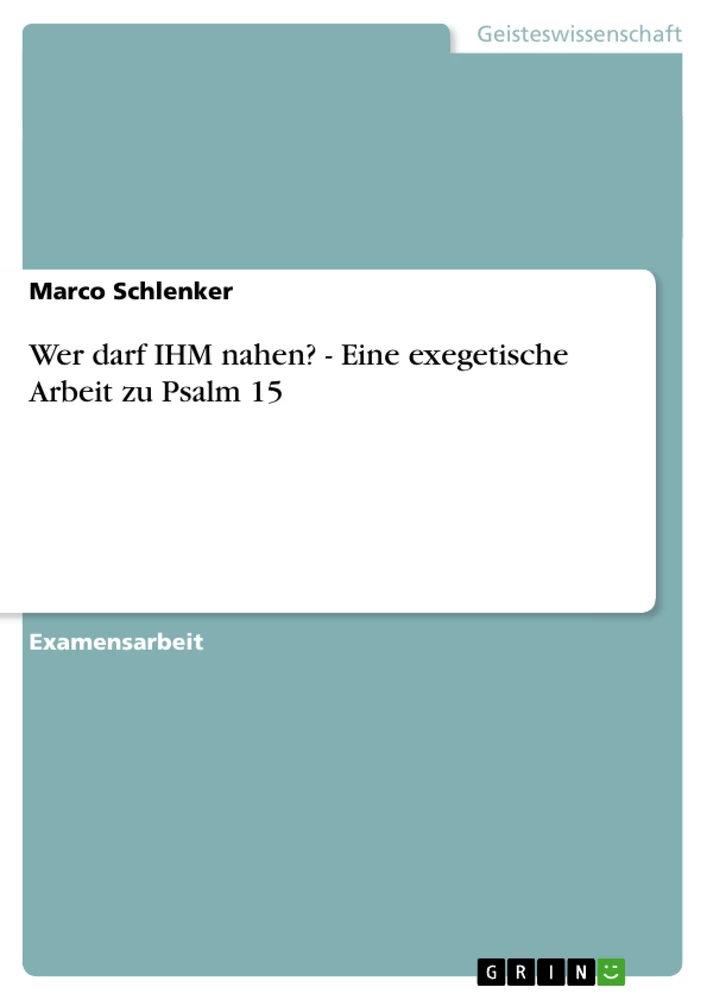
Wer darf IHM nahen? - Eine exegetische Arbeit zu Psalm 15
Examensarbeit, 1997
20 Seiten, Note: 1,5
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Text
2 Klärung wichtiger Grundbegriffe
3 Kontextbetrachtung
4 Gliederung des Textes
5 Sprachgestalt des Textes
5.1 Gattung
5.2 Stil
5.3 Stilfiguren
5.4 Sitz im Leben
6 Exegese
6.1 Einzelexegese in Sinnabschnitten
6.1.1 Die Frage
6.1.2 Die Antwort
6.1.3 Die Verheißung
6.2 Zusammenfassung
7 Wirkungsgeschichte
8 Theologischer Kontext im Blick auf das Neue Testament
9 Persönliche Bemerkungen
10 Literaturverzeichnis
10.1 Primärliteratur:
10.2 Sekundärliteratur:
1 Text
1. Ein Psalm Davids Jahwe, wer darf weilen in deinem Zelt,
wer darf wohnen auf dem Berg deines Heiligtums?
2. Wer fehllos wandelt und Recht tut und es wahrhaftig meint in seinem Herzen.
3. Wer nicht mit der Zunge Verleumdung verbreitet, seinem Nächsten nichts Böses antut und keine Schmach bringt über seinen Nachbarn.
4. In dessen Augen der Ausgestoßene verhasst ist und der die Jahwe-Gläubigen ehrt, der Wort hält, auch wenn er sich zum Schaden geschworen.[1]
5. Der sein Geld nicht auf Wucher gibt und Bestechung gegen Schuldlose nicht annimmt. Wer das tut, wird niemals wanken.
2 Klärung wichtiger Grundbegriffe
V. 1: Das Wort lha bedeutet hier Zelt oder Behausung. Vermutlich klingt hier noch der „Zeltcharakter“ des Heiligtums (Stiftshütte) mit. Die Bezeichnung „Zelt Jahwes“ gehört zu den verschiedenen Bezeichnungen für den Jerusalemer Tempel, sie ist eine „archaisierende Metapher“[2].
Ebenso ist der „Berg des Heiligtums“ eine Bezeichnung für den Zionsberg, der für Israel der heilige Berg ist. Die Kultstätten der Israeliten waren meistens in höheren Lagen zu finden.
„Weilen“ heißt wörtl. „Gast sein“ und beinhaltet das Genießen des „Gastrechtes Jahwes“, ebenso bedeutet „wohnen“ hier „Hausrecht“ haben.
V. 2: Der Begriff qdx meint hier Recht auch im Sinne von Bundestreue. Es steht in einer engen Verbindung mit tyrb (berit) und wird oft als bundesgemäßes Verhalten gesehen. Sowohl Jahwes Gerechtigkeit als auch die Gerechtigkeit der Menschen werden hiermit bezeichnet. Das Gesetz und die Gebote verhelfen dem Menschen dazu, innerhalb der Gesellschaft und auch vor Gott Gerechtigkeit zu erfahren. In der LXX werden die verschiedenen Wörter des Stammes qdx meistens mit dikaioun, dikaiosunh, und dikaioV wiedergegeben. Recht bezeichnet hier also den Stand vor Jahwe, wenn sich der Mensch gemäß Ps 15, 2ff verhält.
Mymt bedeutet soviel wie: vollständig, einwandfrei, vollkommen, untadelig, aufrichtig, unversehrt (kommt auch als Substantiv vor). Letztendlich kann diese Eigenschaft nur Jahwe zukommen, seine Weisungen sind vollkommen. Aber auch zum Beispiel das Passahlamm soll vollkommen und unversehrt sein.
Klh meint gehen, wandeln oder auch sich verhalten. Als Substantiv bedeutet der Stamm auch Weg oder Bahn. Hier ist somit also der je eigene Lebensvollzug, der „Lebenswandel“ gemeint.
V. 3: Der Anfang des Satzes heißt wörtlich „jemandem auf seiner Zunge hinterherlaufen“[3], was sehr bildhaft die Tatsache des Verleumdens darstellt. Der Begriff Zunge ist neben vielen anderen (Mund, Lippen, Gaumen etc.) der Begriff, der am meisten für falsches und rechtes Reden gebraucht wird. Während das Alte Testament für Ohr und Auge nur jeweils ein Wort kennt, gibt es für das „Sprechorgan“, das ja letztendlich auch den Menschen vom Tier unterscheidet, eine Fülle von Begriffen.[4]
Die beiden Wörter für „Nachbar“ und „Nächster“ können hier gleichwertig gesehen werden.
V. 4: Mit dem „Ausgestoßenen“ oder auch „Verworfenen“ sind diejenigen bezeichnet, die nicht zur Jahwe-Gemeinde gehören. Von diesen Menschen galt es sich zu distanzieren, ja sie zu meiden.
V. 5: Mit Mlvi wird eine lange Zeit oder auch die Ewigkeit bezeichnet.
evm al heißt „nicht wanken“, die LXX übersetzte: ou saleuqhsetai eiV ton aiwna.
3 Kontextbetrachtung
Generell gehört der Psalm 15 in einen großen Block der Psalmen, die mit dem Namen David überschrieben sind. Die Psalmen 3 - 41 tragen die Angabe „ein Psalm Davids“, ebenso wie die Psalmen 51 - 65 und 68 - 70, was nach damaliger Tradition nicht unbedingt auf den Autor der Psalmen schließen lässt.
Die Psalmen 11 - 14 werden teilweise als „Armengebete“ bezeichnet, da in ihnen der Psalmbeter seine Nöte und Klagen vor Gott ausspricht. Ab Psalm 16 folgen dann wesentlich positivere Psalmen, die eher die Freude, das Vertrauen und den Lobpreis zum Inhalt haben. Der Psalm 15 scheint eine „Schnittstelle“ dieser Themenblöcke zu sein, da er die Anliegen der vorherigen Psalmen aufgreift und eine positive Wendung schafft.
Vielleicht liegt hier eine unzufällige Reihenfolge vor, jedoch lassen sich Verwandtschaften zwischen einzelnen Psalmen nur philologisch und formgeschichtlich untersuchen. Versuche in der Vergangenheit, die Psalmen sinnvoll zu gliedern stießen auf wenig Erfolg.
4 Gliederung des Textes
Abgesehen von der Überschrift, die ja für den Text nicht weiter von Bedeutung ist, liegt es nahe, den Psalm in drei gröbere Teile aufzugliedern:
Teil A:
Vers 1 b + c Die Frage (n) 2er-Strophe
Teil B:
Vers 2 a - 5 b Antwort als ethische Explikation
(V. 2 zunächst allgemein, dann ab 2er-Strophe
V. 3 konkret) 3er-Strophe
3er-Strophe
2er-Strophe
Teil C:
Vers 5 c Die Verheißung 1er-Strophe
Bei der Übersetzung des Textes am Anfang habe ich versucht durch Absätze und eingerückte Verse die Struktur des Psalms darzustellen. Es wird deutlich, dass die Frage aus einer 2er-Strophe besteht und der Teil B zwei 3er-Strophen enthält, die durch je eine 2er-Strophe eingerahmt sind. Im Vers 2 wird zunächst eine allgemeine Äußerung gemacht, dann folgen ab Vers 3 konkrete Anweisungen. Die einzeilige Verheißung bildet den Abschluss.
Bei diesem sehr logischen Aufbau liegt nahe, dass der Text einen bestimmten Sitz im Leben hat, auf den ich dann im Kapitel „Sprachgestalt des Textes“ noch eingehen werde.
Mit der Frage im Teil A setzt der Psalm ein, und es scheint, als ob der „Laie“ am Tempeleingang fragt, wer in das Heiligtum treten darf. Anschließend sprechen wohlmöglich von Innen her die Tempeldiener oder der Priester und geben die Antwort in Form von ethischen Bedingungen (Teil B), was schließlich zu der Verheißung im Teil C führt.
5 Sprachgestalt des Textes
5.1 Gattung
Der Psalm 15 wird von den meisten Auslegern zu dem Kreis der Tempeleinlassliturgie, der Einzugs-Tora oder auch des „Pfortengesprächs“ gezählt.[5] Der Zugang zum Tempelbezirk wurde durch einen liturgischen Wechselgesang geregelt, in dem die Bedingungen zum Einlass von einem Priester katechismusartig dargelegt wurden. Sehr enge altt. Parallelen sind Psalm 24, 3 - 6 und Jesaja 33, 14 - 16. Der Pilger fragt am Tor nach den Einlassbedingungen, und vom Inneren des Tempels ertönt die Antwort. In vorwiegend negativen Formulierungen trägt der Priester die Antwort vor. Diese Antworten dienen dem Pilger als eine Art „Beichtspiegel“[6], der vor dem Tempelbesuch zur Reflexion und zur Buße aufruft.
G. v. Rad ist der Meinung, dass dieses Zeremoniell beim Einzug einer Prozession in den vor-exilischen Tempel stattfand.[7] (siehe auch „Sitz im Leben“) Interessant ist, dass hier keine Opfer- oder Reinigungsrituale verlangt werden, sondern dass ausschließlich ethische Forderungen gestellt werden.
Einige Ausleger vermuten einen Bezug zum Dekalog gerade auch aufgrund der Anzahl der Worte (zehn), jedoch ist dieser nicht abgesichert. (Besonders H. J. Kraus unterscheidet hier streng zwischen den allgemeinen Äußerungen in V. 2 und den konkreten ab V. 3)[8]
5.2 Stil
Der Stil des Psalms ist einerseits durch seinen klaren Aufbau und seine Formulierungen als liturgisch zu bezeichnen, jedoch tritt auch gerade im Teil B ein deutlich lehrhafter Stil zu Tage, der einem Katechismus ähnelt. Solche katechismusartigen Aufzählungen finden sich außerdem noch in Jes. 33, 14 - 16, Jer. 7, 1 - 11 und Hes. 18, 5 - 9.
Die vorwiegend negativen Antworten in diesem Teil lassen vermuten, dass dem Pilger schon vorher die positiven Unterweisungen (etwa aus dem Dekalog) bekannt waren und dass sie ihm am Tempelzugang noch einmal in der Form einer Liturgie vorgetragen wurden. Interessanterweise hat H. J. Kraus beobachtet, das zwischen der Frage in V. 1 und der Antwort in V. 5c eine Inkongruenz besteht. Die Frage wird nicht direkt mit der Verheißung beantwortet, sondern findet schon ab V. 2 ihre Beantwortung.[9] Dahingegen hat Hossfeld festgestellt, dass der Schluss eher weisheitlich geprägt ist. Gerade der „Tun-Ergehen-Zusammenhang“, wie er in der übrigen Weisheitsliteratur oft dargestellt ist, kommt hier voll zum Tragen: „Demnach ist Psalm 15 eine weisheitlich beeinflusste Anlehnung an die Einzugsliturgie.“[10]
[...]
[1] Es fehlt im masoretischen Text der zweite Halbvers, deshalb ist H. J. Kraus der Meinung, die Überset-zung: „...den Eid hält, auch wenn es ihm schadet“ (so auch bei Luther) sei nicht möglich. Bei H. Gunkel heißt es: „hat er geschworen, er vertauschts um das Schlechtere nicht.“ Verschiedene Lesarten des masoretischen Textes (insbesondere die der LXX) lassen unterschiedliche Interpretationen zu (LXX schreibt: „... o omnuwn tw
plhsion autou kai ouk aJetwn“). Gunkel schreibt weiterhin, dass seine Übersetzung die Hauptsache ergänze und stellt so einen Bezug zu Lev. 27, 10 + 33 her.
[2] Hossfeld, S. 106
[3] Hossfeld, S. 107
[4] siehe auch H. W. Wolff zum Thema „Mund“ S. 120f.
[5] Seybold, S. 68
[6] Seybold, S. 68
[7] v. Rad, S. 375
[8] Kraus, S. 112
[9] Kraus, S. 112f
Häufig gestellte Fragen zu dem Psalm 15
Was ist der Psalm 15 und was behandelt er?
Der Psalm 15 ist ein Psalm Davids, der sich mit der Frage auseinandersetzt, wer im Zelt Jahwes weilen und auf dem Berg seines Heiligtums wohnen darf. Er beschreibt ethische Bedingungen für den Zugang zum Heiligtum.
Welche Grundbegriffe werden im Psalm 15 geklärt?
Geklärt werden Begriffe wie "Zelt Jahwes," "Berg des Heiligtums," "weilen," "wohnen," qdx (Gerechtigkeit/Bundestreue), mymt (vollständig/einwandfrei), klh (wandeln/sich verhalten), "jemandem auf seiner Zunge hinterherlaufen" (Verleumdung), "Nachbar/Nächster," und Mlvi (Ewigkeit).
In welchen Kontext ist der Psalm 15 einzuordnen?
Der Psalm 15 gehört zu den Davidpsalmen und steht zwischen "Armengebeten" und positiven Psalmen des Lobpreises und Vertrauens. Er stellt eine Art Schnittstelle dar, die die Anliegen der vorherigen Psalmen aufgreift und eine positive Wendung schafft.
Wie ist der Psalm 15 aufgebaut?
Der Psalm ist in drei Teile gegliedert: Teil A (Vers 1 b + c), der die Frage stellt; Teil B (Vers 2 a - 5 b), der die Antwort in Form ethischer Explikationen gibt; und Teil C (Vers 5 c), der die Verheißung ausspricht.
Welche Gattung hat der Psalm 15?
Der Psalm 15 wird als Tempeleinlassliturgie, Einzugs-Tora oder Pfortengespräch eingeordnet. Er gehört zu den Texten, die einen liturgischen Wechselgesang am Tempeleingang beinhalten, in dem Bedingungen für den Einlass dargelegt werden.
Welchen Stil hat der Psalm 15?
Der Stil ist liturgisch und lehrhaft (katechismusartig). Die vorwiegend negativen Formulierungen in Teil B lassen darauf schließen, dass dem Pilger die positiven Unterweisungen bereits bekannt waren.
Welche ethischen Forderungen werden im Psalm 15 gestellt?
Es werden ethische Forderungen wie fehlerloses Wandeln, Gerechtigkeit üben, wahrhaftig sein, keine Verleumdung verbreiten, dem Nächsten nichts Böses antun, den Ausgestoßenen verachten, die Jahwe-Gläubigen ehren, Wort halten, kein Geld auf Wucher geben und keine Bestechung annehmen gestellt.
Was wird demjenigen versprochen, der die ethischen Forderungen erfüllt?
Demjenigen, der die ethischen Forderungen erfüllt, wird versprochen, dass er niemals wanken wird.
Gibt es Parallelen zu anderen Texten des Alten Testaments?
Ja, sehr enge Parallelen sind Psalm 24, 3 - 6 und Jesaja 33, 14 - 16.
Welche Bedeutung haben die Begriffe "Zelt Jahwes" und "Berg des Heiligtums"?
"Zelt Jahwes" ist eine archaisierende Metapher für den Jerusalemer Tempel, und "Berg des Heiligtums" ist eine Bezeichnung für den Zionsberg, der für Israel der heilige Berg ist.
Details
- Titel
- Wer darf IHM nahen? - Eine exegetische Arbeit zu Psalm 15
- Veranstaltung
- Alttestamentliche Exegese
- Note
- 1,5
- Autor
- Marco Schlenker (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 1997
- Seiten
- 20
- Katalognummer
- V124401
- ISBN (eBook)
- 9783640292783
- ISBN (Buch)
- 9783640292929
- Dateigröße
- 517 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Eine Arbeit Psalm Alttestamentliche Exegese
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 0,99
- Preis (Book)
- US$ 18,99
- Arbeit zitieren
- Marco Schlenker (Autor:in), 1997, Wer darf IHM nahen? - Eine exegetische Arbeit zu Psalm 15, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/124401
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-