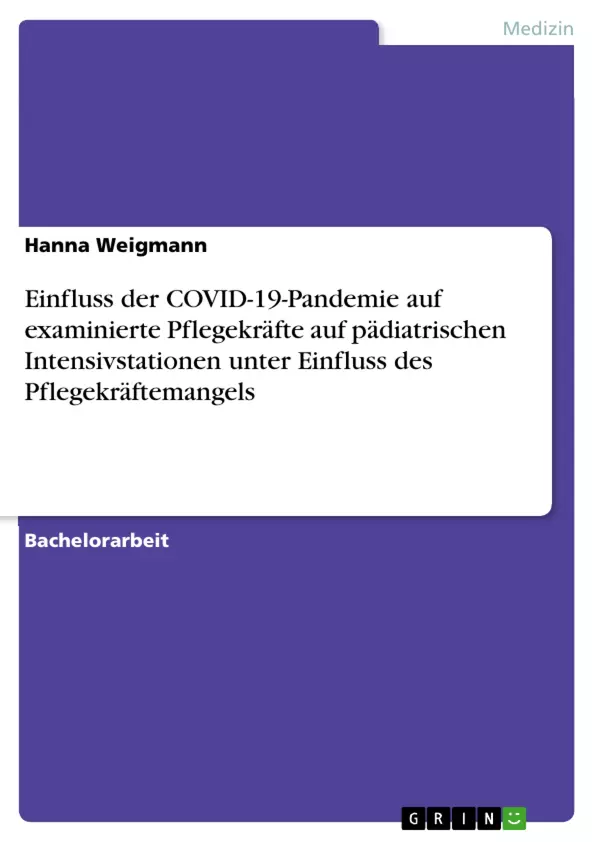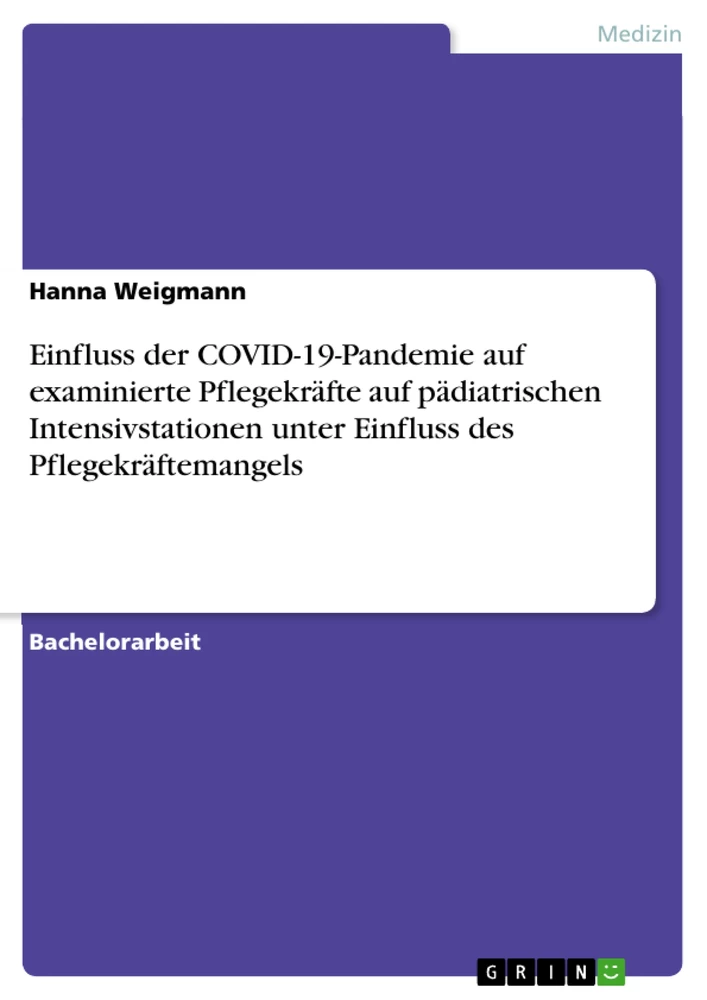
Einfluss der COVID-19-Pandemie auf examinierte Pflegekräfte auf pädiatrischen Intensivstationen unter Einfluss des Pflegekräftemangels
Bachelorarbeit, 2022
70 Seiten, Note: 2,1
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1.0 Einleitung und Problemstellung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 2.0 Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Coronaviren
- 2.2 Der Beruf der examinierten Pflegefachkraft
- 2.2.1 Stationäre Patientenversorgung
- 2.2.2 Universitätsklinikum Köln
- 2.2.3 Frühgeburtlichkeit
- 2.2.4 Perinatalzentrum
- 2.2.5 Frühgeborenenstation
- 2.2.6 Auswirkungen auf die stationäre Patientenversorgung
- 2.3 Belastung und Beanspruchung
- 2.3.1 Hauptbelastungsfaktoren in der Pflege
- 2.3.2 Pflegekräftemangel
- 2.4 Theorien und Konzepte
- 2.4.1 Bedürfnispyramide nach Maslow
- 2.4.2 Belastungs-Beanspruchungs-Modell
- 3.0 Methodik
- 3.1 Befragung
- 3.2 Stichprobe
- 4.0 Ergebnisse
- 5.0 Diskussion und Ausblick
- 6.0 Fazit
- Analyse der Belastungssituation von examinierten Pflegekräften auf pädiatrischen Intensivstationen im Kontext der COVID-19-Pandemie.
- Bewertung des Einflusses des Pflegekräftemangels auf die Belastungssituation der Pflegekräfte.
- Untersuchung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Arbeitsalltag und die Freizeit der Pflegekräfte.
- Bewertung der psychischen Belastungssymptome, die durch die Pandemie und den Pflegekräftemangel entstehen.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Forschungsarbeit untersucht den Einfluss der COVID-19-Pandemie auf examinierte Pflegekräfte in der stationären Patientenversorgung auf pädiatrischen Intensivstationen unter Berücksichtigung des Pflegekräftemangels. Im Fokus stehen die Auswirkungen der Pandemie auf den Arbeitsalltag und die Freizeit der Pflegekräfte sowie die Wahrnehmung von Stress und Belastung.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Problemstellung ein und erläutert die Relevanz der Forschung. Der theoretische Hintergrund liefert wichtige Informationen über die COVID-19-Pandemie, den Beruf der Pflegefachkraft, die stationäre Patientenversorgung, die Frühgeburtlichkeit und das Perinatalzentrum, sowie Belastungen und Beanspruchungen im Pflegeberuf.
Kapitel 3 erläutert die Methodik der Forschung, inklusive der durchgeführten Online-Umfrage und der Stichprobenauswahl. Die Ergebnisse der Studie werden in Kapitel 4 präsentiert und diskutiert. Die Diskussion und der Ausblick in Kapitel 5 betrachten die Ergebnisse der Studie im Kontext der bisherigen Forschung und geben Empfehlungen für zukünftige Forschung und Praxis. Das Fazit fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Studie zusammen.
Schlüsselwörter
COVID-19-Pandemie, Pflegekräfte, stationäre Patientenversorgung, pädiatrische Intensivstation, Frühgeborenenstation, Perinatalzentrum, Pflegekräftemangel, Stress, Belastung, Beanspruchung, Arbeitsmotivation, Arbeitsalltag, Freizeit.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat die COVID-19-Pandemie die Belastung von Pflegekräften verändert?
Die Pandemie führte zu einer massiven Zunahme der psychischen und physischen Belastung, insbesondere durch veränderte Arbeitsabläufe und die Angst vor Infektionen.
Welchen Einfluss hat der Pflegekräftemangel auf pädiatrische Intensivstationen?
Der Mangel verschärft die Belastungssituation, da weniger Personal eine gleichbleibende oder steigende Anzahl an hochkritischen Patienten versorgen muss.
Was ist das Belastungs-Beanspruchungs-Modell?
Dieses theoretische Konzept hilft zu erklären, wie äußere Arbeitsfaktoren (Belastung) individuell unterschiedlich verarbeitet werden und zu Stress (Beanspruchung) führen.
Welche speziellen Herausforderungen gibt es in der Frühgeborenenstation?
Die Arbeit beschreibt das Perinatalzentrum und die hochspezialisierte Pflege von Frühgeborenen, die unter Pandemiebedingungen (z.B. Besuchseinschränkungen) besonders schwierig war.
Wie wirkt sich der Stress auf das Privatleben der Pflegekräfte aus?
Die Studie untersucht, wie die Belastungen aus dem Klinikalltag in die Freizeit getragen werden und dort die Erholung sowie die allgemeine Lebensqualität beeinträchtigen.
Details
- Titel
- Einfluss der COVID-19-Pandemie auf examinierte Pflegekräfte auf pädiatrischen Intensivstationen unter Einfluss des Pflegekräftemangels
- Hochschule
- FOM Essen, Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Hochschulleitung Essen früher Fachhochschule
- Note
- 2,1
- Autor
- Hanna Weigmann (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2022
- Seiten
- 70
- Katalognummer
- V1245662
- ISBN (Buch)
- 9783346679512
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- einfluss covid-19 pandemie pflegekräfte intensivstationen pflegekräftemangels
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 31,99
- Preis (Book)
- US$ 45,99
- Arbeit zitieren
- Hanna Weigmann (Autor:in), 2022, Einfluss der COVID-19-Pandemie auf examinierte Pflegekräfte auf pädiatrischen Intensivstationen unter Einfluss des Pflegekräftemangels, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1245662
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-