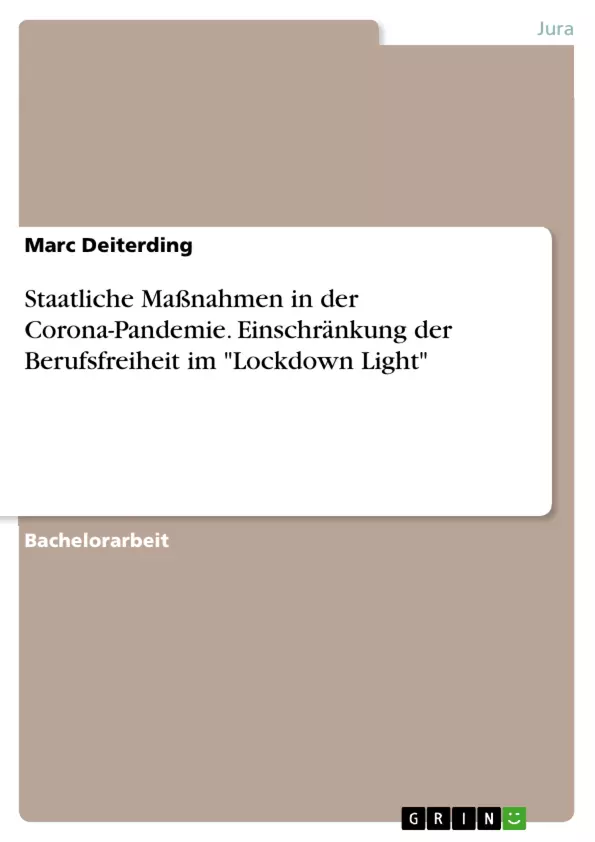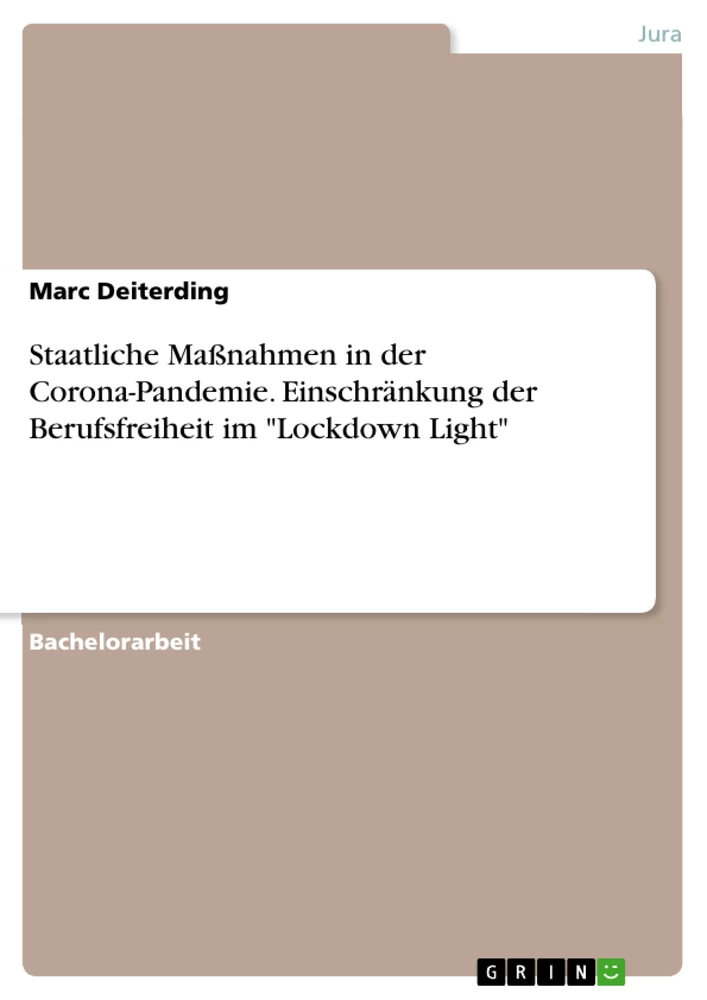
Staatliche Maßnahmen in der Corona-Pandemie. Einschränkung der Berufsfreiheit im "Lockdown Light"
Bachelorarbeit, 2021
73 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Grundrechte im Grundgesetz der BRD
- 2.1 Die Begriffe der Menschenrechte, der Grundrechte und der Bürgerrechte
- 2.2 Arten von Grundrechten
- 2.3 Funktionen der Grundrechte
- 2.3.1 Die subjektiv-rechtliche Dimension
- 2.3.2 Die objektiv-rechtliche Dimension
- 2.4 Beschränkbarkeit von Grundrechten
- 2.4.1 Schutzbereich der Grundrechte
- 2.4.2 Eingriff
- 2.4.3 Schranken
- 3. Das Grundrecht der Berufsfreiheit in Art. 12 GG
- 3.1 Geschichte der Berufsfreiheit
- 3.2 Die Berufsfreiheit im deutschen Grundgesetz
- 4. Systematik der Grundrechtsprüfung der Berufsfreiheit
- 4.1 Schutzbereich der Berufsfreiheit
- 4.1.1 Persönlicher Schutzbereich der Berufsfreiheit
- 4.1.2 Sachlicher Schutzbereich der Berufsfreiheit
- 4.2 Eingriff
- 4.3 Verfassungsrechtliche Rechtfertigung
- 4.3.1 Schranken
- 4.3.2 Schranken-Schranken
- 4.3.2.1 Formelle Verfassungsmäßigkeit
- 4.3.2.2 Materielle Verfassungsmäßigkeit
- 4.1 Schutzbereich der Berufsfreiheit
- 5. Die Corona-Pandemie
- 5.1 Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2
- 5.1.1 Ausbruch der Pandemie weltweit und in Deutschland
- 5.1.2 Virologische Charakteristika von SARS-CoV-2
- 5.1.3 Eindämmungsmöglichkeiten aus epidemiologischer Sicht
- 5.2 Krisenmanagement des Staates zur Eindämmung der Corona-Pandemie in der BRD
- 5.2.1 Erste Maßnahmen im Frühjahr 2020 und deren legislative Grundlagen
- 5.2.2 Anpassungen im Verlauf des Jahres und Lockdown Light
- 5.2.3 Bundeseinheitliche Maßnahmen ab März 2021
- 5.3 Rechtmäßigkeit der staatlichen Coronamaßnahmen
- 5.1 Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2
- 6. Praxisbeispiel: Schließung des Theaters
- 6.1 Beschreibung Praxisbeispiel
- 6.2 Fallprüfung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Verhältnismäßigkeit staatlicher Maßnahmen in der Corona-Pandemie, insbesondere mit der Einschränkung der Berufsfreiheit im „Lockdown Light". Der Fokus liegt dabei auf der Analyse und Bewertung von rechtlichen und epidemiologischen Aspekten im Kontext der Pandemiebekämpfung.
- Grundrechte und deren Beschränkungen im Grundgesetz der BRD
- Das Grundrecht der Berufsfreiheit in Art. 12 GG
- Systematik der Grundrechtsprüfung der Berufsfreiheit
- Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf die deutsche Gesellschaft
- Rechtmäßigkeit staatlicher Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung Dieses Kapitel führt in die Thematik der Verhältnismäßigkeit staatlicher Maßnahmen in der Corona-Pandemie ein und skizziert die Relevanz der Berufsfreiheit im Kontext des „Lockdown Light".
- Kapitel 2: Die Grundrechte im Grundgesetz der BRD Dieses Kapitel beleuchtet die grundlegenden Begriffe der Menschenrechte, Grundrechte und Bürgerrechte, analysiert verschiedene Arten von Grundrechten sowie deren Funktionen. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei auf die Beschränkbarkeit von Grundrechten und deren Schutzbereich gelegt.
- Kapitel 3: Das Grundrecht der Berufsfreiheit in Art. 12 GG Dieses Kapitel befasst sich mit der historischen Entwicklung der Berufsfreiheit und deren Bedeutung im deutschen Grundgesetz.
- Kapitel 4: Systematik der Grundrechtsprüfung der Berufsfreiheit Dieses Kapitel erklärt die Systematik der Grundrechtsprüfung der Berufsfreiheit anhand von Schutzbereich, Eingriff, verfassungsrechtlicher Rechtfertigung und Schranken-Schranken.
- Kapitel 5: Die Corona-Pandemie Dieses Kapitel gibt einen Überblick über das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2, seinen Ausbruch weltweit und in Deutschland. Es werden die virologischen Eigenschaften des Virus und die epidemiologischen Eindämmungsmöglichkeiten diskutiert. Außerdem wird das staatliche Krisenmanagement zur Eindämmung der Corona-Pandemie in der BRD beleuchtet, einschließlich der ersten Maßnahmen im Frühjahr 2020, der Anpassungen im Verlauf des Jahres und des "Lockdown Light", sowie der bundeseinheitlichen Maßnahmen ab März 2021. Schließlich werden die rechtlichen Aspekte der staatlichen Corona-Maßnahmen in der BRD thematisiert.
- Kapitel 6: Praxisbeispiel: Schließung des Theaters Dieses Kapitel präsentiert ein konkretes Praxisbeispiel: die Schließung eines Theaters im Rahmen des „Lockdown Light". Es beinhaltet eine detaillierte Beschreibung des Praxisbeispiels und eine Fallprüfung unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen und der im vorherigen Kapitel diskutierten Aspekte.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Begriffen wie Grundrechte, Berufsfreiheit, Verhältnismäßigkeit, Corona-Pandemie, Lockdown Light, SARS-CoV-2, COVID-19, staatliche Maßnahmen, Rechtmäßigkeit und epidemiologische Eindämmung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Gegenstand der Grundrechtsprüfung in dieser Arbeit?
Die Arbeit prüft, ob die staatlichen Maßnahmen während des "Lockdown Light" mit dem Grundrecht der Berufsfreiheit nach Art. 12 Abs. 1 GG vereinbar waren.
Welches Praxisbeispiel wird für die Fallprüfung herangezogen?
Als Beispiel dient die Schließung eines kleinen Münchner Theaters im November 2020, das trotz eines funktionierenden Hygienekonzepts schließen musste, während der Einzelhandel geöffnet blieb.
Was versteht man unter der "subjektiv-rechtlichen Dimension" von Grundrechten?
Sie bezeichnet das Recht des Einzelnen, sich gegenüber dem Staat auf seine Grundrechte zu berufen und deren Einhaltung, notfalls gerichtlich, einzufordern.
Wie wird die Verhältnismäßigkeit eines Grundrechtseingriffs geprüft?
Ein Eingriff muss einen legitimen Zweck verfolgen und als Maßnahme geeignet, erforderlich und angemessen (Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne) sein.
Gegen welches Grundrecht könnte die Ungleichbehandlung von Branchen verstoßen?
Die Arbeit diskutiert einen möglichen Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz nach Art. 3 Abs. 1 GG, da bestimmte Branchen schließen mussten, während andere offen bleiben durften.
Details
- Titel
- Staatliche Maßnahmen in der Corona-Pandemie. Einschränkung der Berufsfreiheit im "Lockdown Light"
- Hochschule
- Hochschule für angewandtes Management GmbH
- Note
- 1,0
- Autor
- Marc Deiterding (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2021
- Seiten
- 73
- Katalognummer
- V1248117
- ISBN (Buch)
- 9783346693662
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Corona Maßnahmen Lockdown Light Einschränkung Berufsfreiheit Kulturbetriebe Grundrechtsprüfung Corona Pandemie Berufsfreiheit Grundrecht
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 31,99
- Preis (Book)
- US$ 45,99
- Arbeit zitieren
- Marc Deiterding (Autor:in), 2021, Staatliche Maßnahmen in der Corona-Pandemie. Einschränkung der Berufsfreiheit im "Lockdown Light", München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1248117
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-