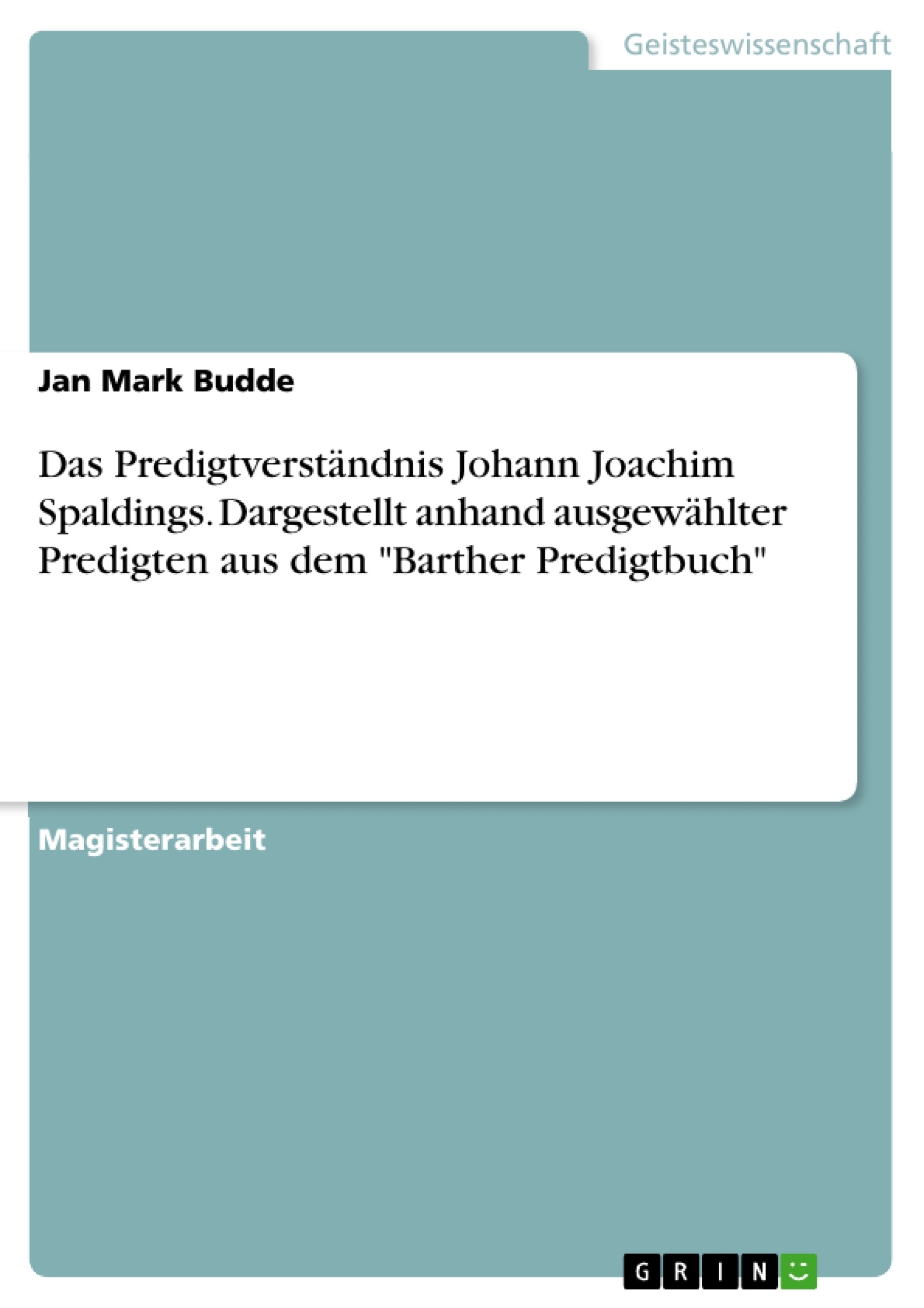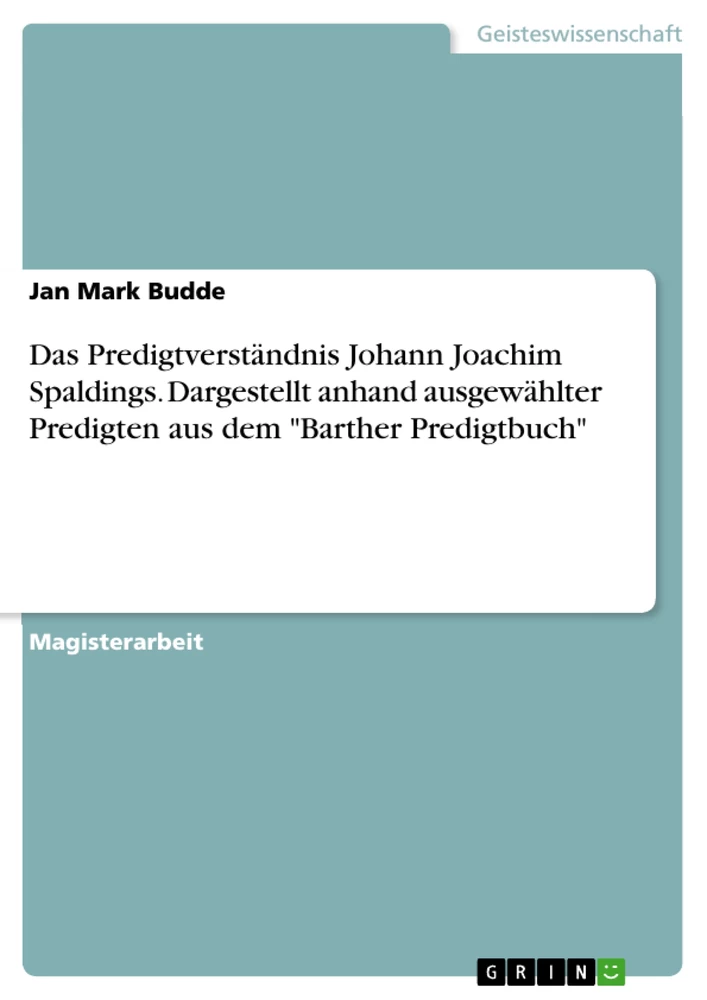
Das Predigtverständnis Johann Joachim Spaldings. Dargestellt anhand ausgewählter Predigten aus dem "Barther Predigtbuch"
Magisterarbeit, 2022
82 Seiten, Note: 2,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Biographische Streiflichter
- Herkunft und Jugend
- Theologischer und beruflicher Werdegang
- Letzte Jahre und Lebensabend
- Theologisches Werk und Vermächtnis
- Genese des Spaldingschen Predigtverständnisses anhand seiner Schrift Ueber die Nutzbarkeit des Predigtamtes und deren Beförderung (³1791)
- Homiletische und theologiegeschichtliche Analyse ausgewählter Predigten aus dem Barther Predigtbuch
- Methodologische Vorentscheidungen und Vorbemerkungen
- Der Trost an Gott bey dem menschlichen Elende (Ps 119,92) [15. Oktober 1771]
- Die Erwartungen, welche wir uns von dem menschlichen Leben hier auf Erden machen müßen (Lk 18,31–43) [13. Februar 1774]
- Der große Wert eines Lebens, welches zum Beẞten anderer angewendet wird (Joh 10,12–16) [17. April 1774]
- Das Werk des Geistes Gottes an dem Menschen (Eph 5,9) [3. Mai 1774]
- Wie die Hoffnung des zukünftigen Lebens das gegenwärtige erleichtert (Mk 16,14-20) [15. Mai 1774]
- Die Rezeption des Spaldingschen Pfarrideals und Predigtverständnisses in Literatur und Theologie
- Resümee: Spaldings Predigtverständnis - ein Exempel für das protestantische Predigtverständnis in der Aufklärung?
- Ausblick für die weitere Spalding-Forschung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Predigtverständnis von Johann Joachim Spalding anhand ausgewählter Predigten aus seinem „Barther Predigtbuch“ und seiner Schrift „Ueber die Nutzbarkeit des Predigtamtes“. Ziel ist es, Spaldings homiletische Konzeption zu rekonstruieren und ihren Platz innerhalb der Aufklärungstheologie zu bestimmen.
- Spaldings biographischer Kontext und sein theologisches Werk
- Analyse der Genese seines Predigtverständnisses
- Homiletische und theologiegeschichtliche Interpretation ausgewählter Predigten
- Rezeption von Spaldings Pfarrideal und Predigtverständnis
- Einordnung von Spaldings Predigtverständnis in die protestantische Aufklärungstheologie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt Johann Joachim Spalding als bedeutende Figur der Aufklärungstheologie vor. Sie betont den Mangel an Forschung zu Spaldings Predigtarbeit und formuliert das Ziel der Arbeit: die Rekonstruktion seines Predigtverständnisses anhand ausgewählter Predigten und seiner Schrift „Ueber die Nutzbarkeit des Predigtamtes“. Die Arbeit versteht sich als Beitrag zur Aufhellung des evangelischen Predigtverständnisses in der Aufklärung und betont den interdisziplinären Ansatz, der Kirchengeschichte und Praktische Theologie verbindet.
Biographische Streiflichter: Dieses Kapitel skizziert Spaldings Leben, von seiner Herkunft und Jugend über seinen theologischen und beruflichen Werdegang bis zu seinen letzten Lebensjahren und seinem theologischen Vermächtnis. Es beleuchtet die wichtigsten Stationen seines Lebens, die seine theologische Entwicklung und sein Predigtverständnis beeinflusst haben. Der Fokus liegt auf den biographischen Aspekten, die für das Verständnis seiner homiletischen Arbeit relevant sind.
Genese des Spaldingschen Predigtverständnisses anhand seiner Schrift Ueber die Nutzbarkeit des Predigtamtes und deren Beförderung (³1791): Dieses Kapitel analysiert Spaldings Schrift „Ueber die Nutzbarkeit des Predigtamtes“, um die theoretischen Grundlagen seines Predigtverständnisses zu erschließen. Es untersucht seine Argumentationslinien, seine zentralen Begriffe und seine didaktischen Ansätze. Die Analyse dieser Schrift bietet den theoretischen Rahmen für die anschließende Interpretation der ausgewählten Predigten.
Homiletische und theologiegeschichtliche Analyse ausgewählter Predigten aus dem Barther Predigtbuch: Dieses Kapitel präsentiert eine detaillierte homiletische und theologiegeschichtliche Analyse von ausgewählten Predigten aus dem „Barther Predigtbuch“. Es werden die jeweiligen Predigttexte im Kontext von Spaldings Gesamtwerk und der Aufklärungstheologie interpretiert. Der Fokus liegt auf der Erhellung der rhetorischen Strategien, der theologischen Aussagen und der pastoralen Intentionen Spaldings.
Die Rezeption des Spaldingschen Pfarrideals und Predigtverständnisses in Literatur und Theologie: Dieses Kapitel untersucht, wie Spaldings Pfarrideal und Predigtverständnis in der Literatur und Theologie rezipiert wurden. Es beleuchtet den Einfluss seines Denkens auf spätere Generationen von Theologen und Predigern. Die Analyse der Rezeption zeigt die nachhaltige Wirkung von Spaldings Werk auf die Entwicklung der evangelischen Theologie und Homiletik.
Schlüsselwörter
Johann Joachim Spalding, Predigtverständnis, Aufklärungstheologie, Neologie, Homiletik, Barther Predigtbuch, Praktische Theologie, Kirchengeschichte, Pastoraltheologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu: Johann Joachim Spaldings Predigtverständnis
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Predigtverständnis von Johann Joachim Spalding, einem bedeutenden Theologen der Aufklärung. Sie rekonstruiert seine homiletische Konzeption anhand ausgewählter Predigten aus seinem „Barther Predigtbuch“ und seiner Schrift „Ueber die Nutzbarkeit des Predigtamtes“ und bestimmt ihren Platz innerhalb der Aufklärungstheologie.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf zwei Hauptquellen: dem „Barther Predigtbuch“ Spaldings, aus dem ausgewählte Predigten analysiert werden, und seiner Schrift „Ueber die Nutzbarkeit des Predigtamtes und deren Beförderung (1791)“, welche die theoretischen Grundlagen seines Predigtverständnisses liefert. Zusätzlich wird die Rezeption seines Werks in Literatur und Theologie untersucht.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Spaldings homiletische Konzeption zu rekonstruieren und ihren Platz in der Aufklärungstheologie zu bestimmen. Sie will einen Beitrag zur Aufhellung des evangelischen Predigtverständnisses in der Aufklärung leisten und verbindet dabei Kirchengeschichte und Praktische Theologie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung, Biographische Streiflichter, Genese des Spaldingschen Predigtverständnisses (basierend auf „Ueber die Nutzbarkeit des Predigtamtes“), Homiletische und theologiegeschichtliche Analyse ausgewählter Predigten, Rezeption von Spaldings Pfarrideal und Predigtverständnis, Resümee und Ausblick.
Wie wird Spaldings Predigtverständnis analysiert?
Spaldings Predigtverständnis wird anhand einer biographischen Skizze, einer Analyse seiner Schrift „Ueber die Nutzbarkeit des Predigtamtes“ und einer detaillierten homiletischen und theologiegeschichtlichen Interpretation ausgewählter Predigten aus dem „Barther Predigtbuch“ untersucht. Die Arbeit beleuchtet rhetorische Strategien, theologische Aussagen und pastorale Intentionen.
Welche Bedeutung hat die Rezeption von Spaldings Werk?
Ein eigenes Kapitel widmet sich der Rezeption von Spaldings Pfarrideal und Predigtverständnis in Literatur und Theologie. Dies zeigt die nachhaltige Wirkung seines Denkens auf spätere Generationen von Theologen und Predigern und seine Bedeutung für die Entwicklung der evangelischen Theologie und Homiletik.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Johann Joachim Spalding, Predigtverständnis, Aufklärungstheologie, Neologie, Homiletik, Barther Predigtbuch, Praktische Theologie, Kirchengeschichte, Pastoraltheologie.
Welche Fragestellung steht im Mittelpunkt des Resümees?
Das Resümee untersucht, ob Spaldings Predigtverständnis ein Exempel für das protestantische Predigtverständnis in der Aufklärung darstellt.
Was ist der Ausblick der Arbeit?
Der Ausblick gibt Anregungen für die weitere Spalding-Forschung.
Welche methodologischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit verwendet einen interdisziplinären Ansatz, der Kirchengeschichte und Praktische Theologie verbindet. Die Analyse der Predigten umfasst homiletische und theologiegeschichtliche Aspekte.
Details
- Titel
- Das Predigtverständnis Johann Joachim Spaldings. Dargestellt anhand ausgewählter Predigten aus dem "Barther Predigtbuch"
- Hochschule
- Universität Münster (Evangelisch-Theologische Fakultät)
- Note
- 2,3
- Autor
- Jan Mark Budde (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2022
- Seiten
- 82
- Katalognummer
- V1250206
- ISBN (Buch)
- 9783346686558
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- "Gebessert und zum Himmel tüchtig gemacht"
- Schlagworte
- Kirchengeschichte Neologie Johann Joachim Spalding Aufklärungstheologie Homiletik Evangelische Theologie Predigtlehre
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Jan Mark Budde (Autor:in), 2022, Das Predigtverständnis Johann Joachim Spaldings. Dargestellt anhand ausgewählter Predigten aus dem "Barther Predigtbuch", München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1250206
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-