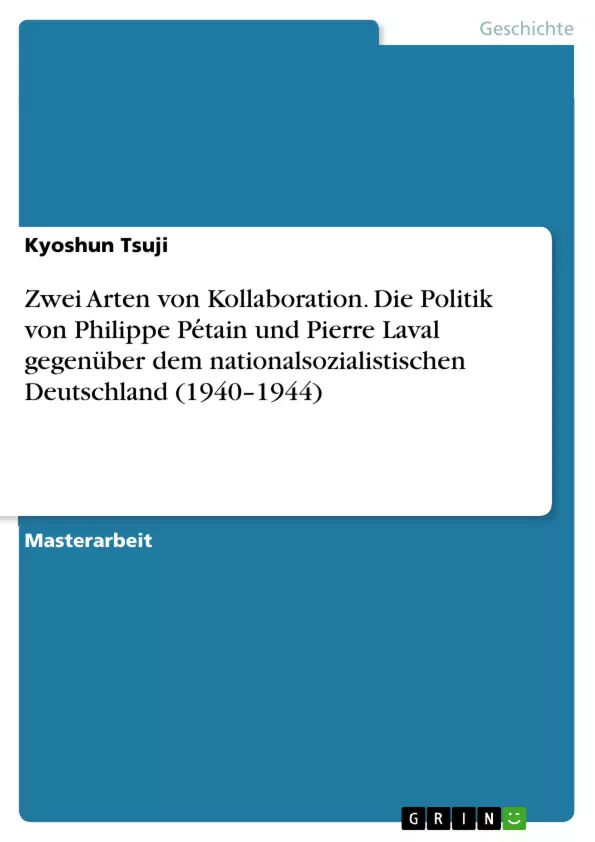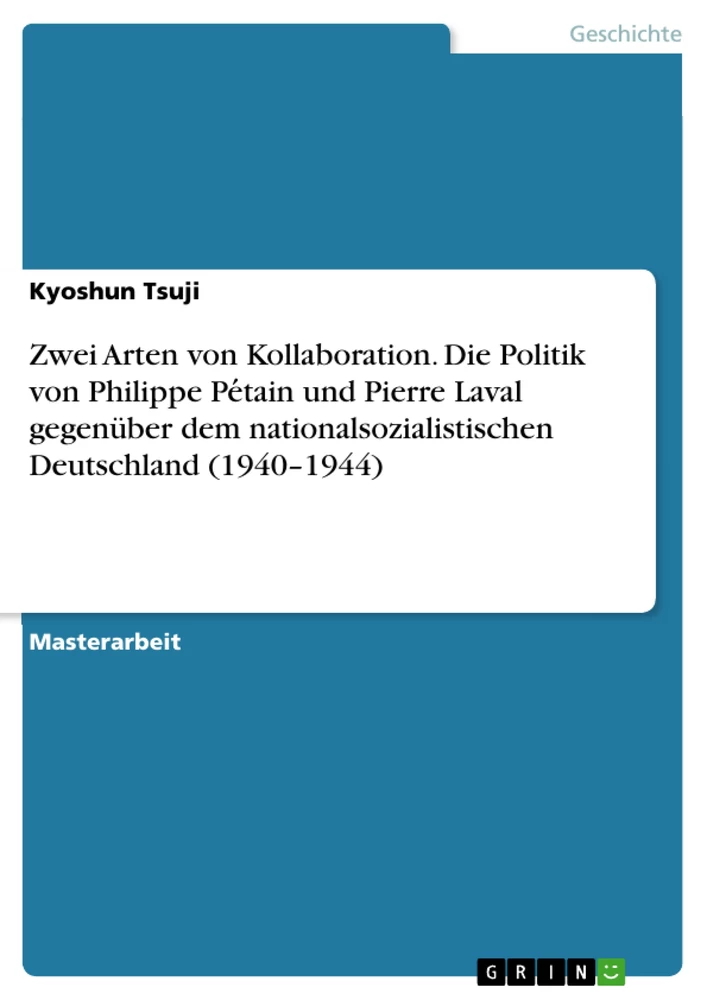
Zwei Arten von Kollaboration. Die Politik von Philippe Pétain und Pierre Laval gegenüber dem nationalsozialistischen Deutschland (1940–1944)
Masterarbeit, 2022
84 Seiten, Note: 10
Geschichte Deutschlands - Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Danksagung
- 1. Einleitung
- 2. Der Westfeldzug
- 3. Waffenstillstand in Compiègne 1940
- 3.1. Persönlichkeit zweier Kollaborateure
- 3.2. Die Verwaltungen in Paris und Wiesbaden
- 3.3. Demarkationslinie
- 3.4. Kriegsgefangene
- 3.5. Besatzungskosten
- 4. Die Ziele Pétains und Lavals
- 5. Treffen von Montoire
- 5.1. Das Schicksal Frankreichs
- 5.2. Doppelspiel
- 6. Misstrauensperiode
- 6.1. Die Entlassung Lavals
- 6.2. Militärische Kollaboration von Pétain
- 6.3. Les protocoles de Paris
- 7. Ultrakollaboration
- 7.1. Die Rückkehr Lavals
- 7.2. Die „Ultrakollaboration“
- 7.3. Relève
- 7.4. Operation „Torch“
- 7.5. S.T.O
- 8. Die polizeiliche Kollaboration Pétains und Lavals zur Judenfrage
- 9. Wirtschaftliche Situation
- 10. Das Ende
- 11. Fazit
- 11.1. Zwei Arten von Kollaboration: Pétain und Laval
- 11.2. Schluss
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Kollaborationspolitik von Philippe Pétain und Pierre Laval gegenüber dem nationalsozialistischen Deutschland zwischen 1940 und 1944. Ziel ist es, die unterschiedlichen Strategien und Motivationen beider Akteure zu analysieren und die verschiedenen Formen der Kollaboration zu differenzieren. Die Arbeit beleuchtet den Einfluss der jeweiligen Persönlichkeiten, die Entwicklung der Zusammenarbeit und deren Auswirkungen auf die französische Gesellschaft.
- Die unterschiedlichen Formen der Kollaboration zwischen Frankreich und dem nationalsozialistischen Deutschland.
- Die Persönlichkeiten und Motivationen von Pétain und Laval.
- Die Entwicklung der Kollaborationspolitik im Zeitverlauf.
- Die Auswirkungen der Kollaboration auf die französische Gesellschaft.
- Die Rolle der Kollaboration im Holocaust.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den anhaltenden Einfluss des Vichy-Regimes auf das französische Geschichtsbewusstsein und die damit verbundenen Debatten. Sie führt in die Thematik der Kollaboration ein und skizziert die historiografischen Entwicklungen in der Forschung zu diesem Thema, von der anfänglichen Betonung nationaler Einheit bis hin zur differenzierten Betrachtung der verschiedenen Formen und Akteure der Kollaboration. Der Fokus liegt auf der Komplexität des Themas und der Notwendigkeit einer differenzierten Analyse der Politik Pétains und Lavals.
3. Waffenstillstand in Compiègne 1940: Dieses Kapitel analysiert den Waffenstillstand von Compiègne und dessen unmittelbare Folgen. Es beleuchtet die Persönlichkeiten Pétains und Lavals, die Organisation der französischen Verwaltung unter deutscher Besatzung, die Demarkationslinie, die Behandlung französischer Kriegsgefangener und die Frage der Besatzungskosten. Es wird gezeigt, wie die unterschiedlichen Strategien der beiden Kollaborateure sich bereits in dieser frühen Phase manifestierten.
4. Die Ziele Pétains und Lavals: Dieses Kapitel untersucht die unterschiedlichen Ziele und Motivationen von Pétain und Laval in ihrer Kollaborationspolitik. Während Pétain primär auf die Rettung Frankreichs und den Erhalt eines nationalen Kerns abzielte, war Laval stärker auf pragmatische, kurzfristige Vorteile und wirtschaftliche Aspekte der Zusammenarbeit mit den Nationalsozialisten ausgerichtet. Die Analyse ihrer jeweiligen Handlungsmotive und -strategien ist zentral für das Verständnis der unterschiedlichen Formen der Kollaboration.
5. Treffen von Montoire: Das Kapitel befasst sich mit dem Treffen von Montoire zwischen Pétain und Hitler und analysiert dessen Bedeutung für die weitere Entwicklung der Kollaborationspolitik. Es wird beleuchtet, wie dieses Treffen die Position und das Selbstverständnis Pétains prägte und wie es die unterschiedlichen Strategien und Ziele von Pétain und Laval zum Vorschein brachte, einschließlich des komplexen "Doppelspiels".
6. Misstrauensperiode: Dieses Kapitel beschreibt die Phase des wachsenden Misstrauens zwischen Pétain und Laval und den damit verbundenen Machtkämpfen. Die Entlassung Lavals, die militärische Kollaboration unter Pétain und die Rolle der "protocoles de Paris" werden untersucht. Es analysiert die verschiedenen Faktoren, die zu einer Vertiefung der Krise führten und wie dies die Entwicklung der Kollaborationspolitik beeinflusste.
7. Ultrakollaboration: Das Kapitel fokussiert auf die Phase der "Ultrakollaboration", gekennzeichnet durch die Rückkehr Lavals und eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem deutschen Regime. Die Rolle der "Relève", die Operation "Torch" und die S.T.O. werden analysiert. Es wird der zunehmende Druck der deutschen Besatzungsmacht und die damit verbundene Eskalation der Kollaboration untersucht.
8. Die polizeiliche Kollaboration Pétains und Lavals zur Judenfrage: Dieses Kapitel befasst sich mit der Rolle der Vichy-Regierung bei der Umsetzung der antisemitischen Politik des NS-Regimes. Es wird detailliert die Zusammenarbeit der französischen Polizei mit den deutschen Besatzungsbehörden bei der Verfolgung und Deportation der Juden untersucht. Die Analyse offenbart das Ausmaß der Beteiligung der französischen Behörden am Holocaust.
Schlüsselwörter
Kollaboration, Vichy-Regime, Philippe Pétain, Pierre Laval, Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg, Frankreich, Besatzung, Holocaust, Antisemitismus, Historiografie, Doppelspiel, Ultrakollaboration, Wirtschaftliche Situation, Politische Strategien, französisches Geschichtsbewusstsein.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Kollaborationspolitik von Pétain und Laval
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Kollaborationspolitik von Philippe Pétain und Pierre Laval gegenüber dem nationalsozialistischen Deutschland zwischen 1940 und 1944. Sie analysiert deren unterschiedliche Strategien und Motivationen und differenziert die verschiedenen Formen der Kollaboration. Die Arbeit beleuchtet den Einfluss der Persönlichkeiten, die Entwicklung der Zusammenarbeit und deren Auswirkungen auf die französische Gesellschaft.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die unterschiedlichen Formen der Kollaboration, die Persönlichkeiten und Motivationen von Pétain und Laval, die Entwicklung der Kollaborationspolitik im Zeitverlauf, die Auswirkungen auf die französische Gesellschaft und die Rolle der Kollaboration im Holocaust.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in elf Kapitel, beginnend mit einer Einleitung und endend mit einem Fazit. Die Kapitel behandeln den Westfeldzug, den Waffenstillstand von Compiègne, die Ziele Pétains und Lavals, das Treffen von Montoire, eine Phase des Misstrauens zwischen den beiden Kollaborateuren, die Ultrakollaboration, die polizeiliche Kollaboration bezüglich der Judenfrage, die wirtschaftliche Situation in Frankreich während der Besatzungszeit und schließlich das Ende der Kollaboration. Jedes Kapitel wird durch eine Zusammenfassung im Preview vorgestellt.
Wie werden die unterschiedlichen Strategien von Pétain und Laval dargestellt?
Die Arbeit betont die Unterschiede in den Strategien und Motivationen von Pétain und Laval. Pétain zielte primär auf den Erhalt eines nationalen Kerns Frankreichs ab, während Laval eher pragmatisch und auf kurzfristige wirtschaftliche Vorteile ausgerichtet war. Diese Unterschiede werden anhand verschiedener Ereignisse und Entscheidungen im Verlauf der Kollaboration analysiert. Der Begriff des "Doppelspiels" wird in diesem Kontext ebenfalls behandelt.
Welche Rolle spielt die Judenfrage in der Arbeit?
Ein eigenes Kapitel widmet sich der polizeilichen Kollaboration Pétains und Lavals in Bezug auf die Judenfrage. Es wird die Zusammenarbeit der französischen Polizei mit den deutschen Besatzungsbehörden bei der Verfolgung und Deportation der Juden detailliert untersucht, um das Ausmaß der Beteiligung der französischen Behörden am Holocaust aufzuzeigen.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit differenziert zwischen zwei Arten der Kollaboration, der von Pétain und der von Laval, und zieht abschließende Schlussfolgerungen aus der Untersuchung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kollaboration, Vichy-Regime, Philippe Pétain, Pierre Laval, Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg, Frankreich, Besatzung, Holocaust, Antisemitismus, Historiografie, Doppelspiel, Ultrakollaboration, Wirtschaftliche Situation, Politische Strategien, französisches Geschichtsbewusstsein.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum bestimmt und dient der Analyse von Themen im Zusammenhang mit der französischen Kollaborationspolitik während des Zweiten Weltkriegs.
Details
- Titel
- Zwei Arten von Kollaboration. Die Politik von Philippe Pétain und Pierre Laval gegenüber dem nationalsozialistischen Deutschland (1940–1944)
- Hochschule
- Philipps-Universität Marburg
- Note
- 10
- Autor
- Kyoshun Tsuji (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2022
- Seiten
- 84
- Katalognummer
- V1250271
- ISBN (Buch)
- 9783346685766
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- zwei arten kollaboration politik philippe pétain pierre laval deutschland
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Kyoshun Tsuji (Autor:in), 2022, Zwei Arten von Kollaboration. Die Politik von Philippe Pétain und Pierre Laval gegenüber dem nationalsozialistischen Deutschland (1940–1944), München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1250271
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-