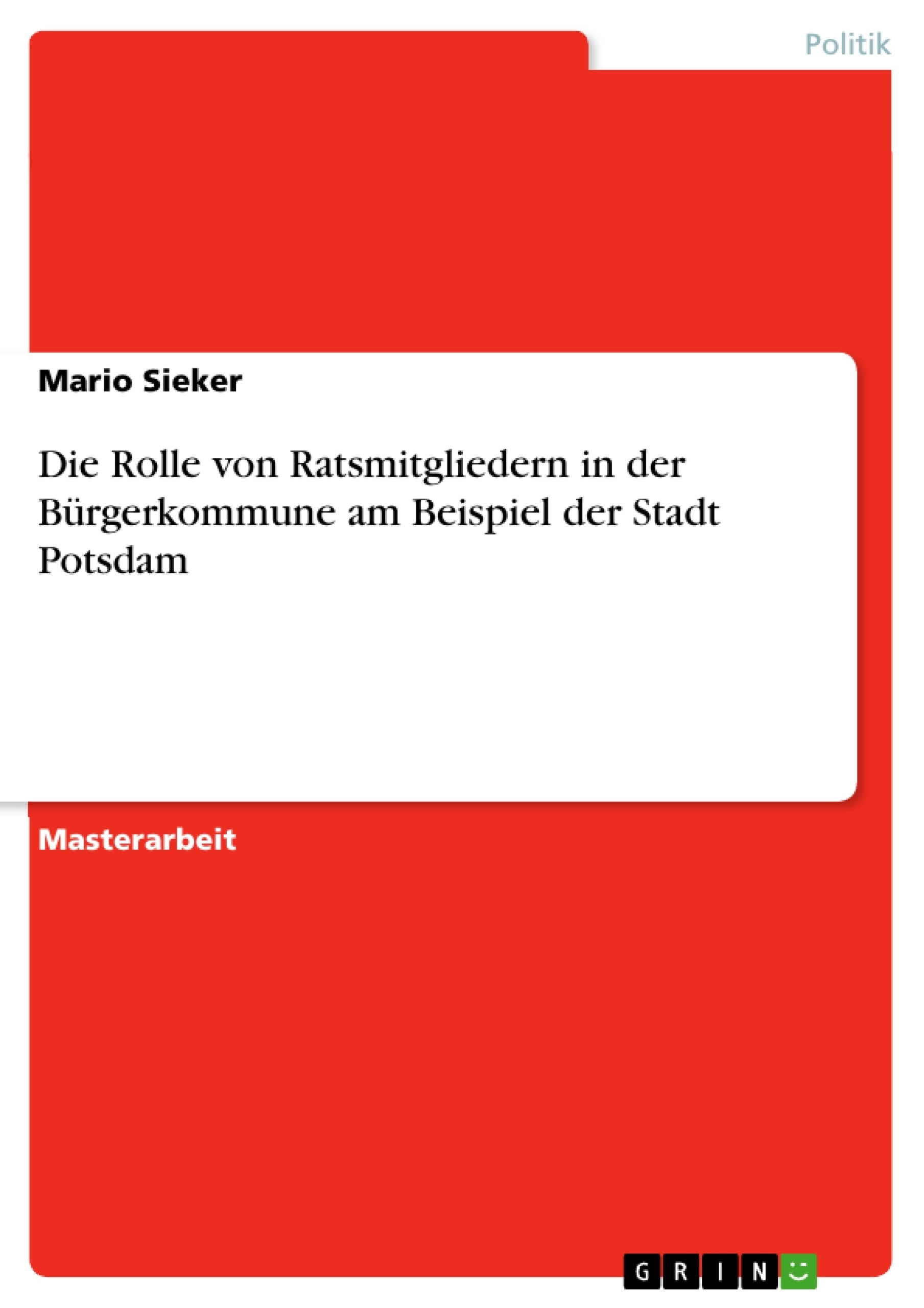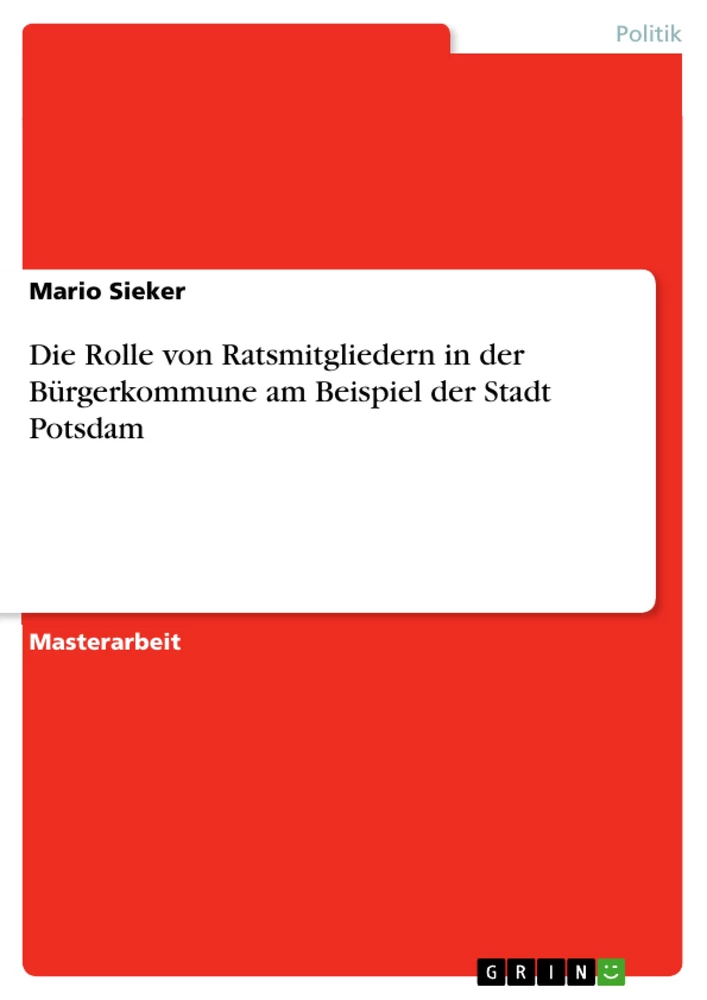
Die Rolle von Ratsmitgliedern in der Bürgerkommune am Beispiel der Stadt Potsdam
Masterarbeit, 2022
74 Seiten, Note: 2,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsstand / Problemaufriss
- Entwicklung der Bürgerbeteiligung in der Bundesrepublik Deutschland
- Bürgerbeteiligung und Ratsvertreter
- Reformmodell Bürgerkommune
- Theoretischer Bezugsrahmen
- Konzeption der Hausarbeit
- Hypothese und Variable
- Fallauswahl
- Methode Fallanalyse und Experteninterview
- Entwicklung des Fragebogens
- Analyse der empirischen Ergebnisse
- Auswertung der Befragungen
- Aufgabe a) Die zentralen Ziele kommunaler Aufgaben festlegen
- Aufgabe b) Die Vertretung der Forderungen und Anliegen der örtlichen Gemeinschaft
- Aufgabe c) Die Kontrolle kommunaler Aktivitäten
- Aufgabe d) Die Interessen von Minderheiten fördern
- Aufgabe e) Die Debatte über lokale Angelegenheiten öffentlich machen, bevor Entscheidungen getroffen werden
- Aufgabe f) Den Bürgern kommunalpolitische Entscheidungen vermitteln
- Aufgabe g) Das Programm meiner Partei/Wählergruppe umsetzen
- Aufgabe h) Die Verwaltung unterstützen
- Aufgabe i) Bei Konflikten in der Gemeinde vermitteln
- Aufgabe i) Die Interessen von Frauen fördern
- Überprüfung der Hypothese
- Überprüfung der Hypothese entlang der Antworten von SV1
- Überprüfung der Hypothese entlang der Antworten von SV2
- Überprüfung der Hypothese entlang der Antworten von SV3
- Überprüfung der Hypothese entlang der Antworten von SV4
- Überprüfung der Hypothese entlang der Antworten von SV5
- Auswertung der Befragungen
- Zusammenfassung und Erklärungsansätze für den Befund
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Rolle von Ratsmitgliedern in der Bürgerkommune am Beispiel der Stadt Potsdam. Sie untersucht, inwieweit die Ratsmitglieder die Bürger in kommunale Entscheidungsprozesse einbeziehen und welche Aufgaben sie in diesem Zusammenhang wahrnehmen. Die Untersuchung konzentriert sich auf die Auswirkungen des Reformmodells Bürgerkommune auf die Arbeitsweise von Ratsmitgliedern und deren Verhältnis zu den Bürgern.
- Entwicklung der Bürgerbeteiligung in Deutschland
- Die Rolle von Ratsmitgliedern in der Bürgerkommune
- Der Einfluss von Bürgerbeteiligung auf kommunale Entscheidungen
- Das Reformmodell Bürgerkommune und seine Auswirkungen auf die lokale Politik
- Die Wahrnehmung von Ratsmitgliedern in der Bürgerkommune
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext der Bürgerbeteiligung und die Relevanz des Themas erläutert. Das zweite Kapitel beleuchtet den Forschungsstand zur Bürgerbeteiligung, wobei die Entwicklung der Bürgerbeteiligung in Deutschland, die Rolle von Ratsvertretern und das Reformmodell Bürgerkommune im Fokus stehen. Im dritten Kapitel wird der theoretische Bezugsrahmen der Arbeit dargestellt. Das vierte Kapitel beschreibt die Konzeption der Hausarbeit, einschließlich der Hypothese, Fallauswahl, Methode und Entwicklung des Fragebogens. Das fünfte Kapitel analysiert die empirischen Ergebnisse, die durch Befragungen und Interviews gewonnen wurden.
Schlüsselwörter
Bürgerkommune, Bürgerbeteiligung, Ratsmitglieder, Kommunalpolitik, Demokratie, Entscheidungsprozesse, Potsdam, Reformmodell, empirische Forschung, Fallanalyse, Experteninterview, Bürgerdialog, lokale Politik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Reformmodells „Bürgerkommune“?
Das Ziel ist eine stärkere Einbeziehung der Bürger in kommunale Entscheidungsprozesse und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Politik, Verwaltung und Bürgerschaft.
Welche Rolle spielen Ratsmitglieder in Potsdam bei der Bürgerbeteiligung?
Die Arbeit untersucht, wie Stadtverordnete ihre Rolle zwischen Parteiprogramm, Verwaltungskontrolle und der Vermittlung von Bürgerinteressen wahrnehmen.
Welche Aufgaben haben Stadtverordnete laut der empirischen Analyse?
Zu den Aufgaben gehören das Festlegen kommunaler Ziele, die Kontrolle der Verwaltung, die Vermittlung von Entscheidungen und die Vertretung von Minderheiteninteressen.
Warum ist die Unterstützung durch Politiker für Bürgerbeteiligung so wichtig?
Untersuchungen zeigen, dass die Akzeptanz und der Erfolg von Beteiligungsverfahren maßgeblich davon abhängen, ob politische Entscheidungsträger diese aktiv unterstützen.
Welche Methoden wurden für die Untersuchung in Potsdam genutzt?
Die Autorin nutzte Fallanalysen und Experteninterviews mit Stadtverordneten, um deren Einstellungen und Rollenverständnis zu erfassen.
Details
- Titel
- Die Rolle von Ratsmitgliedern in der Bürgerkommune am Beispiel der Stadt Potsdam
- Hochschule
- FernUniversität Hagen
- Note
- 2,0
- Autor
- Mario Sieker (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2022
- Seiten
- 74
- Katalognummer
- V1251433
- ISBN (Buch)
- 9783346688842
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Die Stadt Potsdam gilt hinsichtlich der Bürgerbeteiligung in der Literatur als vorbildlich. Daher überrascht es nicht, dass die Abschlussarbeit für die dortigen Entscheidungsträger eine positive Einstellung gegenüber Bürgerbeteiligung feststellt. Jedoch ist die Arbeit theoretisch gut gerahmt und die Verbindung mit der Rollentheorie durchaus innovativ. Zudem wird der Forschungsstand unter Einbeziehung ausländischer Erfahrungen gut beschrieben.
- Schlagworte
- Direkte Demokratie Bürgerbeteiligung Beteiligung Bürgerkommune Rollentheorie
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 31,99
- Preis (Book)
- US$ 45,99
- Arbeit zitieren
- Mario Sieker (Autor:in), 2022, Die Rolle von Ratsmitgliedern in der Bürgerkommune am Beispiel der Stadt Potsdam, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1251433
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-