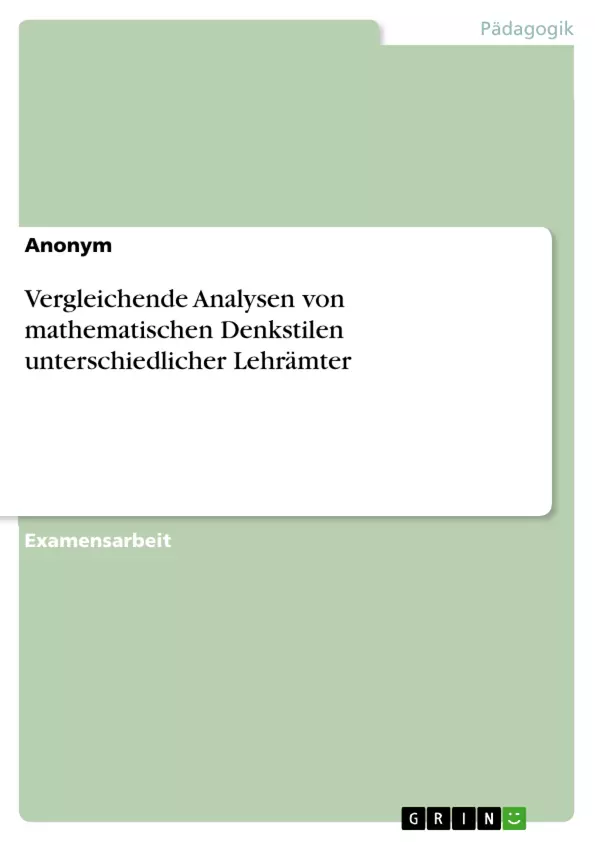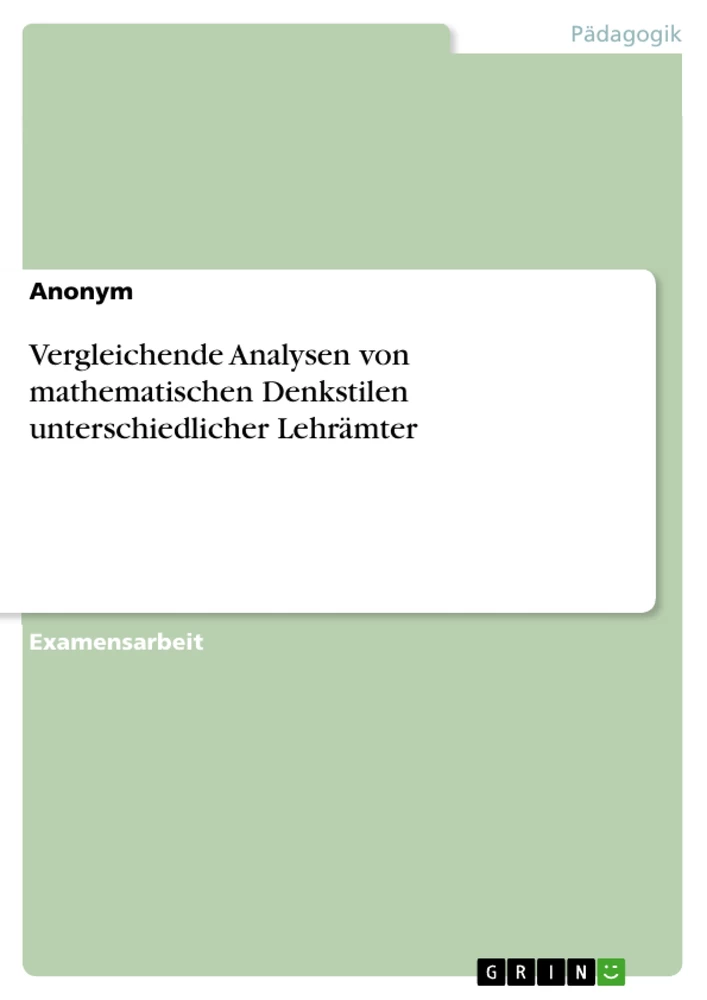
Vergleichende Analysen von mathematischen Denkstilen unterschiedlicher Lehrämter
Examensarbeit, 2015
123 Seiten, Note: 1,33
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Theoretische Grundlage
- Geschichtliche Entwicklung des Denkstilbegriffs
- Denkstile nach Sternberg
- Prinzipien der Denkstile
- Entwicklung und Internalisierung des Denkstils
- Passung zwischen Denkstil und Umwelt
- Kognitive Stildimension nach Riding
- Mathematische Denkstile nach Borromeo Ferri
- Vorstellung des Modells zum mathematischen Denkstil
- Komponenten mathematischer Denkstile
- Interne Vorstellungen und externe Darstellungen
- Ganzheitliche oder zergliedernde Vorgehensweise
- Prinzipien mathematischer Denkstile
- Modell zur Rekonstruktion verschiedener mathematischer Denkstile und deren Ergebnisse
- Zwecke und Inhalte externer Darstellungen
- Die Rolle der mathematischen Sozialisation
- Mathematische Beliefs
- Mathematische Weltbilder
- Lehramtsausbildung im Studiengang Mathematik
- Modulprüfungsordnung für das Lehramt an Grundschulen (L1)
- Modulprüfungsordnung für das Lehramt an Haupt- und Realschulen (L2)
- Fachspezifische Bestimmungen für das Lehramt der Primar- und Sekundarstufe I (LAPS)
- Modulprüfungsordnung für das Lehramt an Gymnasien (L3)
- Fachprüfungsordnung im Zweitfach Mathematik für Berufs- und Wirtschaftspädagogik (L4)
- Übergang von schulischer- zu universitärer math. Ausbildung
- Diskrepanz zwischen Vorstellung und Eignung
- Die Bedeutung der ersten Semester
- Homogenisierung oder Individualisierung
- Mathematische Vor- und Brückenkurse
- Begleitende Tutorien
- Neue Wege
- Math. Kompetenzen verschiedener Lehrämter im Vergleich
- Fachdidaktisches- und fachwissenschaftliches Wissen verschiedener Lehrämter im nationalen Vergleich
- Fachdidaktisches- und fachwissenschaftliches Wissen verschiedener Lehrämter im internationalen Vergleich
Methodologie und Aufbau der Untersuchung
- Messinstrument
- Didaktische Analyse der Problemlöseaufgaben
- Stichprobe
- Statistisches Vorgehen
- Präzisierung der Forschungsfrage
Ergebnisse der empirischen Studie
- Ergebnisse zu den mathematischer Denkstilen
- Ergebnisse zu Beliefs über Mathematik
- Präferenzen speziell in der fachmathematischen Lehramtsausbildung
Fazit
Ausblick
Literaturverzeichnis
Anhang
Häufig gestellte Fragen
Was sind mathematische Denkstile?
Mathematische Denkstile beschreiben die individuelle Art und Weise, wie Personen mathematische Probleme wahrnehmen und lösen, etwa eher ganzheitlich-anschaulich oder zergliedernd-analytisch.
Gibt es Unterschiede im Denkstil zwischen Grundschul- und Gymnasiallehramt?
Die Studie untersucht genau diese Differenzen und analysiert, inwiefern die spezifische Ausbildung und die mathematischen "Beliefs" (Weltbilder) der Studierenden variieren.
Welchen Einfluss hat die Universität auf den Denkstil?
Die universitäre Ausbildung kann zur Homogenisierung von Denkstilen führen, stellt aber besonders in den ersten Semestern eine Herausforderung dar, wenn schulische Vorstellungen auf formale Mathematik treffen.
Was versteht man unter mathematischen "Beliefs"?
Beliefs sind subjektive Überzeugungen oder Weltbilder über die Mathematik, die maßgeblich beeinflussen, wie Mathematik unterrichtet und gelernt wird.
Wie können Brückenkurse den Übergang zur Uni erleichtern?
Brückenkurse und begleitende Tutorien dienen dazu, Diskrepanzen zwischen schulischer Vorbildung und universitären Anforderungen auszugleichen und individuelle Denkstile zu fördern.
Details
- Titel
- Vergleichende Analysen von mathematischen Denkstilen unterschiedlicher Lehrämter
- Hochschule
- Universität Kassel
- Note
- 1,33
- Autor
- Anonym (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2015
- Seiten
- 123
- Katalognummer
- V1252998
- ISBN (Buch)
- 9783346688262
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Denkstil Beliefs Lehramtsausbildung Mathematik Sternberg Borromeo Ferri Ausbildung Lehramt Gymnasium Kompetenzen
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 50,99
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2015, Vergleichende Analysen von mathematischen Denkstilen unterschiedlicher Lehrämter, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1252998
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-