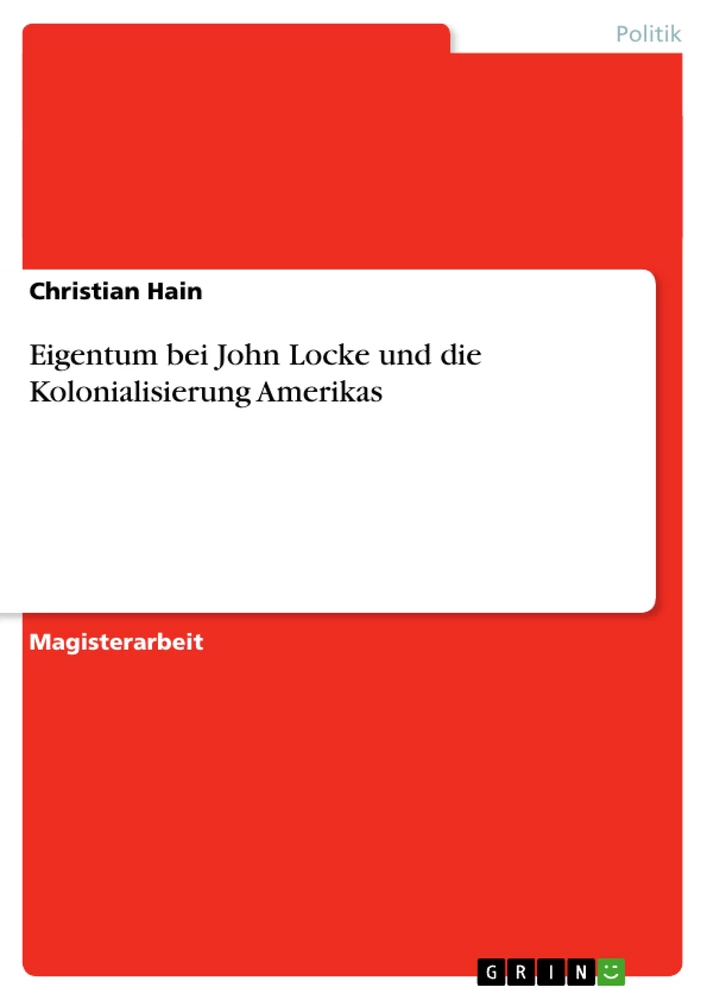
Eigentum bei John Locke und die Kolonialisierung Amerikas
Magisterarbeit, 2003
80 Seiten
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- A) Einleitung
- B) Die Diskussion um die Entstehung von Eigentum in der politischen Theorie und in den amerikanischen Kolonien und Locke's biographische Verbindungen zu Amerika als Implikationen seiner Eigentumstheorie in „Two Treatises of Government“
- 1) Locke's Arbeitstheorie, Eigentum und koloniales Denken
- 2) Die Eigentumstheorie von John Locke gemäß den „Two Treatises of Government“
- 3) Die „Two Treatises of Government“ als Antwort auf Sir Robert Filmer's „Patriarcha“
- a) Unterschiedliche Interpretationen der „Two Treatises“
- b) Eigentum in „Two Treatises of Government“ eine Fortentwicklung der Eigentumsvorstellungen des Grotius
- c) Locke's „Two Treatises“ als Antwort auf Filmer`s Patriarcha
- d) Filmer's Argumentation gegen die Eigentumstheorie des Grotius und Locke's Antwort darauf
- e) Eigentum bei Grotius
- aa) Die Begründung von Eigentum bei Grotius
- bb) Vergleich und Wertung der Eigentumstheorie Locke's zu den Eigentumsvorstellungen des Grotius
- 4) Locke's Eigentumstheorie und Amerika
- 5) Locke's Eigentumsbegriff im Naturzustand in „Two Treatises of Government“ unter biographischen Aspekten und unter dem Aspekt der Eigentumsdiskussionen in Amerika
- 6) Eigentum in einer „zivilisierten Welt von Kommerz und Verbesserung“ unter biographischen Aspekten und unter dem Aspekt der Debatten um Eigentum in Amerika
- 7) Entstehungsgeschichte der „Two Treatises“ im biographischen Kontext
- 8) Von der Restauration zur Revolution in England 1660- 1689/der verfassungsrechtliche Hintergrund der „Two Treatises“ und die Auseinandersetzung um rechtmäßige Begründung von Eigentum in Amerika
- 9) Entstehung der Diskussion um die rechtmäßige Begründung von Eigentum in den amerikanischen Kolonien
- C) Lockes Eigentumsbegriff aus heutiger Sicht- Schlußbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht John Lockes Eigentumstheorie, insbesondere seine Arbeitstheorie im fünften Kapitel der „Two Treatises of Government“, im historischen Kontext ihrer Entstehung und unter Berücksichtigung der Implikationen kolonialen Denkens. Ziel ist es, die klassische Interpretation der „Two Treatises“ um einen Aspekt zu erweitern, der neue Deutungsmöglichkeiten erlaubt und die Diskussionen um Lockes Eigentumstheorie neu einordnet.
- Lockes Arbeitstheorie und ihre Interpretationen
- Die Beziehung zwischen Lockes Eigentumstheorie und der Kolonialisierung Amerikas
- Der Einfluss von Sir Robert Filmer und Hugo Grotius auf Lockes Denken
- Lockes biographische Verbindungen zu Amerika und deren Einfluss auf seine Theorie
- Die politische Situation in England und Amerika im 17. Jahrhundert und deren Auswirkungen auf die Debatte um Eigentum
Zusammenfassung der Kapitel
A) Einleitung: Diese Einleitung beschreibt das Ziel der Arbeit: die Einordnung von Lockes Arbeitstheorie in den historischen Kontext und die Berücksichtigung der Implikationen kolonialen Denkens. Es wird betont, dass die Arbeit über die klassische Sicht hinausgehen und neue Deutungsmöglichkeiten eröffnen soll. Die Bedeutung der biographischen Verbindungen Lockes zu Amerika und die Auseinandersetzung mit der Begründung von Eigentumsansprüchen britischer Siedler werden als zentrale Aspekte hervorgehoben.
B) Die Diskussion um die Entstehung von Eigentum in der politischen Theorie und in den amerikanischen Kolonien und Locke's biographische Verbindungen zu Amerika als Implikationen seiner Eigentumstheorie in „Two Treatises of Government“: Dieses Kapitel befasst sich umfassend mit Lockes Eigentumstheorie im Kontext der politischen Theorie und der Kolonisierung Amerikas. Es analysiert Lockes Arbeitstheorie, seine Auseinandersetzung mit Filmer und Grotius, sowie den Einfluss seiner biographischen Verbindungen zu Amerika auf seine Theorie. Die Kapitel untersuchen verschiedene Interpretationen der "Two Treatises" und beleuchten die Rolle von kolonialem Denken in der Begründung von Eigentumsansprüchen.
C) Lockes Eigentumsbegriff aus heutiger Sicht- Schlußbemerkung: (Diese Zusammenfassung wird aufgrund der Anweisung, keine Schlussfolgerungen oder Abschlusskapitel zusammenzufassen, weggelassen.)
Schlüsselwörter
John Locke, Eigentum, Arbeitstheorie, Two Treatises of Government, Kolonialisierung Amerikas, Sir Robert Filmer, Hugo Grotius, Naturzustand, koloniales Denken, politische Freiheit, England, Amerika, 17. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen zu: John Lockes Eigentumstheorie und die Kolonisierung Amerikas
Was ist der Hauptgegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht John Lockes Eigentumstheorie, insbesondere seine Arbeitstheorie im fünften Kapitel der „Two Treatises of Government“, im historischen Kontext ihrer Entstehung und unter Berücksichtigung der Implikationen kolonialen Denkens. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den biographischen Verbindungen Lockes zu Amerika und deren Einfluss auf seine Theorie.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die klassische Interpretation der „Two Treatises“ zu erweitern und neue Deutungsmöglichkeiten zu eröffnen. Sie ordnet die Diskussionen um Lockes Eigentumstheorie neu ein, indem sie den historischen Kontext und die Implikationen kolonialen Denkens berücksichtigt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Lockes Arbeitstheorie und deren Interpretationen, die Beziehung zwischen Lockes Eigentumstheorie und der Kolonialisierung Amerikas, den Einfluss von Sir Robert Filmer und Hugo Grotius auf Lockes Denken, Lockes biographische Verbindungen zu Amerika und deren Einfluss auf seine Theorie sowie die politische Situation in England und Amerika im 17. Jahrhundert und deren Auswirkungen auf die Debatte um Eigentum.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit besteht aus drei Hauptteilen: Eine Einleitung, ein Kapitel zur Diskussion um die Entstehung von Eigentum in der politischen Theorie und den amerikanischen Kolonien mit Fokus auf Lockes biographischen Verbindungen zu Amerika und Implikationen für seine Eigentumstheorie in den „Two Treatises of Government“, und eine Schlussbemerkung (die in der Zusammenfassung ausgelassen wird). Das zweite Kapitel unterteilt sich in mehrere Unterkapitel, die verschiedene Aspekte von Lockes Eigentumstheorie detailliert untersuchen, einschließlich seiner Auseinandersetzung mit Filmer und Grotius.
Welche Autoren werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt vor allem John Locke, aber auch Sir Robert Filmer und Hugo Grotius, deren Werke und Theorien im Kontext von Lockes Eigentumstheorie analysiert werden.
Welche Rolle spielt die Kolonisierung Amerikas in der Arbeit?
Die Kolonisierung Amerikas spielt eine zentrale Rolle. Die Arbeit untersucht den Einfluss des kolonialen Denkens auf Lockes Eigentumstheorie und die Implikationen seiner biographischen Verbindungen zu Amerika für seine Theorie. Die Begründung von Eigentumsansprüchen britischer Siedler wird als wichtiger Aspekt beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: John Locke, Eigentum, Arbeitstheorie, Two Treatises of Government, Kolonisierung Amerikas, Sir Robert Filmer, Hugo Grotius, Naturzustand, koloniales Denken, politische Freiheit, England, Amerika, 17. Jahrhundert.
Welche Aspekte von Lockes „Two Treatises of Government“ werden besonders betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich auf Lockes Arbeitstheorie im fünften Kapitel der „Two Treatises of Government“ und deren Interpretationen. Sie analysiert Lockes Auseinandersetzung mit Sir Robert Filmer und Hugo Grotius und untersucht die verschiedenen Interpretationen der „Two Treatises“ im Kontext der politischen und kolonialen Geschichte.
Details
- Titel
- Eigentum bei John Locke und die Kolonialisierung Amerikas
- Hochschule
- Ludwig-Maximilians-Universität München (Geschwister Scholl Institut)
- Autor
- M.A. Christian Hain (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2003
- Seiten
- 80
- Katalognummer
- V125572
- ISBN (Buch)
- 9783640307357
- ISBN (eBook)
- 9783640309344
- Dateigröße
- 757 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Der 1970 in München geborene Christian Hain studierte Rechts-, Politik-, Geschichts- und Wirtschaftswissenschaften an Universitäten in Marseille,Passau,München und Frankfurt. Christian Hain arbeitet als Investmentbanker in London und beschäftigt sich nebenberuflich mit ideengeschichtlichen Themen und zeitgeschichtlichen Fragestellungen.
- Schlagworte
- Eigentum John Locke Kolonialisierung Amerikas
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 31,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- M.A. Christian Hain (Autor:in), 2003, Eigentum bei John Locke und die Kolonialisierung Amerikas, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/125572
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









