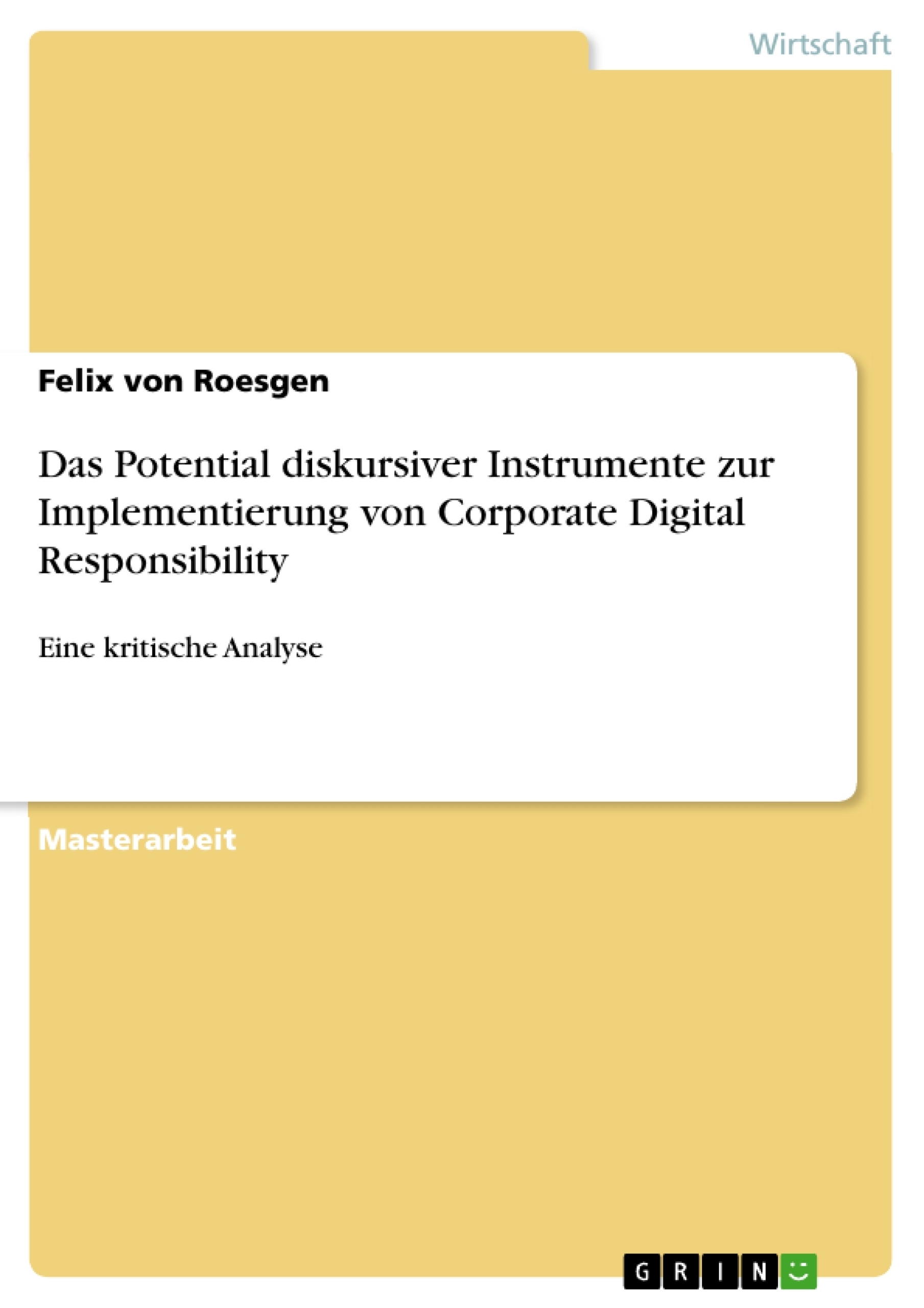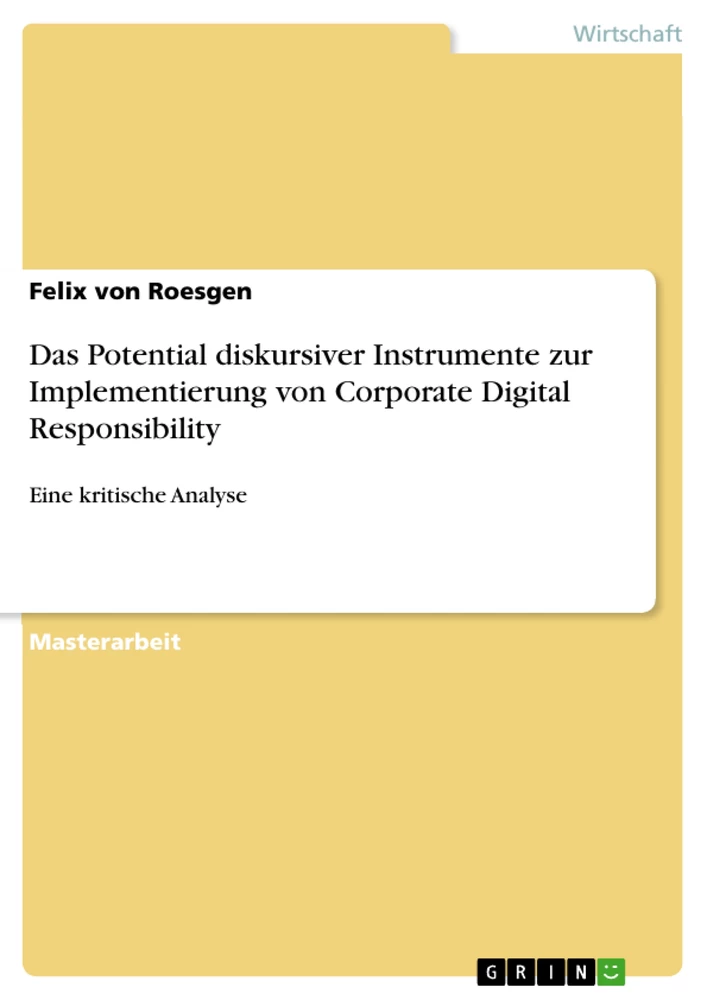
Das Potential diskursiver Instrumente zur Implementierung von Corporate Digital Responsibility
Masterarbeit, 2021
93 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Werte und Normen
- Werte und Normen in der Ethik
- Entstehung von Werten und Normen
- Werte und Normen in der Unternehmensethik
- Diskursethik
- Einführung in die Diskursethik
- Diskursbedingungen
- Die Diskursethik in der Kritik
- Diskursethik im Wandel
- Die Diskursethik im Kontext von Unternehmen
- Zwischenfazit und Ausblick
- Werte und Normen
- Methodik
- Übersicht
- Systematische Literaturrecherche
- Analyse des Instrumentariums
- KI-Ethik
- Einführung
- Grundlagen der Künstlichen Intelligenz
- KI-Ethik als Teilbereich der Corporate Digital Responsibility
- KI-Ethik in der Praxis
- Anlass einer KI-Ethik
- Mehrwert für Unternehmen
- Werte und Normen in der KI-Ethik
- Einführung
- Herausforderung für die Implementierung von CDR
- Dynamik
- Komplexität
- Normativität
- Finanzierbarkeit
- Das Instrumentarium zur Implementierung von KI-Ethik
- Ethik-Training
- Kodizes
- Ethik Boards
- Tools für Entwickler:innen
- Diskussion
- Interpretation der Ergebnisse
- Limitationen und Ausblick
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht das Potential diskursiver Instrumente für die Implementierung von Corporate Digital Responsibility (CDR) im Kontext des wachsenden Einsatzes von Künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmen. Die Arbeit analysiert verschiedene unternehmensinterne Instrumente und bewertet deren Eignung zur Entwicklung von Werten und Normen für einen verantwortungsvollen Umgang mit KI-Systemen. Dabei dient die Diskursethik als theoretisches Fundament.
- Die Rolle der Diskursethik in der Entwicklung von Werten und Normen für KI-Anwendungen
- Die Analyse von unternehmensinternen Instrumenten für die Implementierung von KI-Ethik
- Die Herausforderungen bei der Umsetzung diskursiver Verfahren in Unternehmen
- Die Beurteilung der Eignung verschiedener Instrumente für verschiedene Phasen der Implementierung von KI-Ethik
- Die Abwägung von Vor- und Nachteilen der verschiedenen Instrumente
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die Relevanz von Corporate Digital Responsibility im Kontext des KI-Einsatzes in Unternehmen heraus. Kapitel 2 präsentiert die theoretischen Grundlagen, indem es die Bedeutung von Werten und Normen in der Ethik und die Anwendung der Diskursethik im Unternehmenskontext beleuchtet. Kapitel 3 erläutert die Methodik der Arbeit, welche sich auf eine systematische Literaturrecherche und die Analyse der verschiedenen Instrumente stützt. Kapitel 4 gibt einen Überblick über die Herausforderungen der Implementierung von KI-Ethik in Unternehmen, wobei die Dynamik, Komplexität, Normativität und Finanzierbarkeit der Thematik behandelt werden. Kapitel 5 stellt verschiedene Instrumente zur Implementierung von KI-Ethik vor, einschließlich Ethik-Training, Kodizes, Ethik Boards und Tools für Entwickler:innen. Die Diskussion in Kapitel 6 analysiert die Ergebnisse der Untersuchung und beleuchtet die Limitationen der Arbeit sowie den Ausblick auf zukünftige Forschungsmöglichkeiten.
Schlüsselwörter
Corporate Digital Responsibility, Künstliche Intelligenz, KI-Ethik, Diskursethik, Werte und Normen, Unternehmensethik, Instrumente, Implementierung, Analyse, Herausforderungen, Methodik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Corporate Digital Responsibility (CDR)?
CDR bezeichnet die freiwillige Selbstverpflichtung von Unternehmen zu einem verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Technologien, insbesondere mit KI-Systemen.
Warum benötigen Unternehmen eine eigene KI-Ethik?
Da gesetzliche Vorschriften oft fehlen, müssen Unternehmen eigene Werte und Normen erarbeiten, um Diskriminierung durch Algorithmen zu vermeiden und Transparenz zu schaffen.
Welche Rolle spielt die Diskursethik bei der Implementierung von CDR?
Die Diskursethik dient als theoretisches Fundament, um Werte und Normen durch faire und transparente Verfahren innerhalb des Unternehmens gemeinsam zu begründen.
Welche Instrumente zur Umsetzung von KI-Ethik werden analysiert?
Die Arbeit bewertet Ethik-Trainings, Verhaltenskodizes, Ethik-Boards und spezielle Tools für Software-Entwickler.
Was sind die größten Herausforderungen bei der KI-Implementierung?
Zu den zentralen Herausforderungen gehören die hohe Dynamik der Technologie, die Komplexität der Systeme sowie Fragen der Finanzierbarkeit und Normativität.
Details
- Titel
- Das Potential diskursiver Instrumente zur Implementierung von Corporate Digital Responsibility
- Untertitel
- Eine kritische Analyse
- Hochschule
- Universität Hamburg
- Note
- 1,7
- Autor
- Felix von Roesgen (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2021
- Seiten
- 93
- Katalognummer
- V1262756
- ISBN (Buch)
- 9783346698926
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Digitale Ethik Corporate Digital Responsibility CDR Diskurstheorie Habermas KI-Ethik AI-Ethics verantwortungsvolle Digitalisierung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 39,99
- Preis (Book)
- US$ 50,99
- Arbeit zitieren
- Felix von Roesgen (Autor:in), 2021, Das Potential diskursiver Instrumente zur Implementierung von Corporate Digital Responsibility, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1262756
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-