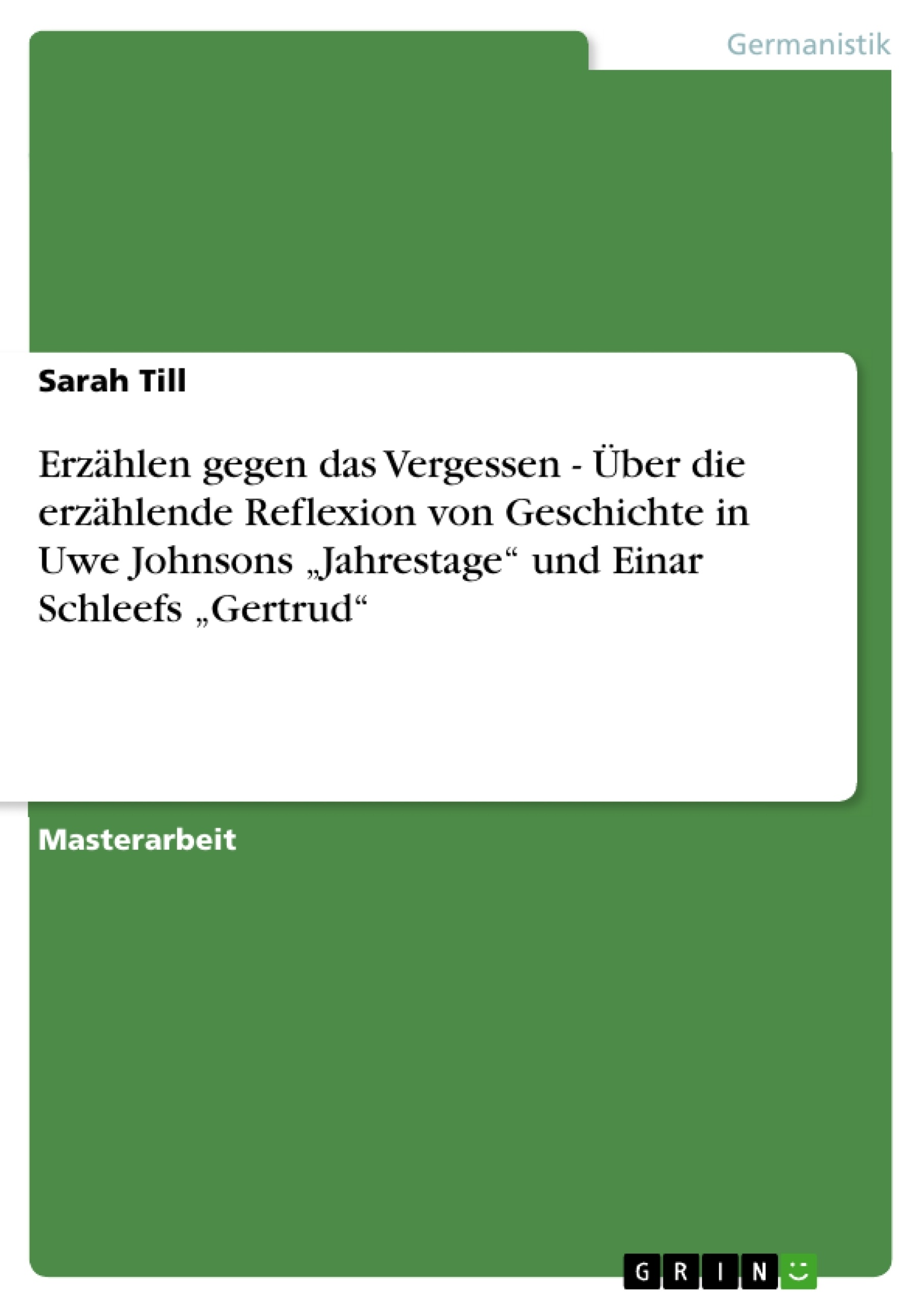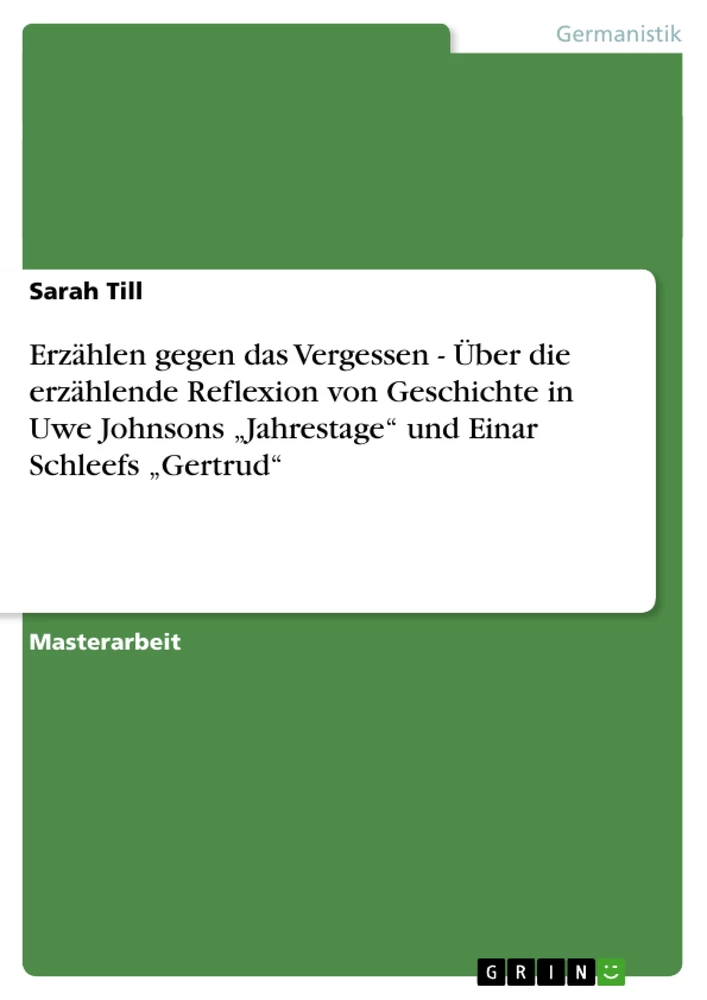
Erzählen gegen das Vergessen - Über die erzählende Reflexion von Geschichte in Uwe Johnsons „Jahrestage“ und Einar Schleefs „Gertrud“
Masterarbeit, 2009
73 Seiten, Note: 1,0
Germanistik - Komparatistik, Vergleichende Literaturwissenschaft
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Poetisierte Geschichtsschreibung und historiographischer Roman
- Geschichte(n): Literatur und Geschichtsschreibung
- Das Romaneske an der Geschichtsschreibung
- Der historiographisch orientierte Roman
- Oral history und Mentalitätengeschichte
- Literarische Erinnerungskultur zwischen Erkenntnisgewinn und Neuperspektivierung
- Literatur als Beitrag zum kollektiven Gedächnis
- Sinnfindung durch Erkenntnisgewinn
- Sinnfindung durch Neuperspektivierung
- Das narrative Programm des Schoah-Gedächtnisses
- Die Poetik moderner Literatur
- Schreiben nach Auschwitz: Ein Widerspruch?
- Die Betroffenheit der Nachgeborenen-Generation
- Reflexion von Geschichte in Uwe Johnsons Jahrestage
- Erzählsituation: „Schreib mir zehn Worte für mich, Genosse Schriftsteller“
- Poetisierte oral history: „[A]ber du warst doch dabei, wenn in einem Moment Geschichte gemacht wurde“
- Ewige Wiederkehr des Gleichen: „Wie oft noch“
- Erinnerung als Voraussetzung für das Erzählen von Geschichte: „Wenn ich die Erinnerung will, kann ich sie nicht sehen“
- Experimentelle Geschichtsschreibung mithilfe von Fiktionalität: „Geschichte ist ein Entwurf“
- Reflexion von Geschichte in Einar Schleefs Gertrud
- Erzählsituation: „Wenn ich das aufschreibe, wird es nicht wieder in Details zerfallen“
- Poetisierte oral history: „Mich quälen Daten, Geschichten“
- Ewige Wiederkehr des Gleichen: „Die Umstände verändern sich, es bleibt ewig dasselbe“
- Erinnerung als Voraussetzung für das Erzählen von Geschichte: „Mich erinnern, was bringt das, flennen, jeden Tag“
- Experimentelle Geschichtsschreibung mithilfe von Fiktionalität: „Wie ist es und wie könnte es sein“
- Schluss
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, inwiefern literarische Werke einen Beitrag zum Erinnerungsdiskurs leisten können, insbesondere im Kontext der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Sie untersucht die Schnittstellen zwischen Geschichtsschreibung und literarischer Fiktion und analysiert, wie die Geschichte in den Roman gelangt und welche Rolle die Literatur bei der Aufarbeitung von jüngster Geschichte spielt. Die Arbeit verfolgt einen interdisziplinären Ansatz, der Berührungspunkte zwischen Literaturwissenschaft, Geschichtswissenschaft und Kulturwissenschaft beleuchtet.
- Die Beziehung zwischen Literatur und Geschichtsschreibung
- Die Rolle der Literatur bei der Aufarbeitung von Geschichte
- Die Bedeutung von Erinnerungskultur in der Literatur
- Die Verwendung von oral history und Mentalitätengeschichte in der Literatur
- Der Vergleich von Uwe Johnsons Jahrestage und Einar Schleefs Gertrud
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die Relevanz von Erinnerungskultur in der heutigen Zeit dar. Sie beleuchtet die Rolle der Literatur im Erinnerungsdiskurs und die Bedeutung der interdisziplinären Betrachtungsweise.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der poetisierten Geschichtsschreibung und dem historiographischen Roman. Es analysiert die Beziehung zwischen Literatur und Geschichtsschreibung und die Entwicklung eines neuen methodischen Denkansatzes in der Geschichtsbetrachtung.
Das dritte Kapitel untersucht die literarische Erinnerungskultur und ihre Rolle bei der Aufarbeitung von Geschichte. Es beleuchtet die Bedeutung von Literatur als Beitrag zum kollektiven Gedächtnis und die Möglichkeiten der Sinnfindung durch Erkenntnisgewinn und Neuperspektivierung.
Das vierte Kapitel widmet sich dem narrativen Programm des Schoah-Gedächtnisses und analysiert die Poetik moderner Literatur im Kontext der Aufarbeitung des Holocaust. Es beleuchtet die Herausforderungen des Schreibens nach Auschwitz und die Betroffenheit der Nachgeborenen-Generation.
Das fünfte Kapitel analysiert Uwe Johnsons Jahrestage und untersucht die Reflexion von Geschichte in diesem Roman. Es beleuchtet die Erzählsituation, die Verwendung von poetisierter oral history, die Thematik der ewigen Wiederkehr des Gleichen, die Bedeutung von Erinnerung für das Erzählen von Geschichte und die experimentelle Geschichtsschreibung mithilfe von Fiktionalität.
Das sechste Kapitel analysiert Einar Schleefs Gertrud und untersucht die Reflexion von Geschichte in diesem Roman. Es beleuchtet die Erzählsituation, die Verwendung von poetisierter oral history, die Thematik der ewigen Wiederkehr des Gleichen, die Bedeutung von Erinnerung für das Erzählen von Geschichte und die experimentelle Geschichtsschreibung mithilfe von Fiktionalität.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die literarische Erinnerungskultur, die poetisierte Geschichtsschreibung, den historiographischen Roman, die Aufarbeitung von Geschichte, die Rolle der Literatur im Erinnerungsdiskurs, die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts, Uwe Johnson, Einar Schleef, Jahrestage, Gertrud, oral history, Mentalitätengeschichte, Holocaust, Schoah-Gedächtnis, Erkenntnisgewinn, Neuperspektivierung, interdisziplinäre Betrachtungsweise.
Details
- Titel
- Erzählen gegen das Vergessen - Über die erzählende Reflexion von Geschichte in Uwe Johnsons „Jahrestage“ und Einar Schleefs „Gertrud“
- Hochschule
- Ruhr-Universität Bochum
- Note
- 1,0
- Autor
- Sarah Till (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2009
- Seiten
- 73
- Katalognummer
- V126580
- ISBN (Buch)
- 9783640321841
- ISBN (eBook)
- 9783640323937
- Dateigröße
- 837 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Uwe Johnson Einar Schleef Jahrestage Gertrud Erinnerung Geschichte Historiographie Johnson Schleef Geschichtsfatalismus Aufarbeitung literarische Aufarbeitung Literatur Geschichtsdarstellung in der Literatur DDR-Autoren
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 32,99
- Preis (Book)
- US$ 46,99
- Arbeit zitieren
- Sarah Till (Autor:in), 2009, Erzählen gegen das Vergessen - Über die erzählende Reflexion von Geschichte in Uwe Johnsons „Jahrestage“ und Einar Schleefs „Gertrud“, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/126580
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-