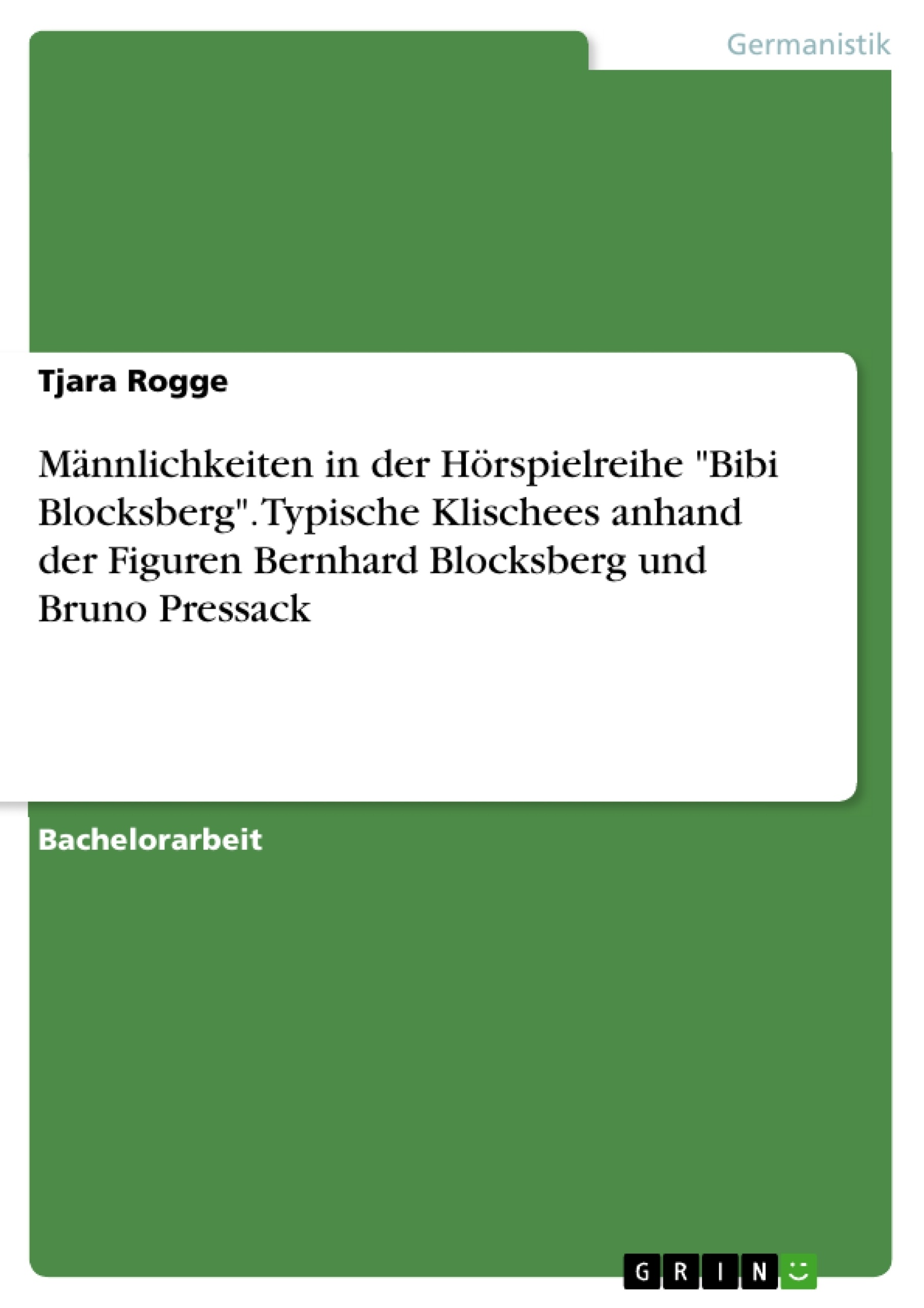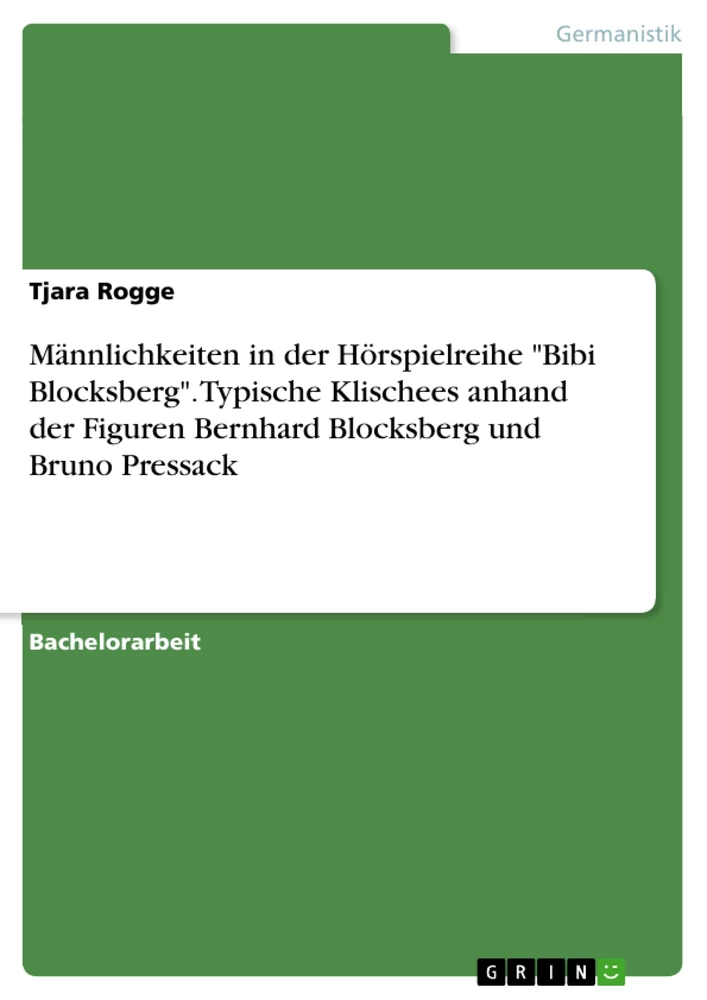
Männlichkeiten in der Hörspielreihe "Bibi Blocksberg". Typische Klischees anhand der Figuren Bernhard Blocksberg und Bruno Pressack
Bachelorarbeit, 2021
48 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretische Grundlagen
- 2.1 Men's Studies
- 2.1.1 Männlichkeiten im Plural
- 2.1.2 Hegemoniale Männlichkeit
- 2.1.3 Soziologische Aspekte in der Literaturanalyse
- 2.1.4 Stereotypisierung des Männerbildes in der Literatur
- 2.2 Das Hörspiel
- 2.2.1 Kriterien eines Hörspiels
- 2.2.2 Hörspiel als auditives Medium in der Kinder- und Jugendliteratur
- 2.3 Bibi Blocksberg
- 2.3.1 Männer in der Menschenwelt
- 2.3.2 Männer in der Hexenwelt
- 3 Analyse der Männlichkeiten in dem Hörspiel Bibi Blocksberg
- 3.1 Bernhard Blocksberg
- 3.1.1 Inhalt
- 3.1.2 Cover
- 3.1.3 Stimme
- 3.1.4 Beziehung zu Bibi und Barbara Blocksberg
- 3.2 Bruno Pressack
- 3.2.1 Inhalt
- 3.2.2 Cover
- 3.2.3 Stimme
- 3.2.4 Beziehung zu Karla Kolumna und Paul Pichler
- 5 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Konstruktion männlicher Figuren in der Hörspielreihe Bibi Blocksberg, insbesondere die Rollen von Bernhard Blocksberg und Bruno Pressack. Ziel ist es, zu analysieren, wie das Männerbild in dieser langjährigen und erfolgreichen Serie dargestellt wird und ob sich diese Darstellung im Laufe der Zeit verändert hat. Die Arbeit berücksichtigt dabei den Einfluss medialer Überpräsenz und den Kontext der Men's Studies.
- Analyse der Männlichkeiten im Kontext der Men's Studies
- Untersuchung der hegemonialen Männlichkeit und anderer Männlichkeitsformen in Bibi Blocksberg
- Vergleich der Figuren Bernhard Blocksberg und Bruno Pressack anhand verschiedener Kriterien (Inhalt, Cover, Stimme, Beziehungen)
- Diachroner Vergleich der Figuren über verschiedene Folgen und Jahrgänge
- Bewertung der Stereotypisierung männlicher Figuren in der Hörspielreihe
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Bachelorarbeit ein und beschreibt den Kontext der Hörspielreihe Bibi Blocksberg. Sie betont die lange Erfolgsgeschichte der Serie und die Bedeutung der weiblichen Hauptfigur. Der Fokus der Arbeit wird jedoch auf die männlichen Nebenfiguren Bernhard Blocksberg und Bruno Pressack gelegt, um deren Rollenkonstruktion und inszeniertes Männerbild zu untersuchen. Die Forschungsfrage thematisiert die Veränderung des Männerbildes vor dem Hintergrund des Erfolgs und der medialen Überpräsenz der Serie. Die Arbeit skizziert den methodischen Ansatz, der sich auf Men's Studies, soziologische Aspekte der Literaturanalyse und die Kriterien des Hörspielmediums stützt.
2 Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es definiert den Begriff Men's Studies und erläutert die Bedeutung hegemonialer Männlichkeit. Die Kapitel erläutern weiterhin soziologische Aspekte der Literaturanalyse und die Stereotypisierung des Männerbildes in der Literatur. Des Weiteren beschreibt es das Hörspiel als auditives Medium in der Kinder- und Jugendliteratur und analysiert die unterschiedliche Darstellung männlicher Figuren in der "Menschenwelt" und der "Hexenwelt" von Bibi Blocksberg.
3 Analyse der Männlichkeiten in dem Hörspiel Bibi Blocksberg: In diesem Kapitel werden die Figuren Bernhard Blocksberg und Bruno Pressack anhand von Inhalt, Covergestaltung, Stimme und Beziehungen zu anderen Figuren analysiert. Ein diachroner Vergleich über verschiedene Folgen und Jahrgänge soll Entwicklungen in der Darstellung dieser Figuren aufzeigen. Die Analyse untersucht, ob und wie die Figuren Klischees männlicher Rollenbilder entsprechen und ob sich diese Darstellungen im Laufe der Zeit verändert haben.
Schlüsselwörter
Bibi Blocksberg, Men's Studies, Hegemoniale Männlichkeit, Männlichkeitskonstruktionen, Hörspiel, Kinder- und Jugendliteratur, Figurenanalyse, Bernhard Blocksberg, Bruno Pressack, Stereotypisierung, Rollenbilder, Medienanalyse.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: "Männlichkeiten in Bibi Blocksberg"
Was ist das Thema der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Konstruktion männlicher Figuren in der Hörspielreihe "Bibi Blocksberg", insbesondere die Rollen von Bernhard Blocksberg und Bruno Pressack. Es wird analysiert, wie das Männerbild in der Serie dargestellt wird und ob sich diese Darstellung im Laufe der Zeit verändert hat.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Men's Studies, soziologische Aspekte der Literaturanalyse und die Kriterien des Hörspielmediums. Konzepte wie hegemoniale Männlichkeit und die Stereotypisierung von Männerbildern in der Literatur spielen eine zentrale Rolle.
Welche Figuren werden analysiert?
Die Hauptfiguren der Analyse sind Bernhard Blocksberg (Bibis Vater) und Bruno Pressack (ein wiederkehrender Charakter). Die Analyse betrachtet ihre Darstellung in Bezug auf Inhalt, Covergestaltung, Stimme und Beziehungen zu anderen Figuren.
Wie wird die Analyse durchgeführt?
Die Analyse beinhaltet einen diachronen Vergleich der Figuren über verschiedene Folgen und Jahrgänge. Es wird untersucht, ob und wie die Figuren Klischees männlicher Rollenbilder entsprechen und ob sich diese Darstellungen im Laufe der Zeit verändert haben.
Welche Aspekte der Figuren werden untersucht?
Die Analyse betrachtet verschiedene Aspekte der Figuren: den Inhalt der Hörspiele, die Gestaltung der Cover, die Stimme der Charaktere und ihre Beziehungen zu anderen Figuren (z.B. Bibi und Barbara Blocksberg für Bernhard, Karla Kolumna und Paul Pichler für Bruno).
Welche Forschungsfrage wird gestellt?
Die Arbeit untersucht, wie sich das Männerbild in "Bibi Blocksberg" im Laufe der Zeit verändert hat, vor dem Hintergrund des Erfolgs und der medialen Überpräsenz der Serie.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bibi Blocksberg, Men's Studies, Hegemoniale Männlichkeit, Männlichkeitskonstruktionen, Hörspiel, Kinder- und Jugendliteratur, Figurenanalyse, Bernhard Blocksberg, Bruno Pressack, Stereotypisierung, Rollenbilder, Medienanalyse.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit beinhaltet eine Zusammenfassung der Kapitel. Die Einleitung führt in die Thematik ein, die theoretischen Grundlagen werden erläutert und das Kapitel zur Analyse der Männlichkeiten in "Bibi Blocksberg" beschreibt die methodische Vorgehensweise und die Ergebnisse.
Welches Ziel verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Konstruktion männlicher Figuren in "Bibi Blocksberg" zu analysieren und zu untersuchen, wie das Männerbild in dieser Serie dargestellt wird und ob sich diese Darstellung im Laufe der Zeit verändert hat.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum bestimmt und dient der Analyse von Themen im Bereich der Men's Studies und der Medienanalyse.
Details
- Titel
- Männlichkeiten in der Hörspielreihe "Bibi Blocksberg". Typische Klischees anhand der Figuren Bernhard Blocksberg und Bruno Pressack
- Hochschule
- Universität Hildesheim (Stiftung)
- Note
- 1,7
- Autor
- Tjara Rogge (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2021
- Seiten
- 48
- Katalognummer
- V1266056
- ISBN (Buch)
- 9783346708182
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- männlichkeiten hörspielreihe bibi blocksberg typische klischees figuren bernhard bruno pressack
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 28,99
- Arbeit zitieren
- Tjara Rogge (Autor:in), 2021, Männlichkeiten in der Hörspielreihe "Bibi Blocksberg". Typische Klischees anhand der Figuren Bernhard Blocksberg und Bruno Pressack, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1266056
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-