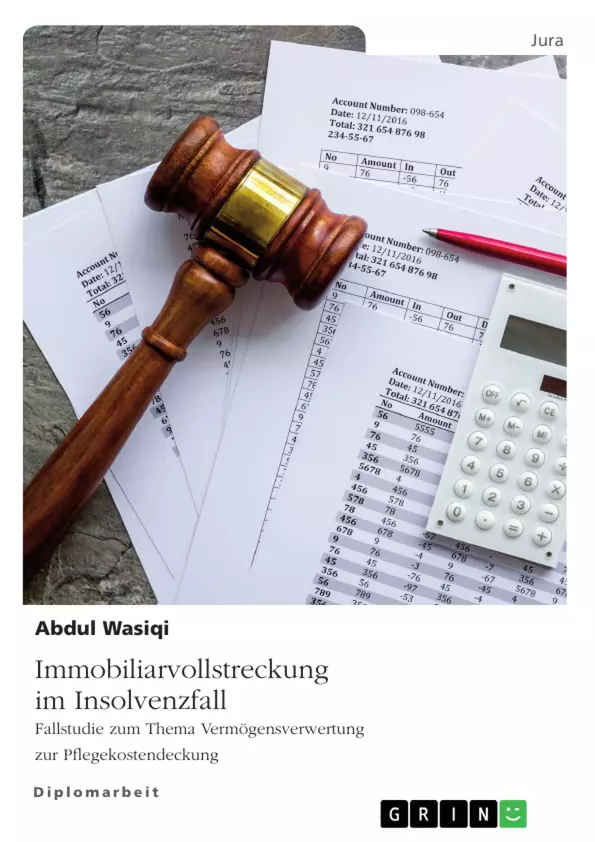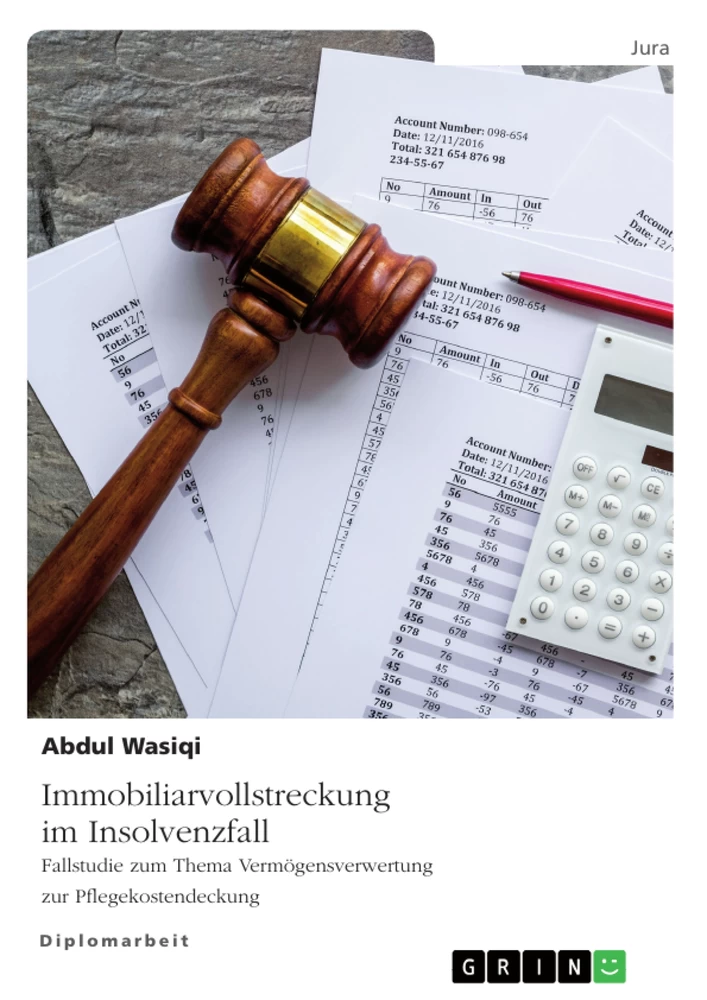
Immobiliarvollstreckung im Insolvenzfall. Fallstudie zum Thema Vermögensverwertung zur Pflegekostendeckung
Diplomarbeit, 2022
68 Seiten, Note: 2
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- A. Einführung
- I. Der Ausgangsfall
- II. Begründung der Themenwahl und Relevanz des Themas
- III. Ziel der Arbeit
- IV. Vorgehen
- V. Struktur und Aufbau der Arbeit
- B. Hauptteil
- I. Einkommens- und Vermögensverwertung zur Pflegekostendeckung
- 1. Pflegekosten, Pflegeversicherung, Eigenanteil
- 2. Kosten
- a) Ermittlung des Pflegegrad (Module, Punkte)
- b) Pflegegrade
- aa) Leistungsanspruch nach Pflegegrad
- bb) Monatliche Durchschnittskosten nach Pflegegrad
- 3. Verwertung des Einkommens
- 4. Verwertung von Vermögen
- a) Einzusetzendes verwertbares Vermögen i.S.v. § 90 Abs. 1 SGB XII
- aa) Verwertung
- bb) Verwertbarkeit
- (1) Rechtliche Verwertbarkeit
- (2) Tatsächliche Verwertbarkeit
- c) zeitliche Verwertbarkeit
- d) ausgeschlossenes Vermögen i.S.v. § 90 Abs. 2 Nr. 1-9 SGB XII
- aa) Altersvorsorgevermögen
- bb) Bausparvermögen/Hausbeschaffungs- und Erhaltungsmittel
- cc) Angemessener Hausrat
- dd) Gegenstände zur Berufs- und Erwerbstätigkeit
- ee) Familien- und Erbstücke
- ff) Gegenstände zur Befriedigung geistiger Bedürfnisse
- gg) Barbeträge bis 5.000 Euro
- b) Geschützter Grundbesitz (Haus, Eigentumswohnung)
- aa) Voraussetzungen
- (1) Haus als verwertbarer Vermögensgegenstand
- (a) Hausgrundstück
- (b) Verwertbarkeit
- (2) Eigentum oder Miteigentum an der Immobilie
- (3) Pflegebedürftiger oder Angehörige im Haus wohnhaft
- (4) Angehöriger will dort weiterhin wohnen
- (5) Angemessenheit
- (a) Größe
- (aa) Maßstab des Zweiten Wohnungsbaugesetzes
- (bb) Was gehört zur Wohnflächengröße?
- (cc) Was gehört nicht zur Wohnflächengröße?
- (1) Grundstück
- (2) Haus
- (3) Wohnung
- (dd) Bewohnerzahl
- (ee) Wohnbedarf
- (ff) Zuschnitt und Ausstattung
- (ee) Grundstückswert einschließlich des Wohngebäudes
- (6) Folgen der Unangemessenheit
- (7) Zumutbarkeit der Verwertung – Härtefall?
- (a) Größe
- (1) Haus als verwertbarer Vermögensgegenstand
- aa) Voraussetzungen
- a) Einzusetzendes verwertbares Vermögen i.S.v. § 90 Abs. 1 SGB XII
- II. Zwangsvollstreckung
- 1. Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung
- a) Allgemeine Verfahrensvoraussetzungen („Zulässigkeit“)
- aa) Antrag des Gläubigers
- bb) zuständiges Vollstreckungsorgan
- cc) Verfahrensbeteiligte
- b) Allgemeine Zwangsvollstreckungsvoraussetzungen
- aa) Vorliegen eines Vollstreckungstitels
- bb) Erteilung der Vollstreckungsklausel
- cc) Zustellung des Titels, § 750 ZPO
- c) Besondere Vollstreckungsvoraussetzungen
- d) Allgemeinen Vollstreckungshindernisse
- a) Allgemeine Verfahrensvoraussetzungen („Zulässigkeit“)
- 2. Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen
- a) Zwangsvollstreckung in bewegliche Sachen (Fahrnis) §§ 808 ff. ZPO
- b) Zwangsvollstreckung in Forderungen §§ 829ff, 835 ff. ZPO
- c) Zwangsvollstreckung in unbewegliches Vermögen
- 3. Vollstreckung in Grundstücke
- a) Gegenstand der Zwangsvollstreckung in unbewegliches Vermögen
- b) Verwertungsarten
- aa) Eintragung einer Zwangshypothek
- bb) Zwangsversteigerung
- (1) Anordnung der Zwangsversteigerung und Beschlagnahme
- (2) Verwertung
- cc) Zwangsverwaltung
- (1) Anordnung der Zwangsverwaltung
- (2) Beschlagnahme
- (a) Zustellung des Anordnungsbeschlusses
- (b) Eingang des Eintragungsersuchens
- (c) Grundstückinbesitznahme
- (3) Folgen der Zwangsverwaltung
- (4) Beendigung der Zwangsverwaltung
- 4. Rechtsbehelfe gegen die Zwangsvollstreckung
- 1. Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung
- C. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht die rechtlichen Rahmenbedingungen der Immobiliarvollstreckung im Insolvenzfall einer Pflegebedürftigen mit dem Fokus auf die Verwertung des Vermögens zur Deckung der Pflegekosten.
- Verwertungsmöglichkeiten von Einkommen und Vermögen zur Pflegekostendeckung
- Rechtliche Rahmenbedingungen der Zwangsvollstreckung in unbewegliches Vermögen
- Verwertungsarten im Rahmen der Zwangsvollstreckung in Grundstücke
- Besonderheiten der Zwangsvollstreckung im Insolvenzfall einer Pflegebedürftigen
- Rechtliche Aspekte der Angemessenheit von Wohnraum im Rahmen der Zwangsvollstreckung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in den konkreten Fall der Betreuten Frau P. H. und erläutert die Relevanz des Themas sowie die Zielsetzung der Arbeit. Kapitel B befasst sich mit der Verwertung von Einkommen und Vermögen zur Deckung der Pflegekosten. Hier werden die verschiedenen Arten von Pflegekosten, der Pflegegrad sowie die Verwertbarkeit von Einkommen und Vermögen im Detail untersucht. Des Weiteren wird die rechtliche Grundlage für die Verwertung von Vermögen im Rahmen des SGB XII erläutert. Kapitel B geht dann auf die Zwangsvollstreckung ein, insbesondere die Voraussetzungen und Verfahrensabläufe, die bei der Verwertung von unbeweglichem Vermögen relevant sind. Die verschiedenen Verwertungsarten, wie z.B. die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung, werden im Detail beschrieben. Abschließend wird die Arbeit mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse und einem Ausblick auf mögliche weiterführende Forschungsthemen abgeschlossen.
Schlüsselwörter
Immobiliarvollstreckung, Insolvenz, Pflegebedürftigkeit, Pflegekosten, Vermögen, Zwangsversteigerung, Zwangsverwaltung, SGB XII, Wohnraum, Angemessenheit, Härtefall, Rechtsbehelfe
Häufig gestellte Fragen
Kann ein Hausgrundstück zur Deckung von Pflegekosten verwertet werden?
Ja, im Falle einer Insolvenz oder fehlender Mittel kann eine Immobiliarvollstreckung (z. B. Zwangsversteigerung) durchgeführt werden, sofern die Immobilie nicht als geschütztes Vermögen gilt.
Was gilt als „geschützter Grundbesitz“ im Sinne des SGB XII?
Ein angemessenes Hausgrundstück oder eine Eigentumswohnung kann geschützt sein, wenn der Pflegebedürftige oder Angehörige dort wohnen und die Angemessenheit (Größe, Wert) gewahrt bleibt.
Welche Verwertungsarten gibt es bei der Vollstreckung in Grundstücke?
Zu den Verwertungsarten gehören die Eintragung einer Zwangshypothek, die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung.
Wann gilt die Verwertung einer Immobilie als Härtefall?
Eine Verwertung kann als unzumutbar gelten, wenn besondere Umstände vorliegen, die eine außergewöhnliche Härte für den Betroffenen oder seine Angehörigen bedeuten würden.
Was sind die Voraussetzungen für eine Zwangsvollstreckung?
Erforderlich sind allgemeine Voraussetzungen wie ein wirksamer Vollstreckungstitel, eine Vollstreckungsklausel und die Zustellung des Titels.
Bis zu welcher Höhe sind Barbeträge beim Vermögen geschützt?
Gemäß den Regelungen im SGB XII sind Barbeträge bis zu einer Grenze von 5.000 Euro als Schonvermögen geschützt.
- I. Einkommens- und Vermögensverwertung zur Pflegekostendeckung
Details
- Titel
- Immobiliarvollstreckung im Insolvenzfall. Fallstudie zum Thema Vermögensverwertung zur Pflegekostendeckung
- Hochschule
- Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
- Veranstaltung
- Recht
- Note
- 2
- Autor
- Abdul Wasiqi (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2022
- Seiten
- 68
- Katalognummer
- V1267406
- ISBN (Buch)
- 9783346720238
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Immobiliarvollstreckung im Insolvenzfall meiner Betreuten Frau P. H. aus Hamburg
- Schlagworte
- Immobiliarvollstreckung Insolvenzfall ambulante Pflege Pflegedienst Kostendeckung Zwangsvollstreckung Betreuungsdienst Fallstudie
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 31,99
- Preis (Book)
- US$ 45,99
- Arbeit zitieren
- Abdul Wasiqi (Autor:in), 2022, Immobiliarvollstreckung im Insolvenzfall. Fallstudie zum Thema Vermögensverwertung zur Pflegekostendeckung, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1267406
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-