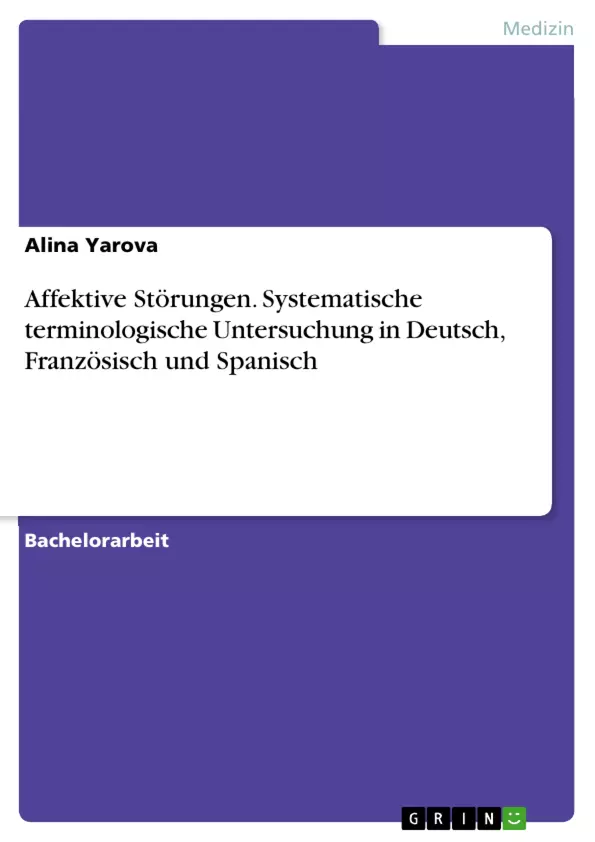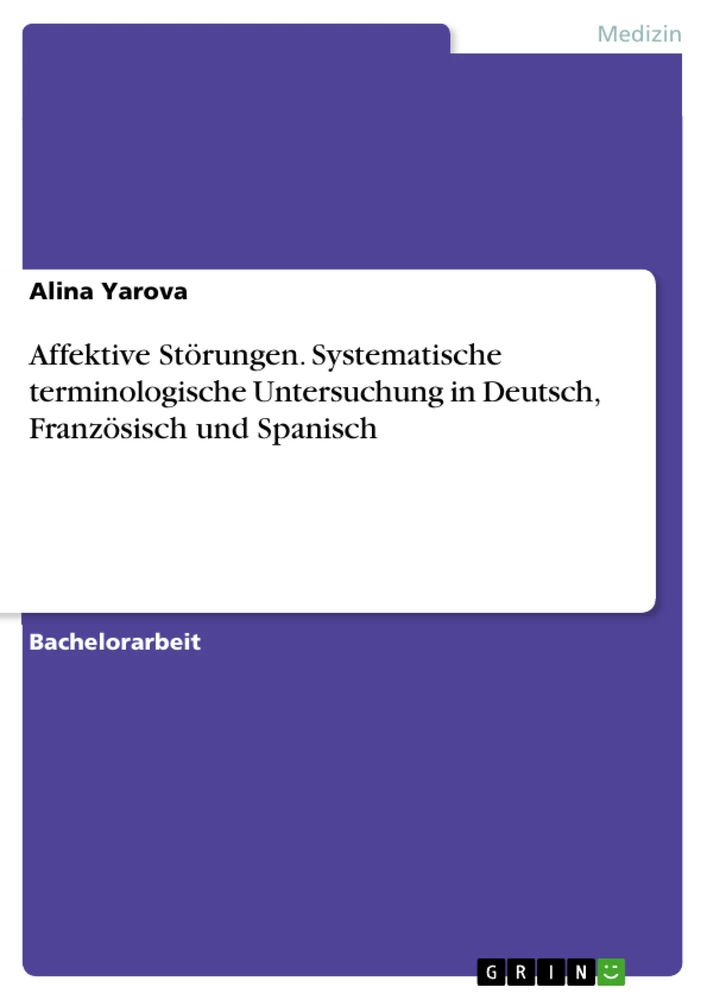
Affektive Störungen. Systematische terminologische Untersuchung in Deutsch, Französisch und Spanisch
Bachelorarbeit, 2017
187 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einführung in das Fachgebiet
- Historischer Überblick
- Definition der affektiven Störungen
- Verlaufsformen der affektiven Störungen
- Symptomatik
- Anzeichen der Depression
- Anzeichen der Manie
- Darstellung der Arbeitsmethodik
- Begriffssystem
- Terminologische Untersuchung
- Alphabetische Indizes
- Index Deutsch-Französisch
- Index Französisch-Deutsch
- Index Deutsch-Spanisch
- Index Spanisch-Deutsch
- Bibliographie, die für die Theorie verwendet wurde
- Gedruckte Quellen
- Online-Quellen
- Bibliographie, die für die terminologischen Einträge verwendet wurde
- Gedruckte Quellen
- Online-Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der systematischen terminologischen Untersuchung von affektiven Störungen in den Sprachen Deutsch, Französisch und Spanisch. Sie untersucht die historische Entwicklung des Themas, definiert affektive Störungen und ihre Verlaufsformen, und analysiert die Symptomatik von Manie und Depression. Die Arbeit stellt ein Begriffssystem und eine terminologische Datenbank zur Verfügung, die als Übersetzungshilfe und Informationsquelle dienen soll.
- Historische Entwicklung der affektiven Störungen und der Psychiatrie als Wissenschaft
- Definition und Verlaufsformen der affektiven Störungen
- Symptomatik von Manie und Depression
- Entwicklung einer terminologischen Datenbank für die Übersetzung und Information
- Zusammenstellung alphabetischer Indizes für die vier Sprachen
Zusammenfassung der Kapitel
Das Kapitel 2 "Einführung in das Fachgebiet" bietet einen historischen Überblick über die affektiven Störungen und die Entwicklung der Psychiatrie als Wissenschaft. Es definiert den Begriff der affektiven Störungen und beschreibt verschiedene Verlaufsformen. Anschließend werden die Symptome von Manie und Depression näher erläutert.
Das Kapitel 3 "Darstellung der Arbeitsmethodik" behandelt die Herausforderungen bei der Erstellung der terminologischen Datenbank.
Kapitel 4 "Begriffssystem" zeigt das graphisch dargestellte Begriffssystem, das als Grundlage für die terminologische Untersuchung dient und die wichtigsten Begriffe der Datenbank visualisiert.
Die terminologische Datenbank selbst, die im Kapitel 5 "Terminologische Untersuchung" präsentiert wird, enthält die wichtigsten Benennungen, Synonyme und Definitionen zu den verschiedenen Aspekten der affektiven Störungen.
Schlüsselwörter
Affektive Störungen, Psychiatrie, Manie, Depression, Bipolarität, Terminologie, Datenbank, Übersetzung, Fachsprache, Deutsch, Französisch, Spanisch, historische Entwicklung, Symptomatik, Verlaufsformen, Behandlung, Prävention.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter affektiven Störungen?
Affektive Störungen sind psychische Erkrankungen, die sich primär durch extreme Schwankungen der Stimmung äußern, insbesondere Depression (Tief) und Manie (Hoch).
Was ist der Unterschied zwischen Depression und Manie?
Depression ist durch Niedergeschlagenheit und Antriebslosigkeit gekennzeichnet, während Manie durch gesteigerten Antrieb, Euphorie oder Reizbarkeit definiert wird.
Welchen Nutzen bietet die terminologische Datenbank dieser Arbeit?
Die Datenbank dient als Übersetzungshilfe und Informationsquelle in Deutsch, Französisch und Spanisch für Betroffene, Angehörige und Fachpersonal.
Was ist eine bipolare Erkrankung?
Eine bipolare Erkrankung liegt vor, wenn sich depressive Episoden mit manischen Phasen abwechseln.
Warum wurden für die Arbeit Spanisch und Französisch gewählt?
Diese Weltsprachen ermöglichen es, eine breite internationale Bevölkerung über Symptome und Verlaufsformen affektiver Störungen aufzuklären, da Fachliteratur oft primär auf Englisch oder Deutsch vorliegt.
Details
- Titel
- Affektive Störungen. Systematische terminologische Untersuchung in Deutsch, Französisch und Spanisch
- Hochschule
- Technische Hochschule Köln, ehem. Fachhochschule Köln (ITMK)
- Note
- 1,0
- Autor
- Alina Yarova (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2017
- Seiten
- 187
- Katalognummer
- V1268876
- ISBN (Buch)
- 9783346724090
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Terminologie Sprachdatenbank Affektive Störungen Französisch Spanisch Depression Bipolare Störung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 42,99
- Preis (Book)
- US$ 56,99
- Arbeit zitieren
- Alina Yarova (Autor:in), 2017, Affektive Störungen. Systematische terminologische Untersuchung in Deutsch, Französisch und Spanisch, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1268876
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-