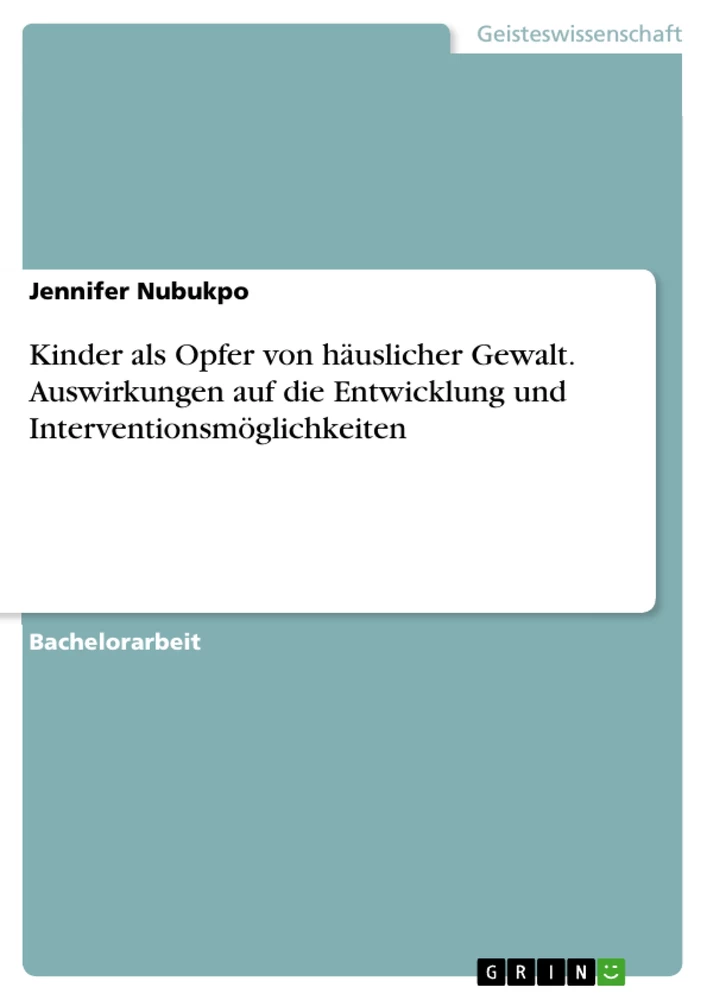
Kinder als Opfer von häuslicher Gewalt. Auswirkungen auf die Entwicklung und Interventionsmöglichkeiten
Bachelorarbeit, 2022
54 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffserklärung
- Familie
- Gewalt
- Häusliche Gewalt
- Familiale Gewalt gegen Kinder
- Formen von familialer Gewalt gegen Kinder
- Physische Gewalt
- Psychische und emotionale Gewalt
- Sexuelle Gewalt
- Vernachlässigung
- Auswirkungen von Gewalterfahrungen in der Kindheit
- Gefühle der Kinder
- Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung
- Generationale Weitergabe der Gewalt
- Parentifizierung
- Häusliche Gewalt als Trauma für Kinder
- Ursachen und Risikofaktoren zur Entstehung häuslicher Gewalt
- Prävalenz der familialen Gewalt gegen Kinder
- Gesetzliche Grundlage
- Formen von familialer Gewalt gegen Kinder
- Bewältigungsstrategien
- Resilienz
- Begriffsbestimmung
- Ressourcen und Schutzfaktoren
- Resilienz
- Häusliche Gewalt im Kontext der Corona-Pandemie
- Corona-Pandemie
- Kindeswohlgefährdung und familiale Gewalt an Kindern im Lockdown
- Hilfe und Unterstützung – Prävention & Interventionen
- Prävention
- Interventionen und Hilfsangebote für betroffene Kinder und Familien
- Ressourcenaktivierung
- Aktivierung personaler Ressourcen
- Aktivierung sozialer Ressourcen
- Förderung und Entwicklung familiärer Ressourcen
- Handlungsmöglichkeiten der Kinder- und Jugendhilfe
- Diverse Hilfsangebote für betroffene Kinder und Familien
- Ressourcenaktivierung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Auswirkungen von häuslicher Gewalt auf die Entwicklung von Kindern. Sie beleuchtet verschiedene Formen von familialer Gewalt, analysiert deren Folgen für die kindliche Entwicklung und betrachtet die Bewältigungsstrategien von betroffenen Kindern.
- Formen familialer Gewalt gegen Kinder
- Folgen von Gewalterfahrungen in der Kindheit
- Resilienz und Schutzfaktoren
- Prävention und Interventionen im Kontext häuslicher Gewalt
- Häusliche Gewalt im Kontext der Corona-Pandemie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema häusliche Gewalt gegen Kinder ein und verdeutlicht die Relevanz der Thematik. Im zweiten Kapitel werden die zentralen Begriffe wie Familie, Gewalt und häusliche Gewalt definiert und voneinander abgegrenzt. Das dritte Kapitel widmet sich den Formen familialer Gewalt gegen Kinder, darunter physische, psychische, sexuelle Gewalt sowie Vernachlässigung. Es werden zudem die Auswirkungen dieser Gewalt auf die kindliche Entwicklung, die generationale Weitergabe von Gewalt und die Parentifizierung thematisiert. Kapitel 4 befasst sich mit der Bewältigungsstrategie der Resilienz. Kapitel 5 untersucht die Häusliche Gewalt im Kontext der Corona-Pandemie, mit einem Fokus auf die Gefährdung von Kindern im Lockdown. Das sechste Kapitel widmet sich Hilfesystemen und Interventionen, mit einem Schwerpunkt auf Ressourcenaktivierung und den Handlungsmöglichkeiten der Kinder- und Jugendhilfe.
Schlüsselwörter
Häusliche Gewalt, Familiale Gewalt, Kinderschutz, Entwicklungspsychologie, Resilienz, Prävention, Intervention, Corona-Pandemie, Kindeswohlgefährdung, Ressourcenaktivierung, Kinder- und Jugendhilfe.
Häufig gestellte Fragen
Welche Formen häuslicher Gewalt gegen Kinder gibt es?
Häusliche Gewalt umfasst physische, psychische/emotionale und sexuelle Gewalt sowie Vernachlässigung.
Was bedeutet "Parentifizierung"?
Parentifizierung beschreibt eine Rollenumkehr, bei der Kinder die Verantwortung für ihre Eltern übernehmen müssen, oft weil diese aufgrund von Gewalt oder Krisen dazu nicht in der Lage sind.
Wie wirkt sich das Miterleben von Gewalt auf die Entwicklung aus?
Es kann zu Traumatisierungen, Entwicklungsverzögerungen und einer generationalen Weitergabe von Gewaltmustern führen.
Welche Rolle spielt Resilienz bei betroffenen Kindern?
Resilienz ist die psychische Widerstandsfähigkeit, die es Kindern ermöglicht, sich trotz schwerer Belastungen gesund zu entwickeln, oft unterstützt durch Schutzfaktoren und Ressourcen.
Wie beeinflusste die Corona-Pandemie die häusliche Gewalt?
Durch Lockdowns und soziale Isolation stieg das Risiko für Kindeswohlgefährdung, da Kontrollinstanzen wie Schulen und Kitas wegfielen und familiäre Spannungen zunahmen.
Details
- Titel
- Kinder als Opfer von häuslicher Gewalt. Auswirkungen auf die Entwicklung und Interventionsmöglichkeiten
- Hochschule
- Katholische Fachhochschule Mainz
- Note
- 1,0
- Autor
- Jennifer Nubukpo (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2022
- Seiten
- 54
- Katalognummer
- V1284669
- ISBN (Buch)
- 9783346742629
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- kinder opfer gewalt auswirkungen entwicklung interventionsmöglichkeiten
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Jennifer Nubukpo (Autor:in), 2022, Kinder als Opfer von häuslicher Gewalt. Auswirkungen auf die Entwicklung und Interventionsmöglichkeiten, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1284669
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









