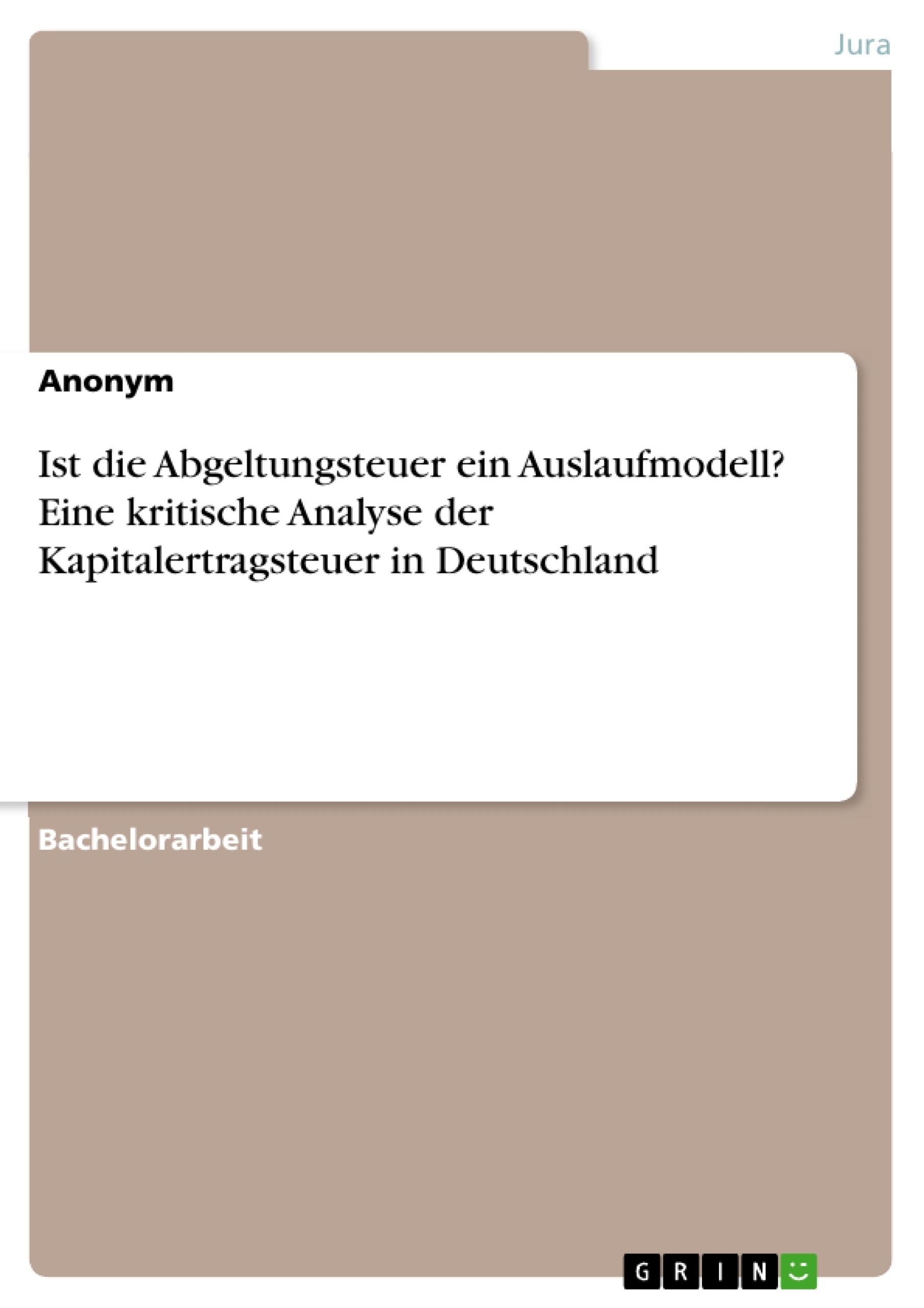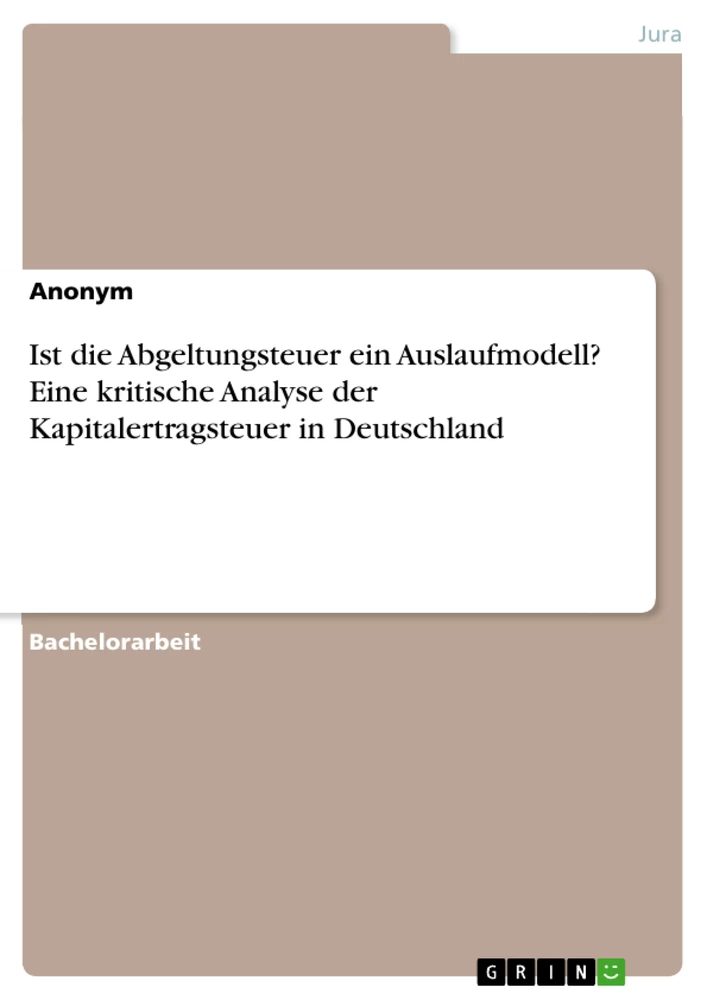
Ist die Abgeltungsteuer ein Auslaufmodell? Eine kritische Analyse der Kapitalertragsteuer in Deutschland
Bachelorarbeit
81 Seiten
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- 2. Grundlagen
- 2.1 Begriff der Abgeltungsteuer
- 2.2 System der Einkommensteuer in Deutschland
- 2.2.1 Wesen der Einkommensteuer
- 2.2.2 Persönliche Steuerpflicht
- 2.2.3 Sachliche Steuerpflicht
- 2.2.4 Steuertarif
- 3. Systematische Darstellung der Abgeltungsteuer
- 3.1 Einkünfte aus Kapitalvermögen
- 3.1.1 Besteuerungstatbestand
- 3.1.1.1 Laufende Erträge des Kapitalvermögens
- 3.1.1.2 Gewinne aus der Veräußerung von Kapitalvermögen
- 3.1.2 Besteuerungsumfang
- 3.1.2.1 Einkünfteermittlung
- 3.1.2.2 Verlustverrechnung
- 3.1.2.3 Gesonderter Steuertarif für Einkünfte aus Kapitalvermögen
- 3.1.2.4 Anrechnung ausländischer Steuern
- 3.1.3 Besteuerungsverfahren
- 3.1.3.1 Steuerabzugsverfahren
- 3.1.3.2 Veranlagungsverfahren
- 3.2 Einkünfte aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften
- 3.3 Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften
- 4. Kritische Analyse der Besteuerung von Kapitaleinkünften in Deutschland
- 4.1 Würdigung der Vorteile der Abgeltungsteuer
- 4.1.1 Verhinderung von Steuerhinterziehung
- 4.1.2 Erhöhung der Standortattraktivität
- 4.1.3 Steigerung der Steuereinnahmen
- 4.1.4 Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens
- 4.1.5 Wahrung der Anonymität
- 4.2 Verfassungsrechtliche Beurteilung der Abgeltungsteuer
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der kritischen Analyse der Abgeltungsteuer in Deutschland. Ziel ist es, die Vor- und Nachteile dieser Steuerform zu beleuchten und ihre Auswirkungen auf die Besteuerung von Kapitaleinkünften zu untersuchen.
- Begriff der Abgeltungsteuer und ihre Funktionsweise im System der Einkommensteuer
- Systematische Darstellung der Besteuerung von Kapitaleinkünften
- Kritische Analyse der Vorteile und Nachteile der Abgeltungsteuer
- Verfassungsrechtliche Beurteilung der Abgeltungsteuer
- Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der Abgeltungsteuer
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung stellt die Problemstellung der Abgeltungsteuer in Deutschland dar und erläutert Zielsetzung und Aufbau der Arbeit.
- Kapitel 2: In diesem Kapitel werden die Grundlagen der Abgeltungsteuer und das deutsche Einkommensteuersystem erläutert.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel bietet eine systematische Darstellung der Abgeltungsteuer und beleuchtet die Besteuerungstatbestände, den Besteuerungsumfang sowie die verschiedenen Besteuerungsverfahren.
- Kapitel 4: Hier werden die Vor- und Nachteile der Abgeltungsteuer in Deutschland kritisch analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Begriffen Abgeltungsteuer, Einkommensteuer, Kapitalvermögen, Besteuerung, Steuerhinterziehung, Standortattraktivität, Steuereinnahmen, Besteuerungsverfahren, Verfassungsrecht.
Details
- Titel
- Ist die Abgeltungsteuer ein Auslaufmodell? Eine kritische Analyse der Kapitalertragsteuer in Deutschland
- Autor
- Anonym (Autor:in)
- Seiten
- 81
- Katalognummer
- V1289512
- ISBN (Buch)
- 9783346798824
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Ertragsteuer Einkommensteuer abgeltungsteuer kapitalertragsteuer analyse auslaufmodell deutschland
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 39,99
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), Ist die Abgeltungsteuer ein Auslaufmodell? Eine kritische Analyse der Kapitalertragsteuer in Deutschland, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1289512
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-