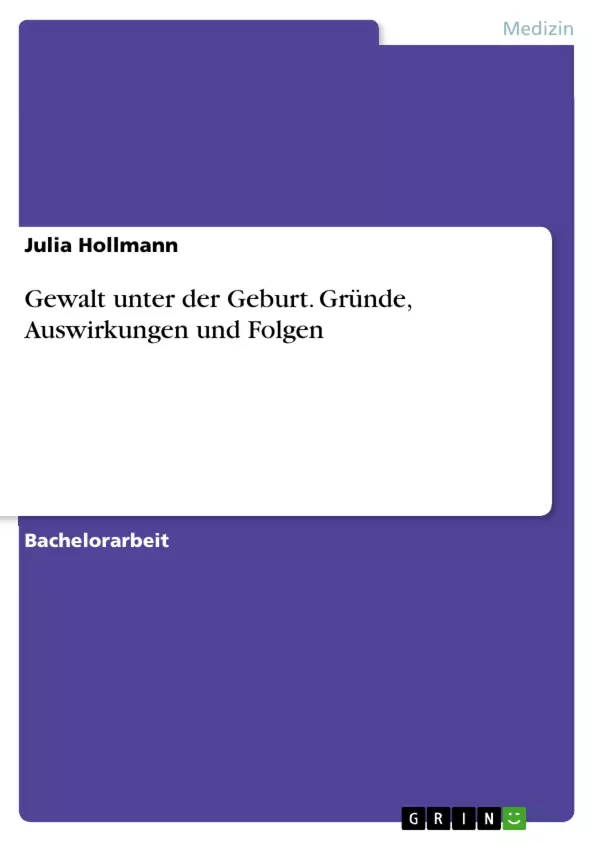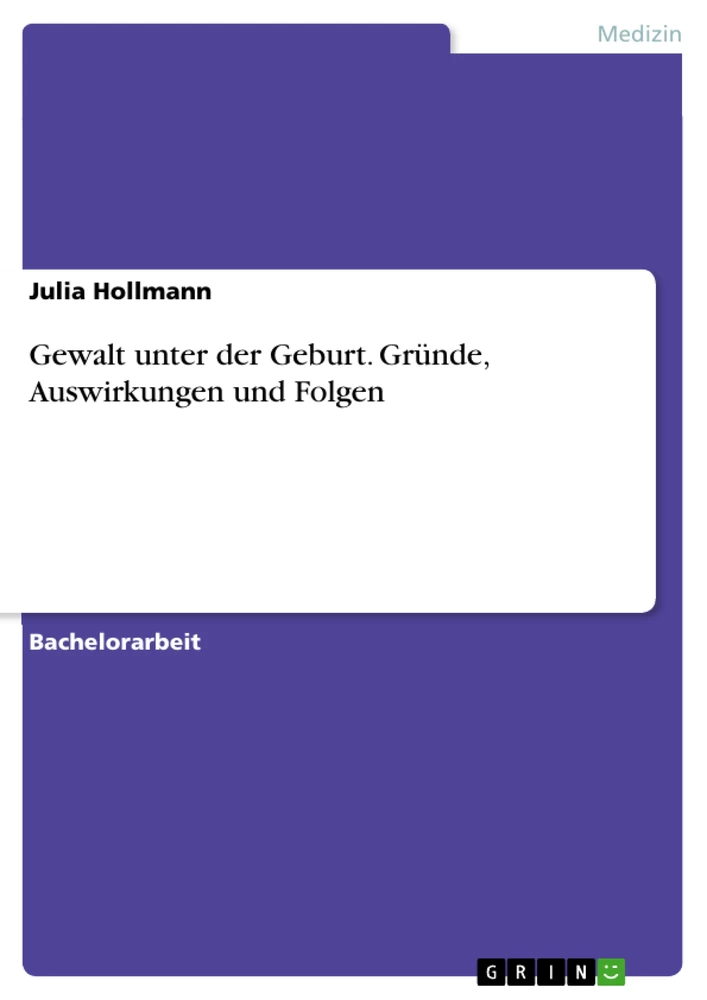
Gewalt unter der Geburt. Gründe, Auswirkungen und Folgen
Bachelorarbeit, 2022
38 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Was ist Gewalt unter der Geburt?
- 2.1 Begriffsdefinitionen
- 2.2 Formen
- 2.3 Prävalenz
- 2.3.1 Häufigkeit verschiedener Interventionen
- 2.3.2 Gewalt gegenüber Gebärenden
- 2.3.3 Gewalt gegenüber Kreißsaalpersonal
- 3 Gründe für Gewalt unter der Geburt
- 3.1 Medikalisierung und Ökonomisierung von Geburt
- 3.2 Hebammenmangel und Kreißsaalschließungen
- 4 Auswirkungen und Folgen von Gewalt unter der Geburt
- 4.1 Folgen für Gebärende
- 4.2 Folgen für das Kind
- 4.3 Folgen für Väter/Partner*innen
- 4.4 Folgen für geburtshilfliches Personal
- 4.5 Roses Revolution Day
- 5 Prävention
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ursachen und Folgen von Gewalt unter der Geburt aus Public-Health-Perspektive. Ziel ist es, die Gründe für diese Gewaltform zu identifizieren und ihre Auswirkungen auf Gebärende, Kinder, Partner*innen und das Personal zu beleuchten. Die Arbeit stützt sich auf eine Literaturrecherche.
- Definition und Formen von Gewalt unter der Geburt
- Die Rolle der Medikalisierung und Ökonomisierung des Gesundheitswesens
- Der Einfluss von Hebammenmangel und Kreißsaalschließungen
- Auswirkungen auf die körperliche und psychische Gesundheit Betroffener
- Präventionsmöglichkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung präsentiert das Thema „Gewalt unter der Geburt“ anhand eines eindrücklichen Erfahrungsberichts und stellt die Relevanz der Thematik im Kontext von Public Health heraus. Sie unterstreicht die globale Verbreitung des Problems und die dringende Notwendigkeit weiterer Forschung, da ein wissenschaftlicher Konsens über Definition und Erfassung von geburtshilflicher Gewalt fehlt. Die Arbeit definiert ihre Zielsetzung: die Untersuchung der Ursachen und Folgen von Gewalt unter der Geburt auf Public-Health-Ebene.
2 Was ist Gewalt unter der Geburt?: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Definition von Gewalt unter der Geburt, beschreibt verschiedene Formen der Gewalt (physisch, psychisch, strukturell) und beleuchtet die Prävalenz des Problems anhand bestehender Daten und Studien. Es werden Herausforderungen bei der Datenerhebung und der Definition von geburtshilflicher Gewalt thematisiert, was die Wissenslücke in diesem Bereich verdeutlicht.
3 Gründe für Gewalt unter der Geburt: Dieses Kapitel analysiert die strukturellen Ursachen von Gewalt unter der Geburt. Es argumentiert, dass die Ökonomisierung des Gesundheitswesens und der damit verbundene Hebammenmangel zentrale Faktoren sind. Die Ökonomisierung führt zu einem vermehrten Einsatz medizinischer Interventionen, die ein Gewaltpotenzial bergen. Der Hebammenmangel und die Schließung von Kreißsälen erhöhen die Arbeitsbelastung und den Stress des Personals, was ebenfalls zu Gewalt beitragen kann.
4 Auswirkungen und Folgen von Gewalt unter der Geburt: Dieses Kapitel beschreibt die weitreichenden Folgen von Gewalt unter der Geburt für alle Beteiligten: Gebärende, Kinder, Partner*innen und das geburtshilfliche Personal. Es werden sowohl physische (Verletzungen, Hämatome) als auch psychische Folgen (Posttraumatische Belastungsstörung, psychosomatische Entwicklungsstörungen) detailliert dargestellt. Der Abschnitt über den "Roses Revolution Day" deutet auf Initiativen zur Bewusstseinsbildung und Veränderung hin.
Schlüsselwörter
Gewalt unter der Geburt, Geburtshilfe, Medikalisierung, Ökonomisierung, Hebammenmangel, Kreißsaalschließungen, Posttraumatische Belastungsstörung, Public Health, Prävention, Interventionsraten, Patientenrechte, selbstbestimmte Geburt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Gewalt unter der Geburt"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Ursachen und Folgen von Gewalt unter der Geburt aus einer Public-Health-Perspektive. Sie beinhaltet eine Einleitung, eine Definition von Gewalt unter der Geburt mit verschiedenen Formen und Prävalenzdaten, eine Analyse der Ursachen (Medikalisierung, Ökonomisierung, Hebammenmangel), eine Beschreibung der Auswirkungen auf Gebärende, Kinder, Partner und Personal, sowie einen Ausblick auf Präventionsmöglichkeiten und ein Fazit. Die Arbeit basiert auf einer Literaturrecherche.
Wie wird Gewalt unter der Geburt definiert?
Die Arbeit liefert eine umfassende Definition von Gewalt unter der Geburt, die physische, psychische und strukturelle Formen umfasst. Sie betont die Herausforderungen bei der Datenerhebung und Definition, die eine Wissenslücke in diesem Bereich verdeutlichen.
Welche Ursachen für Gewalt unter der Geburt werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die strukturellen Ursachen, insbesondere die Medikalisierung und Ökonomisierung des Gesundheitswesens sowie den Hebammenmangel und Kreißsaalschließungen. Diese Faktoren führen zu erhöhtem Stress und Gewaltpotenzial.
Welche Auswirkungen hat Gewalt unter der Geburt?
Die Arbeit beschreibt die weitreichenden Folgen für Gebärende (körperliche und psychische Gesundheit), Kinder (psychosomatische Entwicklungsstörungen), Partner und geburtshilfliches Personal (Stress, Belastung). Physische Verletzungen und psychische Folgen wie die Posttraumatische Belastungsstörung werden detailliert dargestellt.
Welche Präventionsmöglichkeiten werden angesprochen?
Die Arbeit erwähnt Präventionsmöglichkeiten, geht aber nicht detailliert darauf ein. Der "Roses Revolution Day" wird als Beispiel für Initiativen zur Bewusstseinsbildung und Veränderung genannt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Gewalt unter der Geburt, Geburtshilfe, Medikalisierung, Ökonomisierung, Hebammenmangel, Kreißsaalschließungen, Posttraumatische Belastungsstörung, Public Health, Prävention, Interventionsraten, Patientenrechte, selbstbestimmte Geburt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel: Einleitung, Was ist Gewalt unter der Geburt?, Gründe für Gewalt unter der Geburt, Auswirkungen und Folgen von Gewalt unter der Geburt, Prävention und Fazit. Jedes Kapitel wird in der Arbeit zusammengefasst.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Ursachen und Folgen von Gewalt unter der Geburt zu identifizieren und zu beleuchten, um ein besseres Verständnis des Problems aus Public-Health-Perspektive zu ermöglichen.
Details
- Titel
- Gewalt unter der Geburt. Gründe, Auswirkungen und Folgen
- Hochschule
- Universität Bremen
- Note
- 1,3
- Autor
- Julia Hollmann (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2022
- Seiten
- 38
- Katalognummer
- V1294312
- ISBN (Buch)
- 9783346760715
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Gewalt Geburt Geburtshilfe
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 18,99
- Arbeit zitieren
- Julia Hollmann (Autor:in), 2022, Gewalt unter der Geburt. Gründe, Auswirkungen und Folgen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1294312
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-