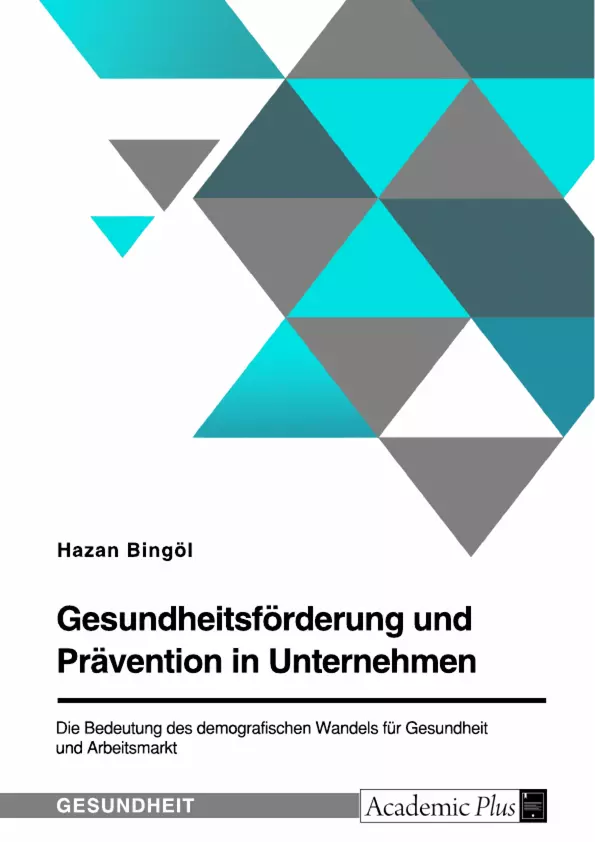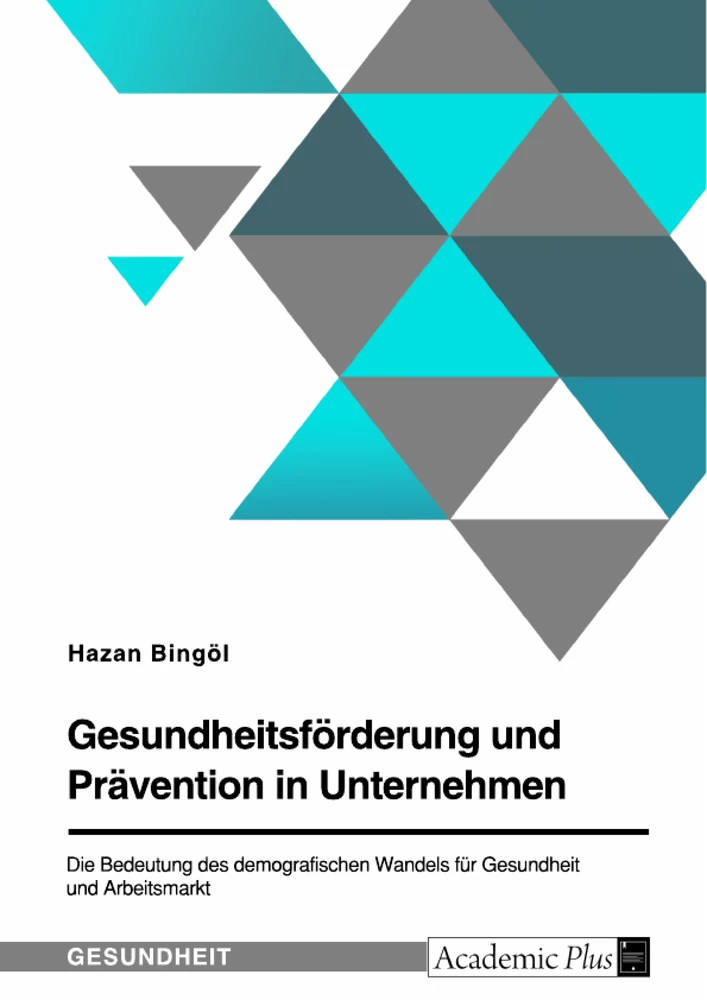
Gesundheitsförderung und Prävention in Unternehmen. Die Bedeutung des demografischen Wandels für Gesundheit und Arbeitsmarkt
Bachelorarbeit, 2022
66 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ziel und Aufbau der Arbeit
- Beschreibung des Untersuchungsdesigns
- Der demografische Wandel
- Bedeutung des demografischen Wandels
- Gesundheitliche Faktoren
- Auswirkungen des demografischen Wandels auf den Arbeitsmarkt
- Gesundheitsförderung in Unternehmen
- Personalpolitik und Gesundheitsförderung in Unternehmen
- Einblick in das betriebliche Gesundheitsmanagement
- Arbeits- und Gesundheitsschutz
- Betriebliches Eingliederungsmanagement
- Betriebliche Gesundheitsförderung und Prävention
- Beschreibung und Ziele der Gesundheitsförderung
- Der Arbeitskreis Gesundheit und die Gesundheitszirkel
- Das Düsseldorfer Modell und das Berliner Modell
- Arten und Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung und Prävention
- Verhaltensprävention und Verhältnisprävention
- Präventionsarten
- Primäre Prävention
- Sekundäre Prävention
- Tertiäre Prävention
- Gesundes Führen
- Suchtprävention
- Gesunde Ernährung
- Bewegungsförderung
- Stress- Konfliktmanagement
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelor-Thesis untersucht den demografischen Wandel und dessen Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Die Arbeit analysiert die Gestaltung von Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention in Unternehmen im Kontext des demografischen Wandels.
- Analyse des demografischen Wandels und seiner Auswirkungen
- Beschreibung von Gesundheitsförderung und Prävention in Unternehmen
- Untersuchung von Maßnahmen und Konzepten zur Gestaltung von betrieblicher Gesundheitsförderung
- Bewertung von relevanten Modellen und Ansätzen der Gesundheitsförderung
- Bedeutung von Präventionsarten und gesundheitsfördernden Maßnahmen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert die Zielsetzung sowie den Aufbau der Arbeit. Zudem wird das Untersuchungsdesign beschrieben.
- Der demografische Wandel: Dieses Kapitel behandelt den demografischen Wandel in Deutschland und seine Bedeutung. Es beleuchtet die gesundheitlichen Faktoren und die Auswirkungen des Wandels auf den Arbeitsmarkt.
- Gesundheitsförderung in Unternehmen: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Personalpolitik und der Gesundheitsförderung in Unternehmen. Der Fokus liegt auf dem Einblick in das betriebliche Gesundheitsmanagement, einschließlich Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie betrieblichem Eingliederungsmanagement.
- Betriebliche Gesundheitsförderung und Prävention: In diesem Kapitel werden Beschreibung und Ziele der Gesundheitsförderung erörtert. Es werden der Arbeitskreis Gesundheit und die Gesundheitszirkel vorgestellt, sowie das Düsseldorfer Modell und das Berliner Modell.
- Arten und Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung und Prävention: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Arten und Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung und Prävention. Dazu gehören Verhaltensprävention und Verhältnisprävention, verschiedene Präventionsarten, Gesundes Führen, Suchtprävention, gesunde Ernährung, Bewegungsförderung und Stress- Konfliktmanagement.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen demografischer Wandel, Gesundheitsförderung, Prävention, betriebliche Gesundheitsmanagement, Arbeitswelt, Personalpolitik und Gesundheitszirkel.
Häufig gestellte Fragen
Wie wirkt sich der demografische Wandel auf Unternehmen aus?
Der Wandel führt zu einer alternden Belegschaft und einem Mangel an Nachwuchskräften. Unternehmen müssen daher verstärkt in die Gesundheit ihrer Mitarbeiter investieren, um deren Leistungsfähigkeit langfristig zu sichern.
Was ist der Unterschied zwischen Verhaltens- und Verhältnisprävention?
Verhaltensprävention setzt beim individuellen Verhalten an (z. B. Rückenschule), während Verhältnisprävention die Arbeitsbedingungen und Strukturen optimiert (z. B. ergonomische Arbeitsplätze).
Welche Ziele verfolgt das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM)?
BGM zielt darauf ab, Belastungen zu senken, die Gesundheit am Arbeitsplatz ganzheitlich zu fördern und die Mitarbeiterzufriedenheit sowie die Produktivität durch Präventionsmaßnahmen zu steigern.
Was versteht man unter primärer, sekundärer und tertiärer Prävention?
Primärprävention verhindert Krankheiten vor deren Entstehung, Sekundärprävention zielt auf die Früherkennung ab, und Tertiärprävention befasst sich mit der Rehabilitation und Vermeidung von Folgeschäden nach einer Erkrankung.
Warum ist „Gesundes Führen“ ein wichtiger Bestandteil?
Führungskräfte haben einen großen Einfluss auf das Stresslevel und das Wohlbefinden ihrer Teams. Gesundes Führen integriert Wertschätzung und gesundheitsfördernde Strukturen in den Führungsalltag.
Details
- Titel
- Gesundheitsförderung und Prävention in Unternehmen. Die Bedeutung des demografischen Wandels für Gesundheit und Arbeitsmarkt
- Hochschule
- FOM Essen, Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Hochschulleitung Essen früher Fachhochschule
- Note
- 1,7
- Autor
- Hazan Bingöl (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2022
- Seiten
- 66
- Katalognummer
- V1294650
- ISBN (Buch)
- 9783346757203
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Mit Academic Plus bietet GRIN ein eigenes Imprint für herausragende Abschlussarbeiten aus verschiedenen Fachbereichen. Alle Titel werden von der GRIN-Redaktion geprüft und ausgewählt. Unsere Autor:innen greifen in ihren Publikationen aktuelle Themen und Fragestellungen auf, die im Mittelpunkt gesellschaftlicher Diskussionen stehen. Sie liefern fundierte Informationen, präzise Analysen und konkrete Lösungsvorschläge für Wissenschaft und Forschung.
- Schlagworte
- Gesundheitsmanagement Gesundheitsförderung Demografischer Wandel Prävention Public Health Human Resource Personal Personalpolitik Gesundheitszirkel Bewegung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 31,99
- Preis (Book)
- US$ 45,99
- Arbeit zitieren
- Hazan Bingöl (Autor:in), 2022, Gesundheitsförderung und Prävention in Unternehmen. Die Bedeutung des demografischen Wandels für Gesundheit und Arbeitsmarkt, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1294650
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-