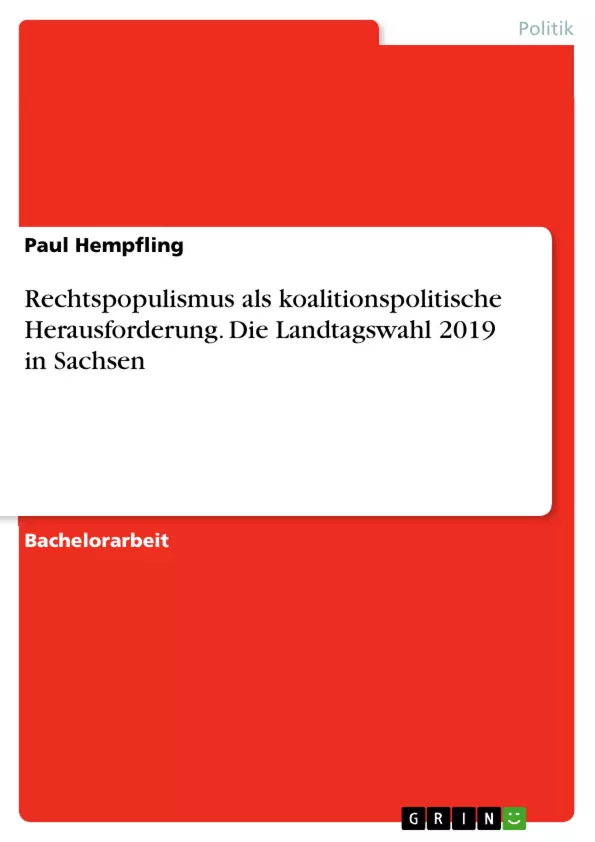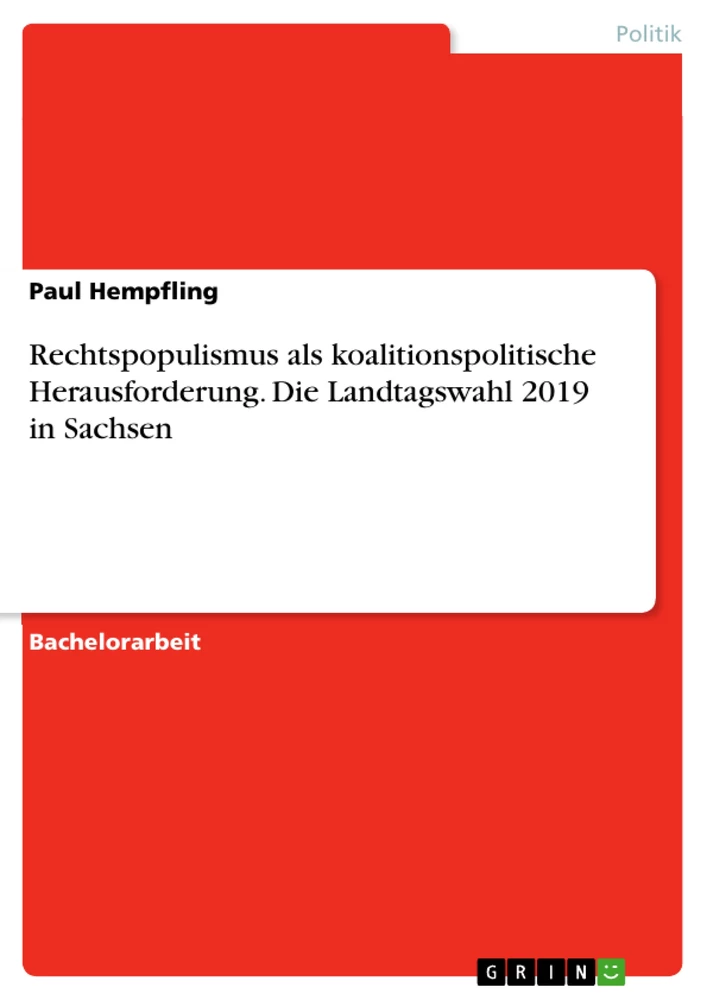
Rechtspopulismus als koalitionspolitische Herausforderung. Die Landtagswahl 2019 in Sachsen
Bachelorarbeit, 2022
53 Seiten, Note: 1,8
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorie und Forschungsstand
- Forschungsentwicklung...
- Die formale Koalitionstheorie und Kritik an dieser
- das Parteiensystem als entscheidende Determinante der Koalitionsbildung..
- Die AfD und ihre Etablierung im Parteiensystem.
- Die Wähler*innenschaft der AfD.
- Die Ausgangslage in Sachsen....
- Wähler*innen in Sachsen.
- Das Sächsische Parteiensystem...
- Die sächsischen Parteien...
- Die sächsischen Landtagswahlen 2019
- Die Wahl und ihr Ergebnis....
- Koalitionsbildung..
- Schlussbetrachtung.
- Koalitionsspezifische Strukturmerkmale Sachsens
- koalitionspotenzial des sächsischen Parteiensystems
- Koalitionsfähigkeit der einzelnen Parteien
- Ergebnisse .......
- Fazit / Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht den Einfluss des Rechtspopulismus auf die Koalitionsbildung auf Landesebene, insbesondere am Beispiel der Landtagswahl 2019 in Sachsen. Die Arbeit analysiert die Koalitionsverhandlungen in Anwesenheit der AfD und untersucht, wie sich die Präsenz einer rechtspopulistischen Partei auf den Koalitionsbildungsprozess auswirkt.
- Die Etablierung rechtspopulistischer Parteien im deutschen Parteiensystem und deren Auswirkungen auf die Koalitionslandschaft
- Die Auswirkungen des Wahlerfolgs der AfD auf das sächsische Parteiensystem und die Koalitionsmöglichkeiten
- Die Analyse des Koalitionsbildungsprozesses nach der Landtagswahl 2019 in Sachsen, insbesondere der "Kenia-Koalition" aus CDU, Grünen und SPD
- Die Herausforderungen und Chancen der Regierungsbildung in Anwesenheit einer rechtspopulistischen Partei
- Die Relevanz der fallanalytischen Betrachtung der sächsischen Landtagswahl 2019 für die Analyse des politischen Wandels in Ostdeutschland
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Ausgangssituation der sächsischen Landtagswahl 2019 dar und führt in das Thema der Koalitionsbildung in Anwesenheit der AfD ein. Sie beleuchtet die Bedeutung des Themas und erläutert die Forschungsfrage der Arbeit.
- Theorie und Forschungsstand: Dieses Kapitel beleuchtet die relevanten Theorien und den Forschungsstand zur Koalitionsbildung, mit besonderem Fokus auf die Rolle des Parteiensystems und den Einfluss rechtspopulistischer Parteien. Es diskutiert die Limitationen formaler Koalitionstheorien und stellt alternative Ansätze vor, die den Kontextualismus stärker berücksichtigen.
- Die Ausgangslage in Sachsen: Dieses Kapitel beschreibt das sächsische Parteiensystem im Vorfeld der Landtagswahl 2019. Es analysiert die Zusammensetzung der Wählerschaft, die Situation der etablierten Parteien und die Rolle der AfD im sächsischen Parteiensystem.
- Die sächsischen Landtagswahlen 2019: Dieses Kapitel analysiert das Wahlergebnis der sächsischen Landtagswahl 2019 und die daraus resultierenden Herausforderungen für die Koalitionsbildung. Es beleuchtet den Wahlerfolg der AfD und die Verluste der etablierten Parteien.
- Koalitionsbildung: Dieses Kapitel beschreibt den Prozess der Koalitionsbildung nach der Landtagswahl 2019 in Sachsen. Es analysiert die Sondierungsgespräche und Koalitionsverhandlungen zwischen den beteiligten Parteien, insbesondere die Bildung der "Kenia-Koalition".
Schlüsselwörter
Rechtspopulismus, Koalitionsbildung, Landtagswahl 2019, Sachsen, AfD, Parteiensystem, Koalitionsverhandlungen, "Kenia-Koalition", Polarisierung, Pluralismus, Ostdeutschland, politische Kultur, Wählerschaft, Wahlverhalten.
Häufig gestellte Fragen
Welche Herausforderungen bringt die AfD für die Koalitionsbildung?
Eine starke Präsenz rechtspopulistischer Parteien erschwert die Bildung klassischer Zweier-Bündnisse und erzwingt oft breite, heterogene Koalitionen wie die „Kenia-Koalition“.
Was ist eine „Kenia-Koalition“?
Es handelt sich um ein Regierungsbündnis aus CDU (schwarz), SPD (rot) und den Grünen (grün), benannt nach den Farben der kenianischen Flagge.
Warum ist Sachsen ein besonderes Fallbeispiel?
Das sächsische Parteiensystem ist durch eine starke Polarisierung und einen hohen Wähleranteil der AfD geprägt, was exemplarisch für politische Wandlungsprozesse in Ostdeutschland ist.
Welche Rolle spielt die formale Koalitionstheorie?
Die Arbeit kritisiert rein formale Theorien und betont, dass Kontextfaktoren und die politische Kultur entscheidende Determinanten für die Regierungsbildung sind.
Wie reagierten die etablierten Parteien in Sachsen 2019?
Trotz großer ideologischer Differenzen einigten sich CDU, Grüne und SPD auf eine Zusammenarbeit, um eine Regierungsbeteiligung der AfD zu verhindern.
Details
- Titel
- Rechtspopulismus als koalitionspolitische Herausforderung. Die Landtagswahl 2019 in Sachsen
- Hochschule
- Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Politikwissenschaften und Japanologie)
- Note
- 1,8
- Autor
- Paul Hempfling (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2022
- Seiten
- 53
- Katalognummer
- V1296250
- ISBN (Buch)
- 9783346758057
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- AfD Koalitionsverhandlungen Wahlen Sachsen Regierungsbildung Rechtspopulismus
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Paul Hempfling (Autor:in), 2022, Rechtspopulismus als koalitionspolitische Herausforderung. Die Landtagswahl 2019 in Sachsen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1296250
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-