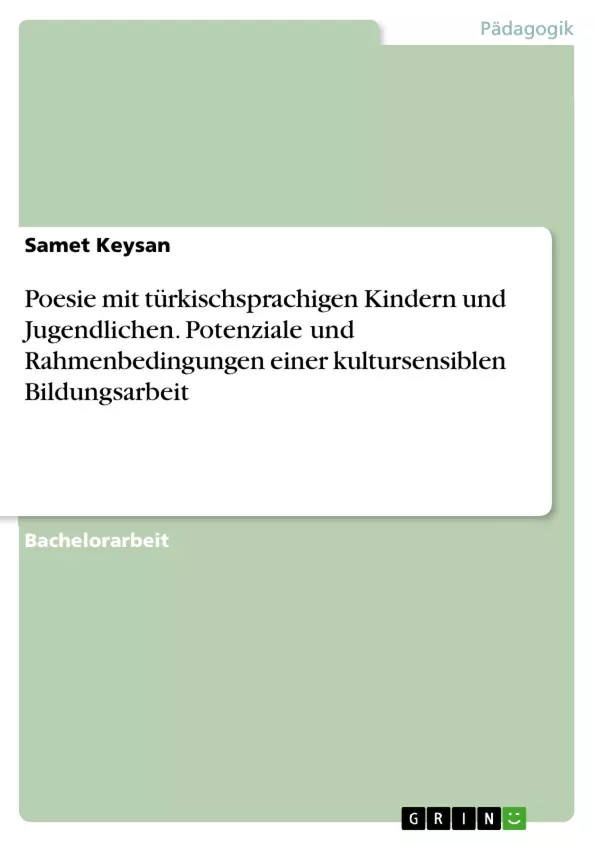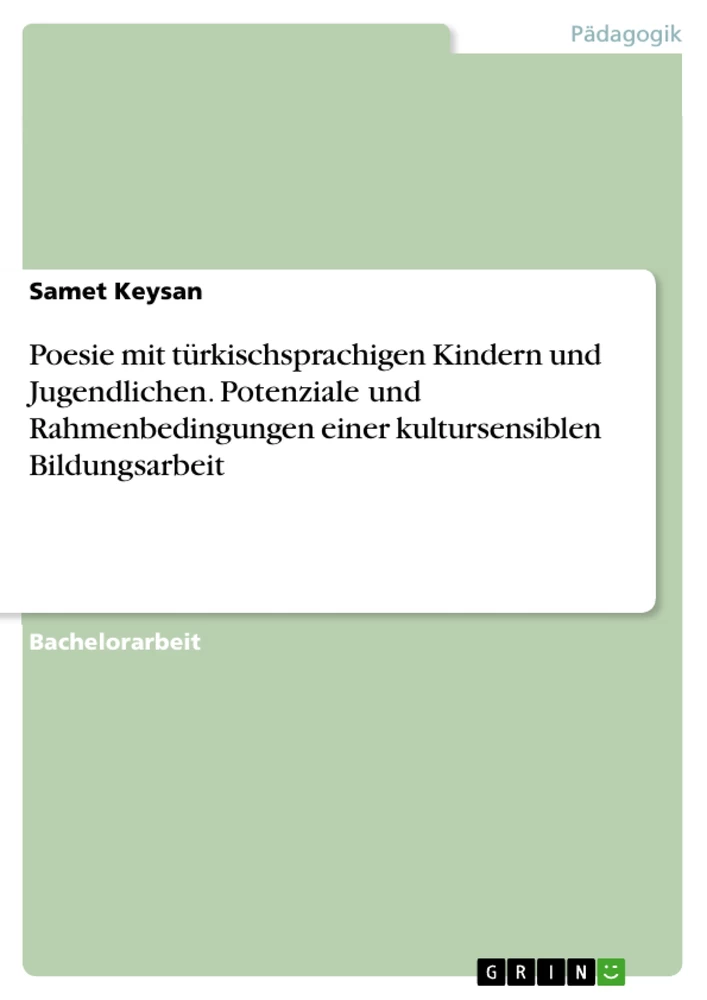
Poesie mit türkischsprachigen Kindern und Jugendlichen. Potenziale und Rahmenbedingungen einer kultursensiblen Bildungsarbeit
Bachelorarbeit, 2022
44 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Türkisch auf dem Pausenhof
- 1. Poesie
- Schreibsessions
- Wirksamkeit des Schreibens
- Poesietherapie/ Poesiecoaching
- Expressive Arts
- Schreibformen
- 2. Sprache und Identität
- Funktion von Sprache
- Spracherwerb
- Zweisprachigkeit und zweisprachige Erziehung
- Semilingualismus
- Muttersprache als Ressource
- 3. Kinder und Jugendliche in der Migration
- Migrationshintergrund
- Erziehungsstile und Integration türkischsprachiger Familien
- Kulturelles Kapital
- 4. Außerschulische Bildungsarbeit
- Schulische Bildung und Außerschulische Bildung
- Potentiale und Chancen kultureller Jugendbildung
- Herausforderungen bei der Gestaltung außerschulischer Jugendbildung
- Religiöse Jugendbildung
- Muslimische Jugendbildung
- Expressive Arts nach Paolo Knill - An Expert Learner Paolo Knill and the Art of teaching
- 5. Diskussion
- Kunst und Poesie
- Sprache als Ressource
- Individuelle Entwicklungsaufgaben durch Migration
- Bildung im geeigneten Setting
- Konzeptidee Schreib-Zeit-Yazma-Zamanı
- Ausblick
- Fazit
- Die Bedeutung der Poesie für die Entwicklung und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
- Die Rolle der Sprache und des Spracherwerbs in der Bildung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
- Die Herausforderungen und Chancen der Integration türkischsprachiger Familien und ihrer Kinder in die deutsche Gesellschaft
- Die Potentiale und Herausforderungen außerschulischer Bildungsarbeit für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund
- Die Entwicklung einer Konzeptidee für eine kultursensible Bildungsarbeit mit türkischsprachigen Kindern und Jugendlichen
- Türkisch auf dem Pausenhof: Dieser Abschnitt führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die Bedeutung der Poesie und ihrer Einsatzmöglichkeiten in sozialen und gesundheitsfördernden Bereichen vor. Die unterschiedlichen Formen und Anwendungsbereiche der Poesie werden diskutiert, darunter Schreibsessions, Poesietherapie und Poesiecoaching.
- Sprache und Identität: Dieses Kapitel befasst sich mit der Bedeutung der Sprache und des Spracherwerbs für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund. Es werden die Vor- und Nachteile der zweisprachigen Erziehung sowie die Herausforderungen des Semilingualismus diskutiert. Der Fokus liegt auf der Bedeutung der Muttersprache als Ressource für die Entwicklung und Integration der Kinder.
- Kinder und Jugendliche in der Migration: In diesem Abschnitt werden die Lebenswelten, individuellen Herausforderungen und Erziehungsstile von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund beleuchtet. Es wird der Einfluss des Migrationshintergrunds auf die Entwicklung und Integration der Kinder betrachtet und die Bedeutung von kulturellem Kapital in diesem Kontext herausgestellt.
- Außerschulische Bildungsarbeit: Dieses Kapitel untersucht die Potentiale und Chancen der außerschulischen Bildungsarbeit für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund. Es werden die unterschiedlichen Formen der außerschulischen Bildung sowie die Herausforderungen bei der Gestaltung kultursensibler Angebote diskutiert. Darüber hinaus werden die Aspekte der religiösen und muslimischen Jugendbildung behandelt.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht den Nutzen des Schreibens für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, insbesondere solche mit türkischer Muttersprache. Im Mittelpunkt steht die Poesie nach Hof, wie sie im Studiengang Expressive Arts in Social Transformation gelehrt wird. Die Arbeit beleuchtet die Rolle der Community Arbeit im Kontext der Poesie und untersucht die Potentiale und Herausforderungen einer kultursensiblen Bildungsarbeit.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen Poesie, Sprache, Identität, Migration, Integration, kulturelle Bildung, außerschulische Bildung, türkischsprachige Kinder und Jugendliche, Expressive Arts, Community Arbeit.
Häufig gestellte Fragen
Wie kann Poesie die Integration fördern?
Poesie ermöglicht es Kindern und Jugendlichen, ihre Identität auszudrücken, Erlebtes zu verarbeiten und sich mit ihren individuellen Hintergründen wertgeschätzt zu fühlen.
Warum ist die Muttersprache eine wichtige Ressource?
Die Anerkennung der Muttersprache (z. B. Türkisch) stärkt das Selbstbewusstsein und bildet die Basis für einen erfolgreichen Zweitspracherwerb sowie eine stabile Identitätsbildung.
Was versteht man unter „Expressive Arts“?
Expressive Arts ist ein interdisziplinärer Ansatz, der verschiedene Kunstformen wie Poesie, Malen oder Musik nutzt, um soziale Transformation und persönliche Entwicklung zu unterstützen.
Was ist das Konzept „Schreib-Zeit-Yazma-Zamanı“?
Es ist eine Konzeptidee für eine kultursensible Bildungsarbeit, die türkischsprachigen Jugendlichen einen geschützten Raum bietet, um kreativ in beiden Sprachen zu schreiben.
Welche Rolle spielt die außerschulische Bildungsarbeit?
Sie bietet Chancen, jenseits des Leistungsdrucks der Schule kulturelle Bildung und Identitätsarbeit zu leisten, die speziell auf die Bedürfnisse von Migrantenfamilien zugeschnitten ist.
Details
- Titel
- Poesie mit türkischsprachigen Kindern und Jugendlichen. Potenziale und Rahmenbedingungen einer kultursensiblen Bildungsarbeit
- Hochschule
- Medical School Hamburg
- Note
- 1,3
- Autor
- Samet Keysan (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2022
- Seiten
- 44
- Katalognummer
- V1296573
- ISBN (Buch)
- 9783346759627
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Poesie Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund Kulturelle Bildung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Samet Keysan (Autor:in), 2022, Poesie mit türkischsprachigen Kindern und Jugendlichen. Potenziale und Rahmenbedingungen einer kultursensiblen Bildungsarbeit, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1296573
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-