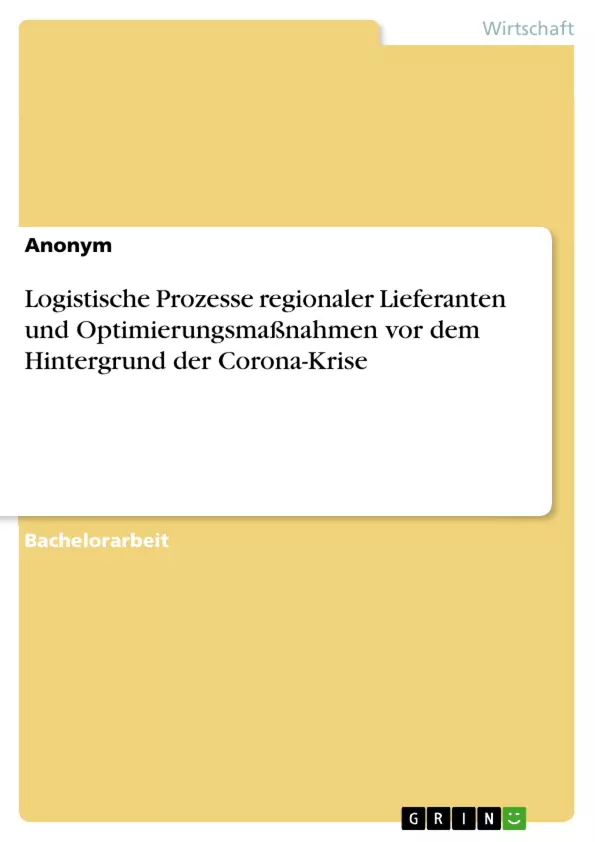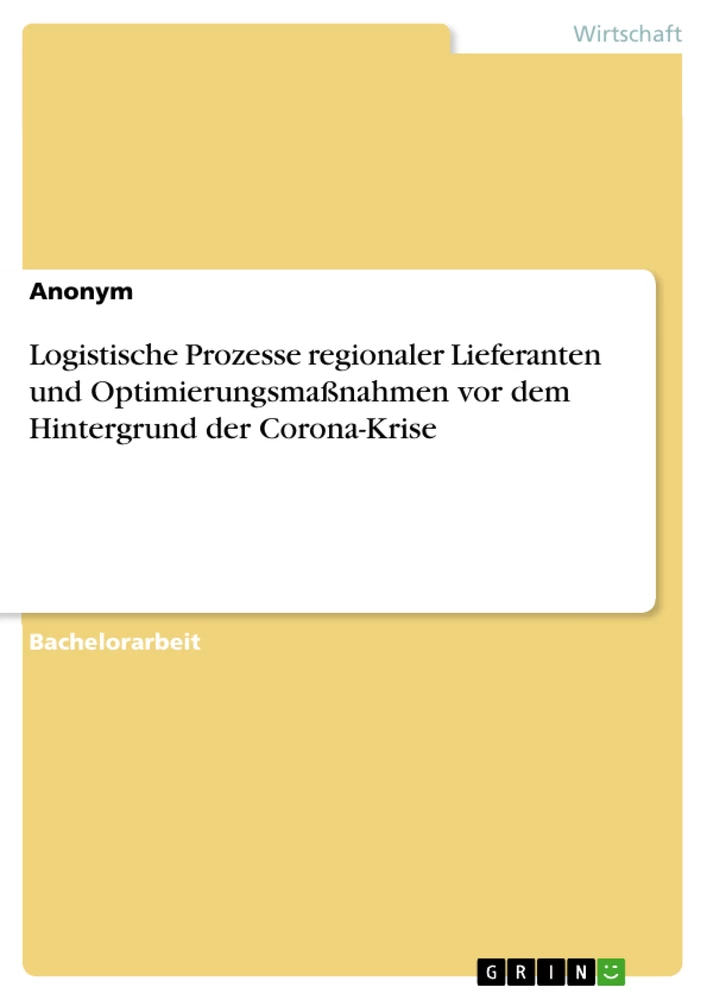
Logistische Prozesse regionaler Lieferanten und Optimierungsmaßnahmen vor dem Hintergrund der Corona-Krise
Bachelorarbeit, 2021
45 Seiten, Note: 2,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das weltweite Phänomen Covid 19
- 2.1 Begriffsdefinition Covid 19
- 2.2 Wirtschaftliche Auswirkungen
- 2.3 Auswirkungen der Corona Pandemie auf den Handel
- 3. Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Lebensmitteleinzelhandel
- 3.1 Corona-Das Ende der Globalisierung?
- 3.2 Entwicklung des Konsumentenverhaltens
- 3.3 Folgen des Konsumentenverhaltens
- 4. Auswirkungen der Corona Pandemie auf die logistischen Prozesse des LEH
- 4.1 Betrachtung der Großfläche
- 4.2 Herausforderungen für regionale Lieferanten
- 4.3 Probleme der Warenbewirtschaftung
- 5. Erarbeitung von Optimierungsmaßnahmen für regionale Lieferanten
- 5.1 Großflächen
- 5.2 Alternative Distributionsfunktionen
- 5.2.1 Digitale Hofläden
- 5.2.2 Click und Collect
- 5.2.3 Curbside Retailing
- 5.2.4 Automaten
- 6. Fazit
- 7. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelor-Thesis analysiert die logistischen Prozesse regionaler Lieferanten im Kontext der Corona-Krise und erarbeitet Optimierungsmaßnahmen. Die Arbeit beleuchtet die Auswirkungen der Pandemie auf den Lebensmitteleinzelhandel (LEH) und untersucht, wie sich die veränderten Konsumgewohnheiten und Lieferketten auf die Logistik regionaler Anbieter auswirken.
- Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den LEH
- Herausforderungen für regionale Lieferanten
- Optimierungsmaßnahmen für die Logistik
- Alternative Distributionsfunktionen
- Resilienz von Lieferketten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz der Corona-Krise für den Handel und die Logistik dar und führt in die Thematik der regionalen Lieferanten und deren Optimierungsmöglichkeiten ein. Das zweite Kapitel definiert den Begriff Covid-19 und beleuchtet die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie. Kapitel drei befasst sich mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Lebensmitteleinzelhandel, wobei die Entwicklung des Konsumentenverhaltens und die Folgen für den LEH im Vordergrund stehen. Kapitel vier analysiert die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die logistischen Prozesse im LEH, insbesondere die Herausforderungen für regionale Lieferanten und die Probleme der Warenbewirtschaftung. Schließlich werden in Kapitel fünf Optimierungsmaßnahmen für regionale Lieferanten erarbeitet, die sich mit alternativen Distributionsfunktionen und der Anpassung an die veränderten Marktbedingungen befassen.
Schlüsselwörter
Corona-Krise, Covid-19, Lebensmitteleinzelhandel (LEH), regionale Lieferanten, Logistik, Optimierung, Distributionsfunktionen, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Resilienz, Konsumentenverhalten.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusste die Corona-Pandemie den Lebensmitteleinzelhandel (LEH)?
Die Pandemie führte zu massiven Veränderungen im Konsumentenverhalten (z. B. Hamsterkäufe) und setzte globale Lieferketten unter Druck.
Vor welchen Herausforderungen standen regionale Lieferanten?
Regionale Anbieter mussten ihre logistischen Prozesse kurzfristig anpassen, um die Warenbewirtschaftung trotz gestörter Abläufe sicherzustellen.
Welche alternativen Distributionswege sind entstanden?
Es gab einen Boom bei digitalen Hofläden, Click und Collect-Systemen, Automatenlösungen und dem sogenannten Curbside Retailing.
Bedeutet Corona das Ende der Globalisierung?
Die Arbeit diskutiert, ob Unternehmen zukünftig verstärkt auf regionale Wertschöpfung setzen, um die Resilienz ihrer Lieferketten zu erhöhen.
Was versteht man unter „Resilienz“ in der Logistik?
Die Fähigkeit von Lieferketten, Schocks wie eine Pandemie abzufedern und die Versorgungssicherheit schnell wiederherzustellen.
Details
- Titel
- Logistische Prozesse regionaler Lieferanten und Optimierungsmaßnahmen vor dem Hintergrund der Corona-Krise
- Hochschule
- Fachhochschule Worms
- Note
- 2,0
- Autor
- Anonym (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2021
- Seiten
- 45
- Katalognummer
- V1306118
- ISBN (eBook)
- 9783346778512
- ISBN (Buch)
- 9783346778529
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- logistische prozesse lieferanten optimierungsmaßnahmen hintergrund corona-krise
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 31,99
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2021, Logistische Prozesse regionaler Lieferanten und Optimierungsmaßnahmen vor dem Hintergrund der Corona-Krise, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1306118
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-