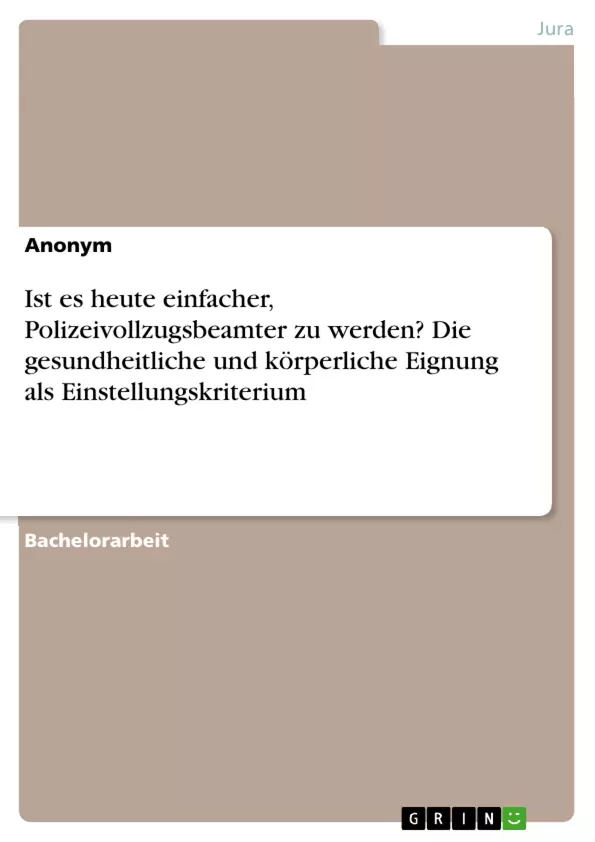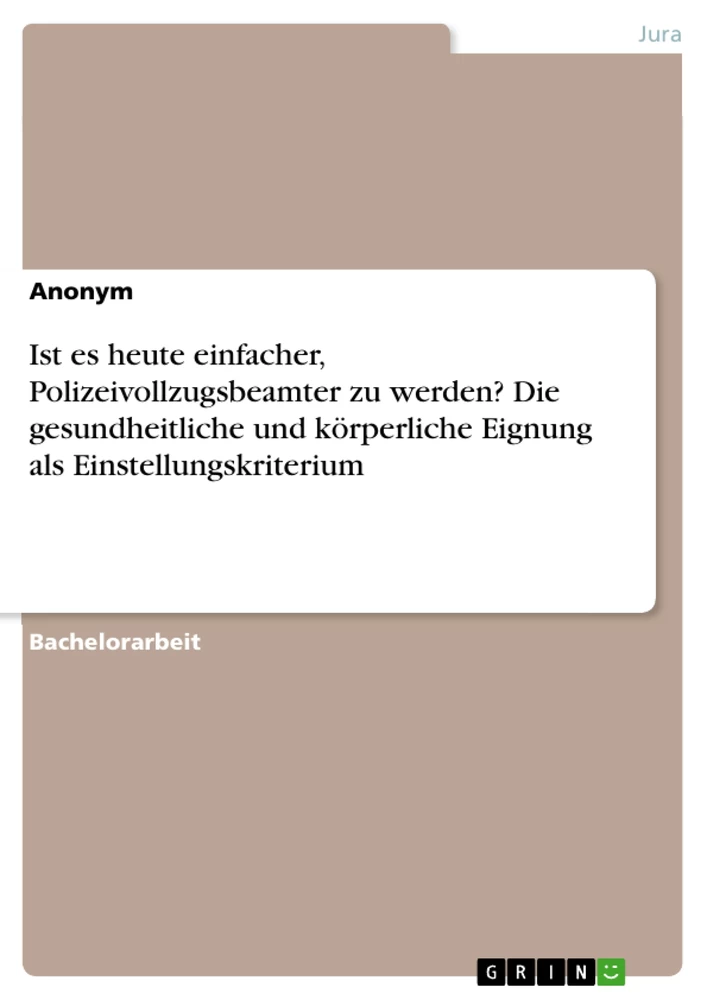
Ist es heute einfacher, Polizeivollzugsbeamter zu werden? Die gesundheitliche und körperliche Eignung als Einstellungskriterium
Bachelorarbeit, 2021
58 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Relevante Grundrechte
- Grundrecht auf Berufsfreiheit gem. Art. 12 I GG
- Grundrecht auf gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern gem. Art 33 II GG
- Grundrecht auf geschlechtliche Gleichbehandlung gem. Art. 3 II S. 1 und III S. 1 GG
- Grundrecht auf freie Entfaltung der Person gem. Art. 2 I GG
- Körperliche und gesundheitliche Eignungsmerkmale
- Grundzüge der PDV 300
- Körperliche Mindestgröße
- Aktuelle Einstellungspraxen bei den Polizeien der Bundesländer und der Bundespolizei
- Unterschiedliche Mindestkörpergrößen nach Geschlecht
- Unterschiedslose Mindestkörpergrößen
- Kritik am Urteil des OVG NRW zur Mindestkörpergröße
- Rechtsprechung aus anderen Bundesländern
- Tätowierungen
- Rechtsgrundlage in Nordrhein-Westfalen
- Großflächige Tätowierung im Sichtbereich
- Rechtmäßigkeit eines Verbotes von Tätowierungen bei einem existierenden formalen Parlamentsgesetz
- Kritik am gesetzlichen Verbot von Tätowierungen
- Body-Mass-Index
- Brustimplantate
- Humane-Immundefizienz-Virus (HIV)
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der körperlichen und gesundheitlichen Eignung als Einstellungskriterium im Polizeivollzugsdienst. Sie analysiert, wie sich diese Kriterien im Laufe der Zeit verändert haben und welche Auswirkungen diese Veränderungen auf Bewerber für den Polizeivollzugsdienst haben. Dabei werden die relevanten Grundrechte, die bei Einstellungsprozessen zu beachten sind, sowie die aktuelle Praxis der Einstellungsprozesse in den Bundesländern und bei der Bundespolizei beleuchtet.
- Grundrechtliche Rahmenbedingungen der Einstellungskriterien
- Veränderungen der Einstellungskriterien im Laufe der Zeit
- Aktuelle Praxis und Rechtsprechung in Bezug auf körperliche und gesundheitliche Eignungskriterien
- Kritik an aktuellen Einstellungskriterien
- Die Rolle der Polizeidienstverordnung (PDV) 300 bei der Festlegung von Eignungskriterien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas dar und gibt einen Überblick über die aktuelle Situation der Bewerbungsverfahren für den Polizeivollzugsdienst. Es wird auf den Bewerberrekord in Nordrhein-Westfalen und die Bedeutung der körperlichen und gesundheitlichen Eignung hingewiesen.
Kapitel 2 widmet sich den relevanten Grundrechten, die im Bewerbungsverfahren zu beachten sind. Dazu gehören das Grundrecht auf Berufsfreiheit, das Grundrecht auf gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern, das Grundrecht auf geschlechtliche Gleichbehandlung und das Grundrecht auf freie Entfaltung der Person.
Kapitel 3 befasst sich mit den körperlichen und gesundheitlichen Eignungsmerkmalen. Es werden die Grundzüge der Polizeidienstverordnung (PDV) 300 sowie die aktuellen Einstellungspraxen bei den Polizeien der Bundesländer und der Bundespolizei vorgestellt. Ein Schwerpunkt liegt auf der Diskussion um die Mindestkörpergröße und der damit verbundenen Rechtsprechung, sowie der rechtlichen Situation von Tätowierungen im Polizeivollzugsdienst. Weitere Themen sind der Body-Mass-Index, Brustimplantate und das Humane-Immundefizienz-Virus (HIV).
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf Themen wie die körperliche Eignung, gesundheitliche Eignung, Grundrechte, Einstellungskriterien, Polizeivollzugsdienst, Polizeidienstverordnung (PDV) 300, Mindestkörpergröße, Tätowierungen, Body-Mass-Index, Brustimplantate, HIV, Rechtsprechung, Bundesländer, Bundespolizei.
Details
- Titel
- Ist es heute einfacher, Polizeivollzugsbeamter zu werden? Die gesundheitliche und körperliche Eignung als Einstellungskriterium
- Note
- 1,0
- Autor
- Anonym (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2021
- Seiten
- 58
- Katalognummer
- V1307724
- ISBN (Buch)
- 9783346781567
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- gesundheitliche Eignung körperliche Eignung Polizeivollzugsdienst Eignung Polizei Bestenauslese Beamtentum
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2021, Ist es heute einfacher, Polizeivollzugsbeamter zu werden? Die gesundheitliche und körperliche Eignung als Einstellungskriterium, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1307724
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-