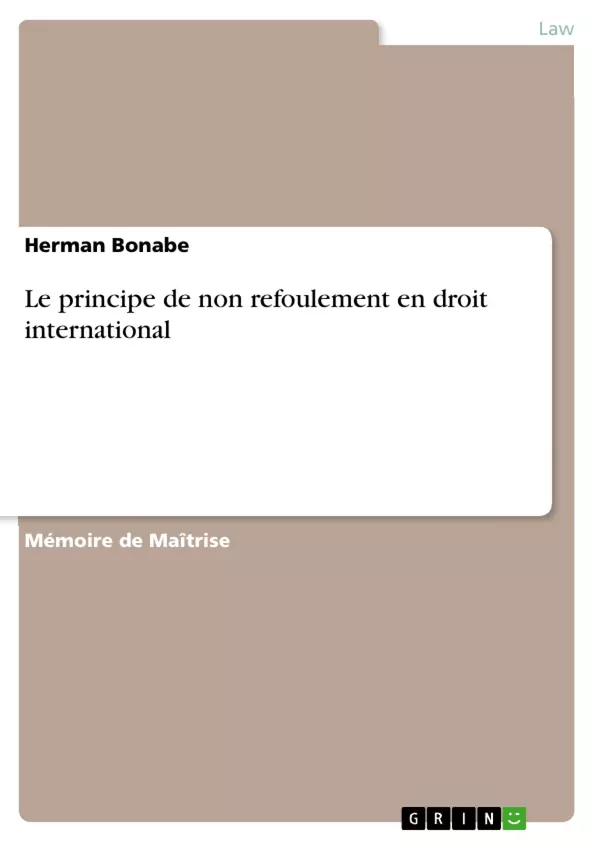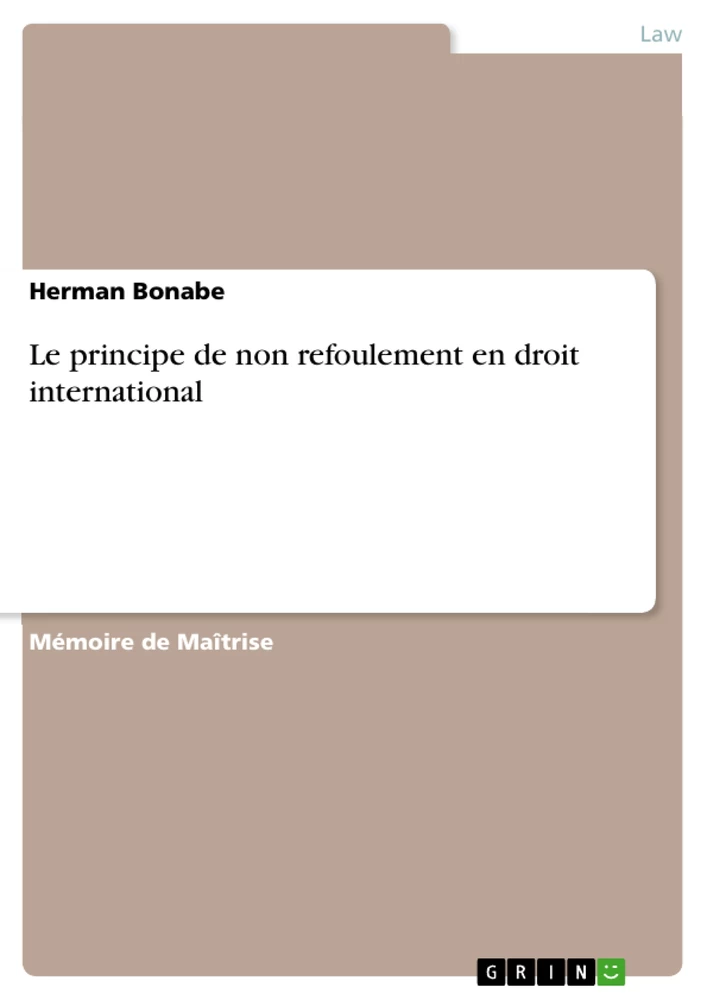
Le principe de non refoulement en droit international
Magisterarbeit, 2017
137 Seiten
Jura - Europarecht, Völkerrecht, Internationales Privatrecht
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Da der Ausgangstext kein Inhaltsverzeichnis enthält, wird hier eines basierend auf den erkennbaren Abschnitten erstellt.
- Einleitung
- Hauptteil
- Kapitel 1: Die Grundlagen des Non-Refoulement-Prinzips
- Kapitel 2: Herausforderungen für das Non-Refoulement-Prinzip im 21. Jahrhundert
- Kapitel 3: Reformansätze im Asylrecht
- Schlussfolgerung (nicht im Preview enthalten)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Prinzip des Non-Refoulement im internationalen Recht, insbesondere seine Herausforderungen im 21. Jahrhundert. Sie analysiert die historischen Grundlagen des Prinzips und beleuchtet die Faktoren, die seine effektive Umsetzung erschweren. Die Arbeit befasst sich auch mit aktuellen Reformdebatten im Asylrecht.
- Historische Entwicklung des Non-Refoulement-Prinzips
- Herausforderungen durch Terrorismus, Migration und Klimaflüchtlinge
- Restriktive Praktiken von Staaten bei der Anwendung des Prinzips
- Reformansätze im internationalen Asylrecht
- Die Bedeutung des Non-Refoulement-Prinzips für den Schutz von Flüchtlingen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Die Grundlagen des Non-Refoulement-Prinzips: Dieses Kapitel wird sich vermutlich mit der Entstehung und rechtlichen Grundlage des Non-Refoulement-Prinzips befassen, seine Verankerung in internationalen Verträgen und Übereinkommen untersuchen und seine Bedeutung für den Schutz von Flüchtlingen herausstellen. Es wird wahrscheinlich auf die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 und deren Artikel 33 eingehen, der das Prinzip explizit formuliert. Die historischen und politischen Kontexte der Entstehung des Prinzips werden ebenfalls beleuchtet werden, wahrscheinlich mit Bezug auf die Erfahrungen nach den Weltkriegen.
Kapitel 2: Herausforderungen für das Non-Refoulement-Prinzip im 21. Jahrhundert: Dieses Kapitel wird sich voraussichtlich mit den aktuellen Herausforderungen befassen, denen das Non-Refoulement-Prinzip im 21. Jahrhundert gegenübersteht. Es wird wahrscheinlich den Einfluss von Terrorismus, zunehmende Migrationsströme und den Klimawandel als neue Herausforderungen für die Anwendung des Prinzips analysieren. Der Fokus wird wahrscheinlich auf den Schwierigkeiten liegen, die Staaten bei der Umsetzung des Prinzips in der Praxis haben, und wie diese Schwierigkeiten mit den genannten Faktoren zusammenhängen. Konkrete Beispiele für staatliche Restriktionen und ihre Rechtfertigung könnten ebenfalls analysiert werden.
Kapitel 3: Reformansätze im Asylrecht: Dieses Kapitel wird sich mit den aktuellen Debatten und Vorschlägen zur Reform des Asylrechts und zur Stärkung des Non-Refoulement-Prinzips befassen. Es wird wahrscheinlich verschiedene Ansätze und Vorschläge zur Verbesserung der Umsetzung des Prinzips untersuchen. Es könnte auch philosophische und juristische Diskussionen über die Möglichkeiten und Grenzen von Reformen im Asylrecht analysieren. Der Fokus wird wahrscheinlich auf der Suche nach Lösungen zur Bewältigung der Herausforderungen liegen, die im vorherigen Kapitel dargelegt wurden, um einen wirksameren Schutz von Flüchtlingen zu gewährleisten.
Schlüsselwörter
Non-Refoulement, Flüchtlingsrecht, internationales Recht, Asylrecht, Genfer Flüchtlingskonvention, Menschenrechte, Terrorismus, Migration, Klimaflüchtlinge, Staatenpraxis, Reformansätze, humanitärer Schutz.
Häufig gestellte Fragen zum Vorschautext: Non-Refoulement-Prinzip im 21. Jahrhundert
Was ist der Inhalt dieses Vorschautextes?
Der Vorschautext bietet einen umfassenden Überblick über eine wissenschaftliche Arbeit zum Non-Refoulement-Prinzip im internationalen Recht. Er enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und die wichtigsten Themen, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Stichwortverzeichnis. Der Fokus liegt auf den Herausforderungen des Prinzips im 21. Jahrhundert und möglichen Reformansätzen im Asylrecht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit besteht aus (mindestens) drei Kapiteln: Kapitel 1 behandelt die Grundlagen des Non-Refoulement-Prinzips, Kapitel 2 analysiert die Herausforderungen im 21. Jahrhundert (Terrorismus, Migration, Klimaflüchtlinge etc.), und Kapitel 3 befasst sich mit Reformansätzen im Asylrecht.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Non-Refoulement-Prinzip, seine historischen Grundlagen und die Faktoren, die seine effektive Umsetzung erschweren. Ein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Herausforderungen und Reformdebatten im Asylrecht.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt unter anderem die historische Entwicklung des Prinzips, Herausforderungen durch Terrorismus, Migration und Klimaflüchtlinge, restriktive staatliche Praktiken, Reformansätze im internationalen Asylrecht und die Bedeutung des Prinzips für den Schutz von Flüchtlingen.
Was ist im Kapitel 1 über die Grundlagen des Non-Refoulement-Prinzips zu erwarten?
Kapitel 1 beleuchtet die Entstehung und rechtliche Grundlage des Prinzips, seine Verankerung in internationalen Verträgen (insbesondere Artikel 33 der Genfer Flüchtlingskonvention), seine Bedeutung für den Schutz von Flüchtlingen und den historischen Kontext seiner Entstehung.
Worauf konzentriert sich Kapitel 2 zu den Herausforderungen des Non-Refoulement-Prinzips?
Kapitel 2 analysiert die aktuellen Herausforderungen, wie den Einfluss von Terrorismus, zunehmende Migrationsströme und den Klimawandel auf die Anwendung des Prinzips. Es untersucht die Schwierigkeiten bei der praktischen Umsetzung und mögliche staatliche Restriktionen.
Was wird in Kapitel 3 über Reformansätze im Asylrecht behandelt?
Kapitel 3 befasst sich mit Debatten und Vorschlägen zur Reform des Asylrechts und zur Stärkung des Non-Refoulement-Prinzips. Es untersucht verschiedene Ansätze zur Verbesserung der Umsetzung und analysiert philosophische und juristische Diskussionen zu Möglichkeiten und Grenzen von Reformen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Non-Refoulement, Flüchtlingsrecht, internationales Recht, Asylrecht, Genfer Flüchtlingskonvention, Menschenrechte, Terrorismus, Migration, Klimaflüchtlinge, Staatenpraxis, Reformansätze, humanitärer Schutz.
Gibt es eine Schlussfolgerung?
Der Vorschautext enthält keine Zusammenfassung der Schlussfolgerung. Diese wird vermutlich im vollständigen Text enthalten sein.
Details
- Titel
- Le principe de non refoulement en droit international
- Hochschule
- Université de Maroua, Cameroun
- Autor
- Herman Bonabe (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2017
- Seiten
- 137
- Katalognummer
- V1309074
- Sprache
- Französisch
- Schlagworte
- Principe de non refoulement Droit International réfugiés asile demandeur d'asile
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Arbeit zitieren
- Herman Bonabe (Autor:in), 2017, Le principe de non refoulement en droit international, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1309074
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-