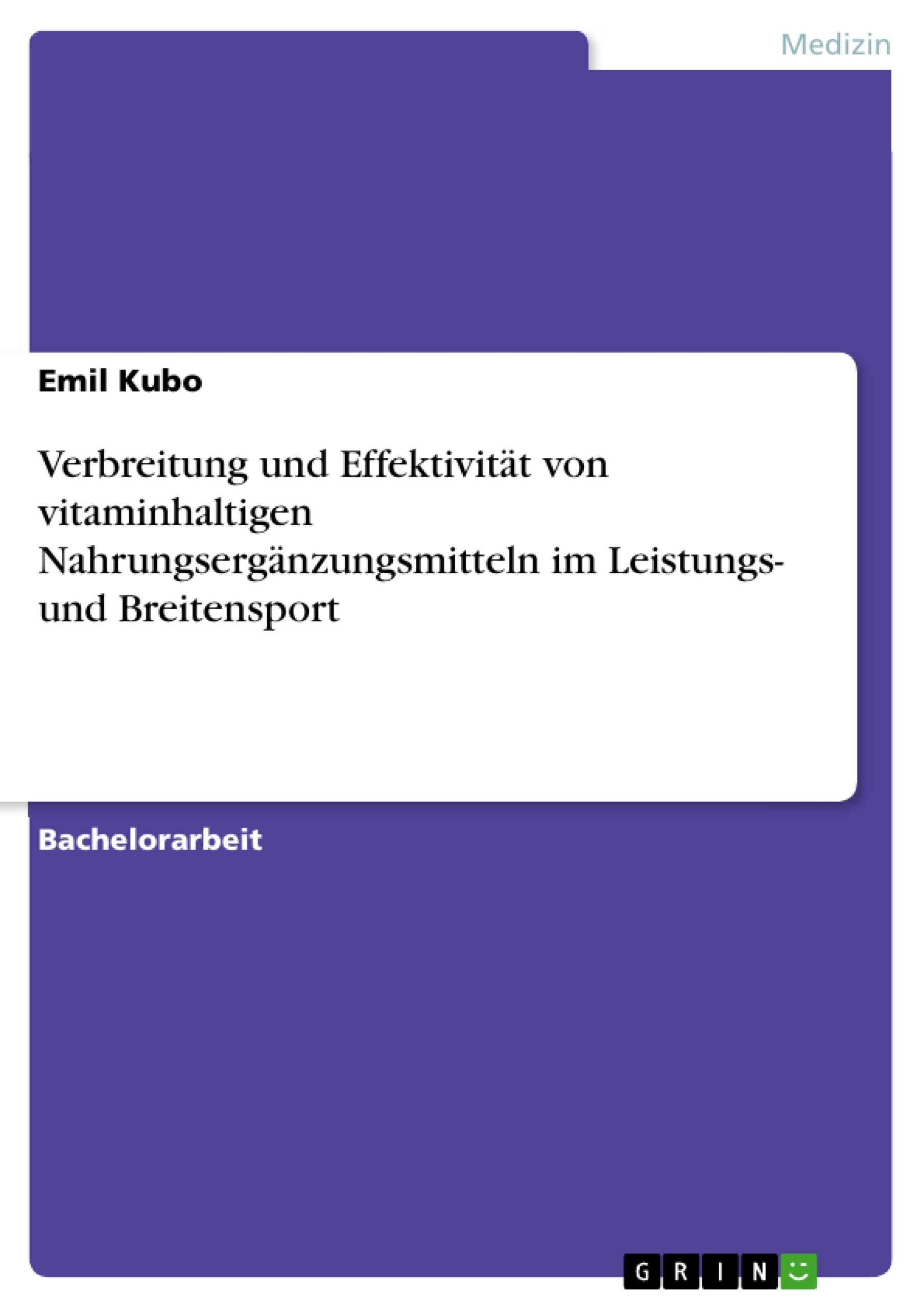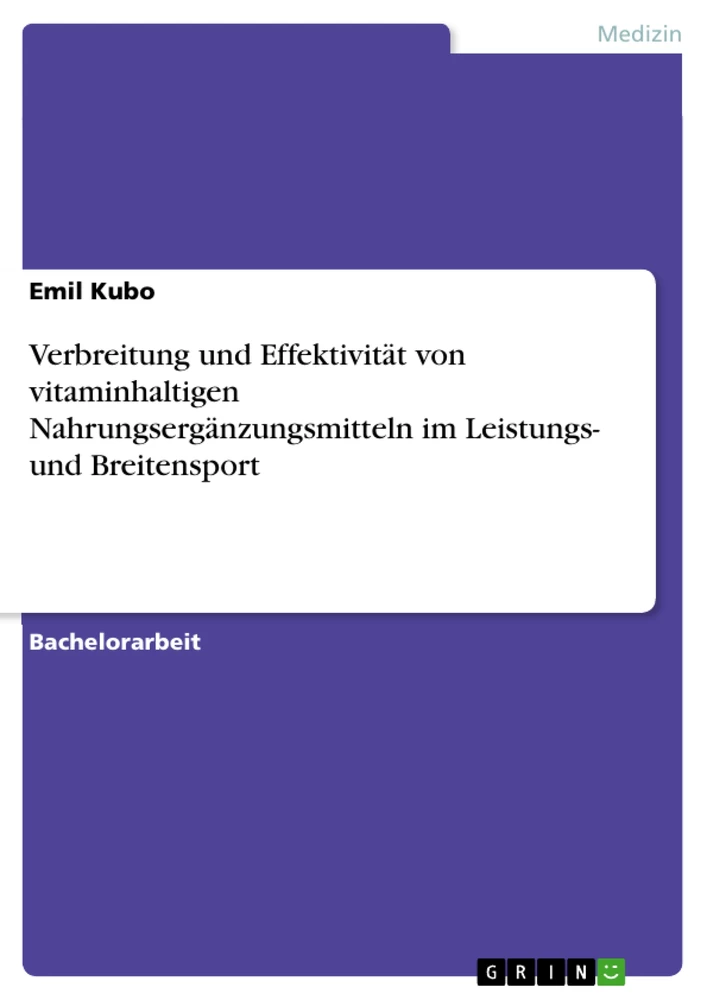
Verbreitung und Effektivität von vitaminhaltigen Nahrungsergänzungsmitteln im Leistungs- und Breitensport
Bachelorarbeit, 2021
78 Seiten, Note: 1,6
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
INHALTSVERZEICHNIS
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS II
TABELLENVERZEICHNIS III
ABBILDUNGSVERZEICHNIS IIII
1. EINLEITUNG
1.1 Definition Nahrungsergänzungsmittel
1.2 Verbreitung Nahrungsergänzungsmittel
1.3 Gründe für die Nutzung von Nahrungsergänzungsmitteln
1.4 Risiken Nahrungsergänzungsmittel
2. METHODIK
2.1 Definition Leistungs- und Breitensport
2.2 Literaturrecherche
2.3 Übersicht Suchbegriffe
2.4 Übersicht über die ursprünglich eingeschlossenen Literatur
3. ERGEBNISSE
3.1 Vitamin D
3.1.2 Vitamin D Mangel
3.1.3 Optimale Konzentrationen
3.1.4 Einfluss von Vitamin D aufdie Leistungsfähigkeit
3.1.5 Enzündungshemmende Wirkung
3.1.6 Eisenstoffwechsel
3.1.7 Ausdauer
3.1.8 Muskelkraft
3.1.9 Infektion der Oberen Atemwege
3.2 Vitamine
3.3 Vitamin C
3.4 Plasmakonzentrationen nach Supplementierung
3.5 Einfluss von Vitamin C+E auf die Leistungsfähigkeit
3.6 Alleinige Vitamin-C-Supplementation
4. INTERPRETATION UND DISKUSSION
4.1 Diskussion der Methode
4.2 Limitationen derstudie
5. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
5.1 FAZIT
6. LITERATURVERZEICHNIS
Abkürzungsverzeichnis II :
1D = 1. exzentrisches Training
2D = 2. exzentrisches Training
1RM = One Repetition Max
2D = 2. exzentrisch belastetes Training
AA = Ascorbinsäure
CK = Kreatinkinase
deg/s = degree per second
DOMS = Delayed Onset Muscle Soreness
ESC = Endocrine Society Committee
FFMI = Fettfreier Masse Index
FMI = Fett Masse Index
FPN = Ferroportin
FSA = Food Standards Agency
GSH = reduziertes Glutathion
GSSG = oxidiertes Glutathion
HPLC = Hochleistungsflüssigkeitschromatographie
hs-CRP = hochsensitives C-reaktives Protein
IE = Internationale Einheit
IFN-c = Interferon-c
IgA = Immunglobulin A
IL-12 = Interleukin-12
IL-1b = Interleukin-1Beta
IL-2 = Interleukin-2
IL-6 = Interleukin 6
IL-8 = Interleukin-8
IOM = Institute of Medicine, seit 2015 umbenannt in National Academy of Medicine
LDH = Laktatdehydrogenase
MB = Myoglobin
MDA = Plasma-Malondialdehyd
MeSH = Medical Subject Headings
MET = metabolisches Äquivalent
mRNA = messenger-RNA
mVDR = Membranständiger-Vitamin-D-Rezeptor
NADA = Nationale Anti-Doping Agentur Deutschland
NEM = Nahrungsergänzungsmittel
ng/ml = Nanogrammn pro Milliliter
NHANES = National Health and Nutrition Examination Survey
nmol/l = Nanomol pro Liter
NSF = National Sanitation Foundation
nVDR = Nuklearer Vitamin-D-Rezeptor
PLR = Thrombozyten-Lymphozyten-Verhältnis
RCT = Randomisierte kontrollierte Studie
RONS = Reaktive Sauerstoff- und Stickstoffspezies
ROS = Reaktive Sauerstoffspezies
SACN = Scientific Advisory Committee on Nutrition
SIgA-SR = Immunglobulin-A-Sekretion
sIgA = sekretorisches Immunglobulin
SOD = Superoxiddismutase
TFAM = Mitochondrialer Transkriptionsfaktor A
Th1 = T-Helfer-1-Zellen
Th2 = T-Helfer-2-Zellen
TKD-Athleten= Taekwando-Athleten
TNF-a = Tumornekrosefaktor-alpha
Ug = Mikrogramm
URTI = Infektion der Oberen Atemwege
VDR = Vitamin-D-Rezeptoren
VO2max = maximale Sauerstoffaufnahme
WBK = weiße Blutkörperchen
Wmax = maximale Leistung
Tabellenverzeichnis III:
Tabelle1: Definition von Leistungs- und Breitensport (http://www.sportunterricht.de/lksport/gesell3.html)
Tabelle 2: Übersicht der für die Literaturrecherche verwendeten Suchbegriffe
Tabelle 3: Übersicht der durch die ursprüngliche Literaturrecherche eingeschlossenen Literatur .
Abbildungsverzeichnis IIII:
Abbildung 1 : Flowchart der gesamten Literaturcherche (angelehnt an das PRISMA 2020 flow diagram for new systematic reviews which included searches of databases and registers only) (http://www.prisma-statement.org/PRISMAStatement/FlowDiagram.aspx)
Abstract:
Nutrition is an important component of athletic performance for both competitive and amateur athletes. Food supplements can make a small additional contribution to nutrition. The use of dietary supplements in sport has been high for several years and current data suggest that this trend will continue. Vitamins target different aspects such as replenishing respective vitamin concentrations, thus providing direct benefits for performance or indirect benefits such as recovery or prevention of injury/infection. In this systematic literature review the focus is on vitamins C, D and E, which are among the most commonly used supplements by athletes to support their diet. This work will examine how common vitamins are in competitive and recreational sports and how effective they are in directly or indirectly improving performance. In addition, the risks of dietary supplements will also be highlighted, such as the accidental ingestion of substances banned for elite sport according to the anti-doping code. The work is intended to serve athletes, coaches and other staff to decide whether vitamins as supplements are useful given that the reasons for using them and their actual effects are often diametrically opposed. This work also attempts to make it clear to athletes that the reasons for use and the effect should form an intersection. Awareness of possible negative consequences and protection of the athlete's health must come first. Before an athlete starts taking vitamins both an expert professional opinion and a check to find out whether there is even a deficiency in the vitamin status are strongly recommended.
1. Einleitung
Nahrungsergänzungsmittel (NEM) sind im Sport weit verbreitet. Ihr Konsum hat in den letzten Jahren konstant zugenommen. Diese Arbeit soll Sportlern ermöglichen, sich eine Übersicht arüber zu verschaffen, welche Vitamine möglicherweise sinnvoll sein können, um ihre Leistungsfähigkeit zu beeinflussen. Die Athleten können augrunddessen eine Entscheidung auf der Grundlage von Wissen treffen und nicht aufgrund der Informationen von Herstellern und Einzelpersonen innerhalb der Sportgemeinschaft, die möglicherweise ein persönliches Interesse an deren erhöhtem NEM-Konsum haben. Es gibt zu NEM bereits einige Literatur. Dies ist sicher auf den gestigenen Konsum zurückzuführen. Eine aktuelle Literaturrecherche zur Effektivität von Vitaminen wurde in der vorherigen Recherche nicht gefunden und Übersichtsarbeiten zu Vitaminen oder NEM beziehen sich häufig auf alte Studien, die vor dem Jahr 2000 durchgeführt wurden. Im theoretischen Teil soll die Frage geklärt werden was konkret als NEM definiert wird. Außerdem wie häufig und aus welchen Gründen NEM genutzt werden sowie, ob potentielle Risiken des Konsums existieren. Mit der Literaturrecherche nach Cochrane soll dann anschließend systematisch überprüft werden, wie effektiv die einzelnen Vitamine (Vitamin D, C und E) zur Leistungssteigerung sind und für welche Sportler, die Nutzung am sinnvollsten sein könnte. Die konkrete Fragestellung der Arbeitet lautet: „Wie effektiv sind Vitamine zur Steigerung der sportlichen Leistungsfähigkeit im Leis- tungs- und Breitensport? Unter die sportliche Leistungsfähigkeit fällt ebenso die Regeneration, welche mit einigen Vitaminen möglicherweise auch beeinflusst werden kann.
1.1 Definition Nahrungsergänzungsmittel
Zuallererst gilt es zu klären, was unter einem Nahrungsergänzungsmittel verstanden wird. Die Verordnung über Nahrungsergänzungsmittel aus dem Jahr 2004 (LMSVG BGBl. I Nr. 13/2006) liefert dazu nähere Erklärungen und beschreibt ein Nahrungsergänzungsmittel als ein Lebensmittel, das:
1. „dazu bestimmt ist, die allgemeine Ernährung zu ergänzen“
2. „ein Konzentrat von Nährstoffen oder sonstigen Stoffen mit ernährungsspezifischer oder physiologischer Wirkung allein oder in Zusammensetzung darstellt“
3. „in dosierter Form, insbesondere in Form von Kapseln, Pastillen, Tabletten, Pillen und anderen ähnlichen Darreichungsformen, Pulverbeuteln, Flüssigampullen, Flaschen mit Tropfeinsätzen und ähnlichen Darreichungsformen von Flüssigkeiten und Pulvern zur Aufnahme in abgemessenen kleinen Mengen, in den Verkehr gebracht wird“
Insgesamt lässt sich festhalten, dass Nahrungsergänzungsmittel Nährstoffe in konzentrierter Form liefern und häufig oral mit Wasser eingenommen werden. Die Inhaltsstoffe werden somit über den Magen-Darm-Trakt in den Blutkreislauf weitergegeben.
Der Nährstoffbedarf erhöht sich durch sportliches Training, da Nährstoffe vor allem unter Belastung in größerem Umfang verbraucht werden. Zusätzlich leidet die sportliche Leistungsfähigkeit, wenn ein Mangel an Nährstoffen vorliegt, da die physiologischen Abläufe im Körper von einer ausreichenden Zufuhr an Nährstoffen abhängig sind. Mit einer sportlergerechten Ernährung lassen sich theoretisch alle wichtigen Nährstoffe abdecken. Allerdings gibt es Ausnahmen, wie z.B. Vegetarier oder Veganer, die über ihre Ernährung beispielweise bestimmte Nahrungsmittel in größeren Mengen aufnehmen sollten. Deswegen müssen sie über ein fundiertes Wissen verfügen, damit sie z.B. nicht unter Vitamin-B12 oder Eisenmangel leiden. Ein anderes Beispiel sind Boxer, die sich vor Kämpfen teilweise unterkalorisch ernähren müssen, sodass sie das geforderte Gewicht erreichen. Sie können deshalb auf NEM angewiesen sein, um auch unterkalorisch alle wichtigen Nährstoffe abzudecken.
Bei Leistungssportlern gibt es leider wenige Studien, welche kritische Konzentrationen von Mikronährstoffen bei diesen Probanden beleuchten. Faude, Fuhrmann, Herrmann, Kindermann und Urhausen wiesen (2005) nach, dass Kaderathleten die Referenzwerte der deutschen, österreichischen und schweizerischen Fachgesellschaften für Ernährung bei Vitamin D, Folat und Jod nicht erreichten. Allerdings stellt diese Mangelversorgung ein allgemeines Problem dar, da die Referenzwerte auch in der Allgemeinbevölkerung meist nicht erreicht werden (Faude et al., 2005).
Es gilt außerdem Arzneimittel und NEM zu unterscheiden, da sie häufig fälschlicherweise in die gleiche Kategorie fallen. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit stellt vor allem folgende Unterschiede in den Vordergrund: Erstens fallen NEM unter das Lebensmittelrecht während für Arzneimittel das Arzneimittelrecht gilt. Außerdem helfen NEM im Gegensatz zu Medikamenten nicht bei Krankheiten, sondern dienen nur als Ergänzung zur Ernährung. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass bei NEM kein behördlicher Vorabnachweis der Wirksamkeit oder Sicherheit erforderlich ist, sondern lediglich der Hersteller für die Sicherheit haftet. Für Arzneimittel muss dagegen in aufwändigen und langwierigen Zulassungsverfahren die Wirksamkeit und Sicherheit der Arzneimittel belegt werden. Zusätzlich dürfen die Mengenangaben auf der Verpackung von NEM um bis zu 50% von der tatsächlichen Menge im Produkt abweichen und es gibt keine Höchstmengen für Inhaltsstoffe. Die einzige Ausnahme stellen technologische Zusatzstoffe dar, also Stoffe, die aus technologischen Gründen zugesetzt werden, wie z.B. Konservierungsmittel, Bindemittel, Emulgatoren, Antioxidationsmittel, Silierzusatzstoffe. Allerdings gelten strikte Regeln bezüglich der Kennzeichnung der enthaltenen Inhaltsstoffe, der Menge und der empfohlenen Tagesdosis. Hinzu kommen Warnhinweise, die darüber aufklären, dass die empfohlene Tagesdosis nicht überschritten werden soll und, dass NEM keinesfalls einen Ersatz für eine ausgewogene Ernährung darstellen (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit Nahrungsergänzungsmittel vs Arzneimittel).
1.2 Verbreitung von NEM
Nahrungsergänzungsmittel (NEM) sind im Sport weit verbreitet. Die Häufigkeit der Nutzung hat in den letzten Jahren konstant zugenommen. So gaben beispielsweise bereits bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney 79 % der knapp 2800 Athleten an, dass sie Nahrungsergänzungsmittel und Medikamente zu sich nehmen. Von den Athleten konsumierten 51 % Vitamine, 21 % Mineralstoffe, 12,5 % Aminosäuren und 22,5 % andere Nahrungsergänzungsmittel (Corrigan & Kazlaukas, 2003). Auch deutsche Nachwuchsathleten benutzten häufig Nahrungsergänzungsmittel. Von 164 deutschen Nachwuchsathleten gaben 80 % an, Nahrungsergänzungsmittel einmal im Monat zu sich zu nehmen. Zusätzlich zeigte sich, dass Nahrungsergänzungsmittel häufiger bei der Altersgruppe der über 18-jährigen genutzt werden. Außerdem stieg der Einsatz auch, je höher der Kaderstatus der Athleten war. Hierbei zeigte sich, dass alle der A und B Kaderathleten, 72 % der C Kaderathleten, 79 % der D/C Kaderathleten und 81 % der D Kaderathleten Nahrungsergänzungsmittel nutzen (Braun et al., 2009). Nicht ganz so hoch war der Einsatz von Nahrungsergänzungsmitteln bei Nachwuchsathleten zwischen 12- 21 Jahren in England. Hier gab lediglich etwas die Hälfte der 403 Athleten an, einmalig Nahrungsergänzungsmittel konsumiert zu haben (Petroczi et al., 2008). Die meisten Studien kommen zu dem Ergebnis, dass mehr als 50 % der Sportler NEM nutzen. Diesen Wert bestätigten auch Sundgot-Borgen & Berglund & Torstveit (2003) in ihrer Studie.
Wie weit verbreitet und nachgefragt Nahrungsergänzungsmittel nicht nur im Leistungssport, sondern auch in der allgemeinen Bevölkerung sind, zeigt sich auch im Consumer Report der IQVIA von 2020. In diesem wurde erfasst, dass der Umsatz in den letzten 5 Jahren jährlich um durchschnittlich 6 % stieg und 2019 einen Wert von 2,2 Milliarden Euro zu effektiven Verkaufspreisen erreichte. Im ersten Quartal 2020 stieg der Umsatz sogar um 8%, was eventuell auch mit der Corona Pandemie zusammenhängt. Zur Verteilung der Nahrungsergänzungsmittel lässt sich festhalten, dass im Jahr 2019 51 % des Umsatzes auf Vitamine & Mineralstoffe zurückzuführen waren. Zu dieser Gruppe zählen auch CBD-haltige Nahrungsergänzungsmittel die sehr im Trend liegen und mittlerweile in verschiedensten Darreichungsformen angeboten werden. Von den insgesamt 51 % der Vitamine und Mineralstoffe fällt der größte Teil auf Magnesiumpräparate, mit einem Anteil von 19 %, zurück. Der Trend des steigenden Konsums von NEM scheint sich weiter fortzusetzen. Die Thematik ist also weiterhin relevant und bleibt aktuell.
Deswegen soll diese Thematik in dieser Bachelorarbeit genauer untersucht werden.
Da nicht alle NEM detailliert betrachtet werden können, weil dies den Rahmen einer Bachelorarbeit sprengen würde, liegt der Fokus auf den Vitaminen. In dem umfassenden Review von Kersick et al. aus dem Jahr 2018 werden Vitamine, wie folgt definiert: „Vitamins are essential organic compounds that serve to regulate metabolic and neurological processes, energy synthesis, and prevent destruction of cells“ zu deutsch: Vitamine sind essentielle organische Verbindungen, die der Regulierung metabolischer und neurologischer Prozesse, der Energiesynthese und der Verhinderung der Zerstörung von Zellen dienen. Vitamine können in zwei Gruppen unterteilt werden: in fettlösliche Vitamine und in wasserlösliche. Zu den Fettlöslichen gehören Vitamin A, D, E und K. Diese Vitamine werden in unterschiedlichen Gewebearten gespeichert. Bei übermäßigem Konsum kann das zu Toxizität führen. Im Gegensatz dazu stehen die wasserlösliche Vitamine, welchen den gesamten Vitamin-B-Komplex umfassen (B1 Thiamin, B2 Riboflavin, B3 Niacin/Nikotinsäure, B5 Panthothensäure, B6 Pyridoxin, B7 Biotin, B9 Folsäure, B12 Cobalamin) und Vitamin C. Da diese wasserlöslich sind wird eine übermäßige Zufuhr von Vitamin B und/oder C mit dem Urin ausgeschieden (ausgenommen B6, bei dem es durch einen übermäßigen Konsum zu peripheren Nervenschäden kommen kann) (Kersick et al., 2018). Sowohl fettlösliche Vitamine (D und E), als auch wasserlösliche (C) sollen im Hinblick auf ihre Effektivität zur Leistungssteigerung beleuchtet werden.
Dass NEM insgesamt häufig genutzt werden ist unumstritten. Interessant ist auch zu prüfen, welche Supplemente am beliebtesten sind. Vitamine gehören bei Sportlern zu den beliebtesten NEM. So supplementierten von 1620 Kaderathleten aus Norwegen 70 % der Athleten und 80 % der Athletinnen mit Vitaminen (Sundgot-Borgen et al., 2003). Ähnlich sah es bei den Kaderathleten*innen aus Litauen aus, die für die Olympischen Spiele trainierten. Drei Viertel der Spitzensportler*innen aus Litauen wurden untersucht. Von Ihnen gaben 81,3 % an, Vitamine zu sich zu nehmen (Baranauskas & Jablonskiene & Abaravicius & Stukas, 2020). Auch unter 329 Probanden (180 Männer, 149 Frauen, Alter 30,6 ± 12,1 Jahre) aus elf zufällig ausgewählten Fitnesscentern in Griechenland lag der Anteil der Breitenportler die zu NEM griffen bei 41 %, von denen die Hälfte Vitamine nutzte (Tsitsimpikou et al., 2011). Noch deutlichere Ergebnisse lieferte eine andere deskriptive Querschnittsanalyse unter 564 männlichen Fitnesstudio- Mitgliedern. Dabei kam heraus, dass 72 % Nahrungsergänzungsmittel verwendeten, davon 46,81 % täglich, während 25 % der Teilnehmer gelegentlich Nahrungsergänzungsmittel konsumierten (Causevic, Ormanovic, Doder, Covic, 2017). Nicht nur Fitnessstudiomitgliedern nutzen Supplemente, sondern auch 889 Studenten aus Kasachstan von denen 526 Studenten angaben, regelmäßig körperlich aktiv zu sein. 31 % aller regelmäßig trainierenden Männer und 27 % aller regelmäßig trainierenden Frauen nutzten Supplemente. 78 % verwendeten nur ein Supplement, während 22 % zwei oder mehr Supplemente konsumierten. Die Prävalenz war beim Vergleich der Aktivitätsarten fast gleich verteilt und reichte von 35 % beim Radfahren bis zu 55 % beim Schwimmen. Vitamine waren die am häufigsten verwendeten Supplemente bei den befragten Studenten (Vinnikov, Romanova, Dushpanova, Abstarova, Utepbergenova, 2018). Knapik und Kollegen fanden 2016 in ihrer Meta-Analyse heraus, dass Elite-Athleten dazu tendierten, Nahrungsergänzungsmittel in größerem Umfang zu verwenden, als Nicht-EliteAthleten. Allerdings merkten die Autoren an, dass die Prävalenzbereiche zwischen den Studien sehr groß waren, was wiederum eine geringe Homogenität vermuten lässt. Außerdem deutet ein Vergleich der Daten darauf hin, dass die Prävalenz der Einnahme von Vitaminen/Mineralien und Multivitaminen/Multimineralien bei den Sportlern etwas höher und die von Vitamin C viel höher war als allgemein in der US-Bevölkerung (Knapik et al., 2016). Eine der in die Meta-Analyse eingeschlossenen Studien ergab laut einer Umfrage des „National Health and Nutrition Survey Institute“, dass bei einer Stichprobe von 3364 Männern und Frauen aus der Bevölkerung in den USA 42 % der Männer und 54 % der Frauen Vitamine/Mineralien im zurückliegenden Monat genutzt hatten (Kennedy, Luo, Houser, 2013). Leistungssportler greifen eventuell noch häufiger zu Supplementen, da meist nur ein kleiner Leistungsvorteil über Sieg und Niederlage entscheidet - und die Sportler sich erhoffen, durch die Supplemente diesen Vorsprung vor der Konkurrenz zu erlangen. Ein anderer Grund könnte darin bestehen, dass sie sich durch die Supplementierung eine Vorbeugung vor Verletzungen oder Krankheiten erhoffen. Die Prävalenz der Nutzung von NEM ist also bereits seit mehreren Jahren sowohl unter Leistungssportlern als auch unter Breitensportlern hoch - und der Trend scheint sich weiterhin zu verstärken. Maughan et al. schlussfolgerten (2018) in einem umfangreichen Statement des Internationales Olympisches Komitee (IOC), dass die Nutzung von NEM: über verschiedene Sportarten und Aktivitäten variiert, mit dem Trainings- /Leistungsniveau steigt, mit dem Alter zunimmt, bei Männern höher als bei Frauen ist und stark von wahrgenommenen kulturellen Normen beeinflusst wird (sowohl sportlich als auch nichtsportlich). Diese Schlussfolgerung wird von den meisten vorliegenden Daten unterstützt.
1.3 Gründe für die Nutzung von NEM
Die Nutzer von NEM geben verschiedene Gründe für die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln an, die sich jedoch oft stark von den spezifischen Verwendungszwecken der Supplemente unterscheiden (Garthe & Maughan, 2017). Diese Entscheidungen beruhen häufiger auf unbegründeten Überzeugungen, als auf einem wissenschaftlichen Verständnis. In der Allgemeinbevölkerung wird der Konsum von Nahrungsergänzungsmitteln oft durch den Glauben angetrieben, sie hätten einen gesundheitlichen Nutzen der über den durch den Verzehr normaler Lebensmittel hinausgeht (Reinert, Rohrmann, Becker, Linseisen, 2007). Von norwegischen Athleten und Athletinnen gaben mehr als die Hälfte als Grund für die Nutzung von NEM an, dass sie diese als Ergänzung zu nutzen. Über ein Viertel der Athleten wollte, ihre Leistungsfähigkeit durch die Supplemente verbessern. Die Athletinnen nannten die Steigerung der Leistungsfähigkeit mit 12 % deutlich seltener als Grund (Sundgot-Borgen et al., 2003). Als Gründe für die Verwendung von Nahrungsergänzungsmitteln unter 310 Teilnehmern der Leichtathletik-Weltmeisterschaften wurden folgende genannt: Unterstützung der Erholung vom Training (71 %), Gesundheit (52 %), Leistungssteigerung (46 %), Vorbeugung oder Behandlung einer Krankheit (40 %) und Ausgleich einer schlechten Ernährung (29 %) (Maughan, Despiesse, Geyer, 2007). Es herrscht, wie bereits erwähnt häufig auch ein Widerspruch zwischen den Gründen für die Einnahme und den propagier- ten/tatsächlichen Effekten der Einnahme. So gaben 78 % der 11-25 jährigen kanadischen Athleten an, dass NEM nicht für den sportlichen Erfolg notwendig seien und trotzdem nutzte die Hälfte dieser Gruppe NEM, was laut den Autoren mit dem teilweise jungen Alter der Probanden zusammenhängen könnte (Parnell & Wiens & Erdman, 2015). Die kanadischen Athleten führten alle pro Woche mindestens fünf Stunden ein strukturiertes Training durch und drei Viertel traten auf Provinzebene an, während der Rest auf nationaler oder internationaler Ebene aktiv war. Insgesamt gaben 81 % der kanadischen Athleten an, aus Gründen der Leistungssteigerung zu Supplementen zu greifen, wobei Vitamine mit allen leistungssteigernden Effekten (außer der Erholung) in Verbindung gebracht wurden. Als leistungssteigernde Effekte waren in der Studie folgende definiert: Muskelmasse/Kraft, Ausdauer, erhöhte Energie, die allgemeine athletische Leistung und die Erholung. Das Wissen der Athleten über die Gründe für die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln ist nach deren Selbsteinschätzung im allgemeinen gering, steigt jedoch mit zunehmendem Alter. Über die Hälfte der 19-25 jährigen kanadischen Athleten gab an, die Gründe für die NEM, die sie einnehmen, zu kennen (Parnell et al., 2015). Die hohe Prävalenz, das teilweise unzureichende Wissen über die Verwendung und deren Nutzen legt nahe, dass Forschung und Aufklärung in diesem Bereich unerlässlich sind, um ein sicheres und effektives Nutzungsverhalten von NEM zu gewährleisten und zwischen den Angaben der Hersteller oder anderen Personen und dem tatsächlich zu erwartenden Effekt unterscheiden zu können.
1.4 Risiken NEM
Vor der Supplementierung mit NEM sollten sich Athleten als erstes fragen, ob die Ergänzung legal und sicher ist. Einige Sportverbände haben die Verwendung verschiedener Nahrungsergänzungsmittel (z.B. Prohormone und Ephedra) verboten. Viele professionelle Sportorganisationen haben jetzt in ihre Tarifverträge geschrieben, dass die vom Team zur Verfügung gestellten Produkte von der National Sanitation Foundation (NSF) als sicher für den Sport zertifiziert sein müssen (Kersick et al., 2018). Wenn das Supplement verboten ist, sollte der Sporternährungsspezialist/Trainer natürlich von der Verwendung abraten. Speziell für Spitzensportler können NEM auch ein erhöhtes Risiko darstellen. Zum einen werden NEM, wie in der Definition bereits erwähnt, als Lebensmittel deklariert und unterliegen daher keinen umfangreichen Prüfungen. Dadurch können die Supplemente im Produktionsprozess verunreinigt/kontaminiert werden. Da Leistungssportler darauf achten müssen, dass ihr Befund bei einer Dopingkontrolle durch Stoffe, die auf der Kölner-Anti-Doping Liste aufgeführt werden, nicht positiv ausfällt, gilt hier besondere Vorsicht. Derartige Stoffe in Folge einer Verunreini- gung/Kontanimation sind natürlich nicht auf der Verpackung angegeben. Außerdem können die Substanzen auf den Verpackungen der NEM auch einfach unter einem anderen Namen als auf der Verbotsliste deklariert sein. Sportler sollten deshalb entweder geprüfte Supplemente verwenden und außerdem zur Sicherheit immer eine Restprobe des Supplements aufbewahren, damit im Falle eines positiven Dopingbefunds nachgewiesen werden kann, dass das NEM verunreinigt/kontaminiert war und nicht bewusst Substanzen eingenommen wurden. Bei einer Verunreinigung/Kontamination kann dies noch unwissentlich passieren, da eventuell bei der Herstellung vorher andere Erzeugnisse produziert wurden. Allerdings können auch bewusst Stimulanzien beigemischt werden, um einen höheren Wirkungsgrad zu erzielen. Laut Daten der Nationalen Anti-Doping Agentur Deutschland (NADA) sind 15 % der NEM mit dopingrelevanten Substanzen verunreinigt. Dieser Wert ist besorgniserregend hoch (Präsentationsunterlagen der NADA Anti-Doping-Basics). Auch Breitensportler sollten die Verwendung von NEM abwägen, da für viele Nahrungsergänzungsmittel entsprechende LangzeitSicherheitsdaten fehlen. Personen, die eine Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln in Erwägung ziehen, sollten sich über mögliche Nebenwirkungen und Risiken im Klaren sein, damit sie eine fundierte Entscheidung über die Verwendung eines Supplements treffen können. Außerdem ist es hilfreich einen fachkundigen Arzt zu konsultieren, um eventuell zugrundeliegende medizinische Probleme zu erkennen, die eine Einnahme kontraindizieren könnten. Bei der Bewertung der Sicherheit eines Nahrungsergänzungsmittels wird empfohlen, zu prüfen, ob in der wissenschaftlichen oder medizinischen Literatur über Nebenwirkungen berichtet wurde. Insbesondere empfehlen Kersick et al., in ihrem Review von 2018 zu kontrollieren, ob und wie lange ein bestimmtes Nahrungsergänzungsmittel untersucht wurde, welche Dosierungen untersucht wurden und ob irgendwelche Nebenwirkungen beobachtet wurden.
2. Methodik
Um klarzustellen, welche Unterschiede zwischen dem Leistungs- und Breitensport bestehen, dient die folgende Tabelle zur Veranschaulichung, da diese Begriffe häufig verwendet werden.
2.1 Definition Leistungs- und Breitensport
Tabelle1: Definition vom Leistungs- und Breitensport (http://www.sportunterricht.de/lksport/gesell3.html)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.2 Literaturrecherche
Als Methodik, für die vorliegende Arbeit wurde eine systematische Literaturrecherche ausgewählt. Es handelt sich also, um eine theoretische Bachelorarbeit. Diese Methode bietet sich an, um möglichst präzise passende Fachliteratur zu identifizieren, die bei der Beantwortung der Forschungsfrage hilft. Das Vorgehen richtet sich hierbei nach dem Cochrane Manual zur Literaturrecherche in Fachdatenbanken herausgegeben von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Nordhausen, T. & Hirt, J. 2020). Die Literaturrecherche erfolgte über die Suchmaschine PubMed. Die größte Komponente von PubMed ist MEDLINE, welche von der National Library of Medicine (NLM) gepflegt wird und zu den größten und wichtigsten Datenbanken für medizinische Fachliteratur gehört. Zurzeit umfasst PubMed 32 Millionen Literaturangaben (Stand 30.05.2021) bestehend aus MEDLINE, PubMed central (PMC) und dem „Bookshelf“. PMC stellt den zweitgrößten Anteil von Pubmed dar und ist ein Volltextarchiv, welches Artikel aus Zeitschriften enthält, die von der NLM geprüft werden und zur Archivierung ausgewählt werden. Die letzte Komponente ist das sogenannte „Bookshelf“. Dabei handelt es sich ebenfalls um ein Volltextarchiv - allerdings bestehnd aus Büchern, Berichten, Datenbanken und anderen Dokumenten aus dem Bereichen Biomedizin und Gesundheit.
Es soll nach dem spezifischen Rechercheprinzip vorgegangen werden, da der Fokus auf der Durchsuchung einer themenspezifischen Datenbank liegt (PubMed). Um die Suchkomponenten festzulegen, soll nach dem PICO-Schema gearbeitet werden, welches die Frage in 4 Komponenten unterteilt: Patient (P), Intervention (I), Control (C) und Outcome (O) (Nordhausen & Hirt, 2020, S.19 ff.). Konkret bezogen auf die Fragestellung der Bachelorarbeit wird die Forschungsfrage, wie folgt unterteilt: Wie wirkt sich bei Leistungs- und Breitensportlern (P) die Einnahme von Vitaminen (I) im Vergleich zu keiner Einnahme von Vitaminen (Placebo) (C) im Bezug auf die Verbesserung der sportlichen Leistungsfähigkeit aus (O)? Es wurden nur Studien eingeschlossen, bei denen mit einer Placebo-Kontrollgruppe gerabeitet wurde oder Studien, welche die 25(OH)D Konzentrationen maßen, um sicherzustellen, dass die beobachteten Effekte zu einer großen Wahrscheinlichkeit auf die Einnahme der Vitamine zurückzuführen sind.
2.3 Übersicht Suchbegriffe
Die Suchbegriffe wurden mittels eigener Expertise und der Analyse von Schlagwörtern und zentralen Begriffen themenbezogener Literatur entnommen. Der Suchbegriff „Sports“ wurde ausgeschlossen, weil dadurch zu viele irrelevante Treffer erzielt wurden. Die Suchbegriffe der verschiedenen Oberkategorien wurden dann mit Boolschen Operatoren verbunden, um dadurch einen optimalen Suchstring zu erstellen. Die MeSH Suchbegriffe, welche von den Datenbankbetreibern vergeben werden, wurden bei passenden Studien identifiziert und teilweise mit in den Suchstring aufgenommen. Außerdem wurde zusätzlich mit dem Einklammern gearbeitet, damit wirklich nur die gesuchte Wortkombination gefunden - und so die Ergebnisse eingegrenzt werden können. Zusätzlich wurden zur Reduktion der Treffer Wörter in Anführungszeichen gesetzt, damit nur Literatur gesucht wird, in denen das Wort entsprechend vorkommt. Es gab keine geographischen Einschränkungen und es wurden nur Studien, die in englischer Sprache verfasst wurden eingeschlossen. Die folgende Tabelle zeigt die ausgewählten Suchbegriffe sortiert nach den unterschiedlichen Kategorien:
Tabelle 2: Übersicht der für die Literaturrecherche verwendeten Suchbegriffe
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Studienauswahl erfolgt dann unter bestimmten Kriterien. So soll keine Literatur betrachtet werden, die älter als 10 Jahre alt ist, um aktuelle wissenschaftliche Ergebnisse zu erhalten. Außerdem sollen Studiendesigns mit einem höheren Evidenzgrad bevorzugt verwendet werden. Hierbei dient die Evidenzpyrmide als Orientierung, um zu überprüfen, welche Veröffentlichungen die größte wissenschaftliche Evidenz liefern. An der Spitze der Pyramide (gleichzusetzen mit dem höchste Evidenzgrad) stehen Me- ta-Analysen/systematische Übersichtsarbeiten gefolgt von Randomized Controlled Trials (RCT). Reviews sollen auch mit eingeschlossen werden, solange sie in einem PeerReview Verfahren überprüft wurden, da so die Qualität und Eignung der wissenschaftlichen Publikation höher ist. Der "Goldstandard" für die Untersuchung der Auswirkungen von Nahrungsergänzungsmitteln auf die sportliche Leistung ist die prospektive, rando- misierte, kontrollierte wissenschaftliche Studie, bei der die Probanden nach dem Zufallsprinzip entweder eine experimentelle oder eine Placebo-Behandlung (idealerweise doppelblind) erhalten oder beide Behandlungen in gegensätzlicher Reihenfolge unter standardisierten Bedingungen erfolgen (Maughan et al., 2018). Die Literatur die untersucht wurde sollte Folgendes enthalten:
- Angabe der Stichprobengröße und möglichst präzise Darstellung der Teilnehmermerkmale (z. B. Trainingszustand und Alter), damit die Ergebnisse eine höhere Aussagekraft haben.
- Standardisierung, soweit wie möglich, von Variablen, die die Ergebnisse beeinflussen könnten (z.B. Training und Ernährung vor der Studie, Umgebungsbedingungen oder Messung der vorherigen Vitaminkonzentration).
- die Verwendung eines Protokolls für die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln (z.B. spezifisches Produkt, Dosis und Zeitpunkt der Einnahme).
- eine unabhängige Überprüfung der Inhaltsstoffe des untersuchten Supplements, um sicherzustellen, dass das Produkt wirklich unverfälscht ist, sowohl um die Integrität der Studie zu gewährleisten als auch um versehentliche Doping-Positivbefunde zu vermeiden, wenn die Probanden Sportler sind.
- der Nachweis, dass das Präparat eingenommen wurde und eine biologische Reaktion hervorgerufen hat (bei Vitaminen meist über Proben des Blutserums).
- ein Leistungsprotokoll, das valide und hinreichend zuverlässig ist, um kleine, aber potenziell bedeutsame Veränderungen/Unterschiede in den Leistungsergebnissen zu erkennen und das spezifisch ausgewählt wird, um die Unterschiede zu detektieren (z.B. bei der Überprüfung einer Veränderung der Muskelkraft eine isokinetische Kraftmessung).
- die Interpretation der Ergebnisse unter Berücksichtigung der Einschränkungen des Studiendesigns.
Zusätzlich wurden als Filter bei PubMed eingestellt, dass es sich, um einen Volltext handeln muss und das Alter der Probanden zwischen 19-44 Jahren liegen soll. Der Altersbereich wurde festgelegt, da Studien mit älteren Teilnehmern häufig stärkere Verbesserungen bei der Supplementation mit Vitaminen ergaben und es bei dieser Arbeit vor allem, um den Effekt von einer Vitamin Supplementation bei Sportlern gehen soll. Trotz des Filters gab es Studien mit einzelnen 17-18-jährigen Teilnehmern, welche auch inkludiert wurden, da die Probanden nur minimal jünger als gewünscht und außerdem fast volljährig waren. Es wurden sowohl Studien für Breiten- als auch für Leistungssportler inkludiert.
Vitamin A und K wurden aus der Recherche ausgeschlossen, da keine Literatur gefunden werden konnte, in der gezeigt wurde, dass Vitamin A einen leistungssteigernden Effekt besitzt (Kersick et al., 2018). Ähnliches gilt für Vitamin K, bei dem in dem Review von Kersick et al. (2018) lediglich eine alte Studie von 1998 bei einer kleine Stichprobe von acht weiblichen Langläuferinnen besagte, dass eine Vitamin-K-Supplementierung (10 mg/d) bei weiblichen Spitzensportlern die Calciumbindungskapazität von Osteocalcin erhöht, und einen Anstieg der Knochenbildungsmarker um 15-20 % sowie einen Rückgang der Knochenresorptionsmarker um 20-25 % bewirkt. Das lässt auf ein verbessertes Gleichgewicht zwischen Knochenbildung und -resorption schließen (Craciun, Wolf, Knapen, Brouns &Vermeer, 1998). Hierbei muss natürlich die extrem kleine Stichprobe bei der Bewertung der Ergebnisse berücksichtigt werden. Zusätzlich dazu wurde die Studie durch die eingestellten Filter (nicht älter als 10 Jahre) sowieso exklu- diert. Mithilfe des Suchstrings wurden 195 Studien identifiziert, von denen 33 als relevant eingestuft wurden. Bei den 33 Studien handelte es sich um: 29 RCTs, drei Reviews und eine Meta-Analyse. Im Verlauf der Recherche kamen durch Referenzen in den vorliegenden Studien und spezifische Suchanfragen auf Pubmed noch mehr Studien hinzu, damit alle relevanten Aspekte berücksichtigt und ausführlich erläutert werden können. Dazu kamen im Verlauf der Arbeit sieben weitere RCTs, 18 Reviews, sechs Clinical Trials, ein Leitartikel und zwei Kohortenstudien. Eine Übersicht des Ablaufs zeigt das Flowchart auf der folgenden Seite:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Flowchart der gesamten Literaturrecherche (angelehnt an das PRISMA 2020 flow diagram for new systematic reviews which included searches of databases and registers only)
Um einen Überblick über die Probanden und die Dosierung zu haben führt die folgende Tabelle alle 33 inkludierten Studien der insgesamt 195, ursprünglich durch die Literaturrecherche identifizierten Studien auf.
2.4 Übersicht der ursprünglich eingeschlossenen Literatur
Tabelle 3: Übersicht der durch die ursprüngliche Literaturrecherche eingeschlossenen Literatur.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Inhaltsverzeichnisses?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst die Einleitung, Methodik, Ergebnisse (insbesondere zu Vitamin D, C, und E), Interpretation und Diskussion, Zusammenfassung und Ausblick, sowie das Literaturverzeichnis. Es gibt auch Abschnitte über die Definition und Verbreitung von Nahrungsergänzungsmitteln (NEM), Gründe für deren Nutzung, und potentielle Risiken.
Welche Abkürzungen werden im Abkürzungsverzeichnis genannt?
Das Abkürzungsverzeichnis definiert eine Vielzahl von sportmedizinischen und biochemischen Begriffen, darunter 1RM (One Repetition Max), AA (Ascorbinsäure), CK (Kreatinkinase), DOMS (Delayed Onset Muscle Soreness), FFMI (Fettfreier Masse Index) und viele mehr.
Was sind die wichtigsten Inhalte des Abstract?
Das Abstract fasst zusammen, dass Nahrungsergänzungsmittel (insbesondere Vitamine C, D und E) im Sport weit verbreitet sind und die Arbeit untersucht, wie effektiv diese zur Leistungssteigerung sind. Es werden auch die Risiken der NEM-Nutzung hervorgehoben, wie z.B. die unbeabsichtigte Einnahme von verbotenen Substanzen. Es wird empfohlen vor der Einnahme eine fachkundige Meinung einzuholen und einen möglichen Mangel abzuklären.
Wie werden Nahrungsergänzungsmittel definiert?
Nahrungsergänzungsmittel werden als Lebensmittel definiert, die dazu bestimmt sind, die allgemeine Ernährung zu ergänzen. Sie stellen Konzentrate von Nährstoffen oder anderen Stoffen mit ernährungsspezifischer oder physiologischer Wirkung dar und werden in dosierter Form in Verkehr gebracht.
Welche Gründe werden für die Nutzung von Nahrungsergänzungsmitteln genannt?
Häufige Gründe für die Nutzung von NEM sind die Ergänzung der Ernährung, die Verbesserung der Leistungsfähigkeit, die Unterstützung der Erholung, die Vorbeugung oder Behandlung von Krankheiten, und der Ausgleich einer schlechten Ernährung. Die Entscheidungen basieren jedoch oft auf unbegründeten Überzeugungen.
Welche Risiken sind mit der Nutzung von Nahrungsergänzungsmitteln verbunden?
Zu den Risiken gehören die Verunreinigung der Supplemente mit verbotenen Substanzen, das Fehlen ausreichender Langzeit-Sicherheitsdaten und mögliche Nebenwirkungen. Es ist wichtig, die Legalität und Sicherheit der Supplemente zu prüfen und bei Bedarf einen Arzt zu konsultieren.
Wie wird die Methodik der Arbeit beschrieben?
Es wurde eine systematische Literaturrecherche durchgeführt, wobei PubMed als Suchmaschine verwendet wurde. Die Suchbegriffe wurden mittels eigener Expertise und der Analyse von Schlagwörtern und zentralen Begriffen themenbezogener Literatur entnommen. Das Vorgehen richtet sich hierbei nach dem Cochrane Manual zur Literaturrecherche in Fachdatenbanken herausgegeben von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
Welche Kriterien wurden für die Auswahl der Studien verwendet?
Es wurden nur Studien berücksichtigt, die nicht älter als 10 Jahre sind, Studiendesigns mit höherem Evidenzgrad aufweisen (Meta-Analysen, systematische Übersichtsarbeiten, RCTs). Die Studien sollten präzise Angaben zur Stichprobengröße und den Teilnehmermerkmalen enthalten und die Ergebnisse unter Berücksichtigung der Einschränkungen des Studiendesigns interpretieren.
Details
- Titel
- Verbreitung und Effektivität von vitaminhaltigen Nahrungsergänzungsmitteln im Leistungs- und Breitensport
- Hochschule
- Deutsche Sporthochschule Köln
- Note
- 1,6
- Autor
- Emil Kubo (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2021
- Seiten
- 78
- Katalognummer
- V1309230
- ISBN (Buch)
- 9783346784063
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- verbreitung effektivität nahrungsergänzungsmitteln leistungs- breitensport
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 0,99
- Preis (Book)
- US$ 44,99
- Arbeit zitieren
- Emil Kubo (Autor:in), 2021, Verbreitung und Effektivität von vitaminhaltigen Nahrungsergänzungsmitteln im Leistungs- und Breitensport, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1309230
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-