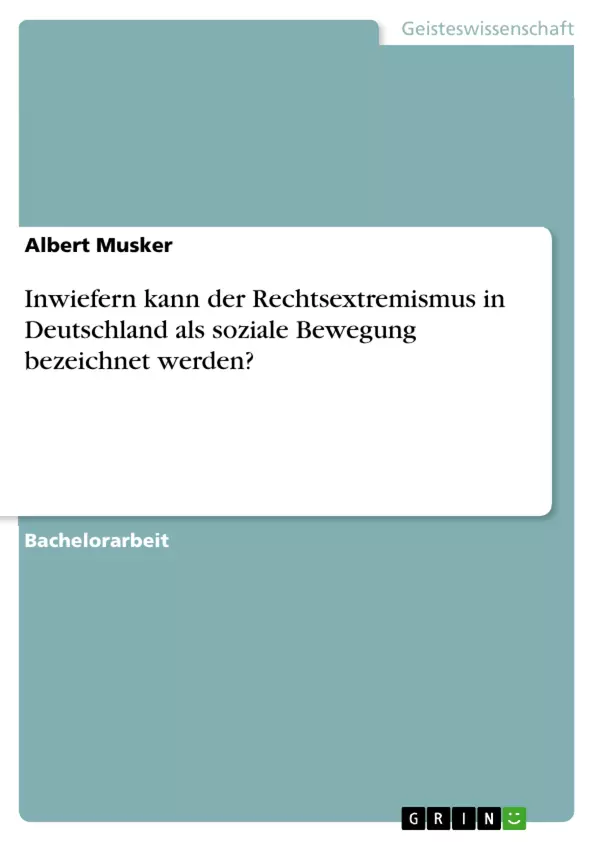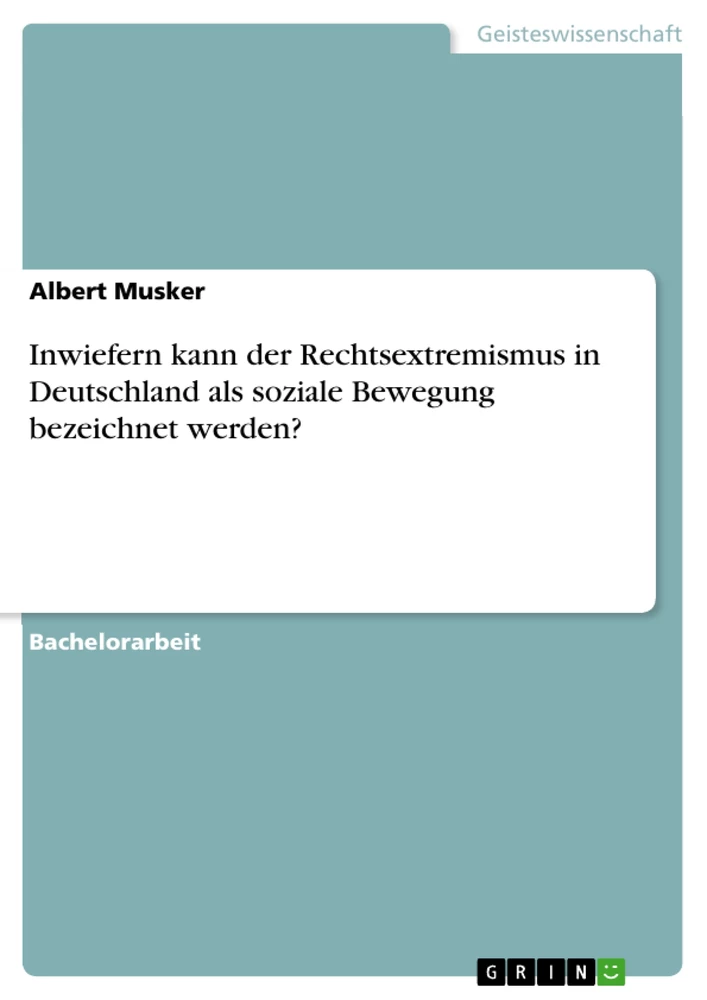
Inwiefern kann der Rechtsextremismus in Deutschland als soziale Bewegung bezeichnet werden?
Bachelorarbeit, 2020
50 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmungen
- Extremismus und Radikalismus
- Rechtsextremismus
- Rechtsextremismus als politikwissenschaftlicher Begriff
- Soziale Bewegungen und Mobilisierungsprozesse
- Theorien sozialer Bewegungen
- Mobilisierungsprozesse und deren Faktoren
- Mobilisierung und Rekrutierung bei sozialen Bewegungen
- Theorien der Ideenverbreitung
- Die Entwicklungsdynamiken sozialer Bewegungen
- Entwicklung und Ursachen des Rechtsextremismus
- Rechtsextreme Kultur in Deutschland
- Rechtsextreme Szene und Strukturen
- Rechtsextreme Gewalt und Kriminalität
- Veranstaltungen und Musik in der rechtsextremen Szene
- Rechtsextremismus im Internet
- Analytische Betrachtung des Rechtsextremismus als soziale Bewegung
- Auswahl der Kriterien
- kriterienorientierte Überprüfung des Rechtsextremismus als soziale Bewegung
- Fazit und Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Frage, inwiefern der Rechtsextremismus in Deutschland als soziale Bewegung bezeichnet werden kann. Die Arbeit analysiert den Rechtsextremismus im Kontext von Theorien sozialer Bewegungen und Mobilisierungsprozessen, wobei die historischen Entwicklungen und Ursachen sowie die aktuelle rechtsextreme Kultur in Deutschland beleuchtet werden. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, anhand einer kriterienorientierten Überprüfung festzustellen, ob der Rechtsextremismus in Deutschland die Merkmale einer sozialen Bewegung erfüllt.
- Rechtsextremismus als soziale Bewegung
- Theorien sozialer Bewegungen und Mobilisierungsprozesse
- Entwicklung und Ursachen des Rechtsextremismus in Deutschland
- Rechtsextreme Kultur und Szene in Deutschland
- Kriterienorientierte Überprüfung des Rechtsextremismus
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit und die zentrale Forschungsfrage vor. Sie beleuchtet anhand von aktuellen Beispielen die Bedrohung durch Rechtsextremismus in Deutschland.
- Begriffsbestimmungen: In diesem Kapitel werden die Begriffe Extremismus, Radikalismus und Rechtsextremismus definiert und abgegrenzt. Es werden die verschiedenen Facetten des Rechtsextremismus und seine Einordnung als politikwissenschaftlicher Begriff erläutert.
- Soziale Bewegungen und Mobilisierungsprozesse: Dieses Kapitel befasst sich mit den Theorien sozialer Bewegungen und den Mobilisierungsprozessen, die diese antreiben. Die Rekrutierung, Mobilisierung und die Verbreitung von Ideen innerhalb sozialer Bewegungen werden analysiert.
- Entwicklung und Ursachen des Rechtsextremismus: Dieses Kapitel beleuchtet die historischen Entwicklungen und Ursachen des Rechtsextremismus in Deutschland. Es werden zentrale historische Ereignisse und die damit verbundenen politischen und sozialen Rahmenbedingungen betrachtet, die zur Entstehung und Entwicklung des Rechtsextremismus geführt haben.
- Rechtsextreme Kultur in Deutschland: Dieses Kapitel befasst sich mit der aktuellen rechtsextremen Szene in Deutschland. Es analysiert die Strukturen der rechtsextremen Szene, die Formen der rechtsextremen Gewalt und Kriminalität, sowie die Rolle von Veranstaltungen, Musik und dem Internet in der Verbreitung rechtsextremer Ideologien.
- Analytische Betrachtung des Rechtsextremismus als soziale Bewegung: In diesem Kapitel werden die Kriterien zur Definition einer sozialen Bewegung anhand des Rechtsextremismus in Deutschland geprüft. Es wird untersucht, ob der Rechtsextremismus die Merkmale einer sozialen Bewegung erfüllt und welche Faktoren für oder gegen diese Einordnung sprechen.
Schlüsselwörter
Rechtsextremismus, soziale Bewegungen, Mobilisierungsprozesse, Rechtsextreme Kultur, Deutschland, Gewalt, Kriminalität, Internet, Kriterien, Analytische Betrachtung, Theorien, Politikwissenschaft.
Details
- Titel
- Inwiefern kann der Rechtsextremismus in Deutschland als soziale Bewegung bezeichnet werden?
- Hochschule
- Universität Hamburg
- Note
- 1,3
- Autor
- Albert Musker (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2020
- Seiten
- 50
- Katalognummer
- V1312455
- ISBN (Buch)
- 9783346785794
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Extremismus Rechtsextremismus Deutschland Soziale Bewegung Extremismusforschung Ideologien
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Albert Musker (Autor:in), 2020, Inwiefern kann der Rechtsextremismus in Deutschland als soziale Bewegung bezeichnet werden?, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1312455
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-