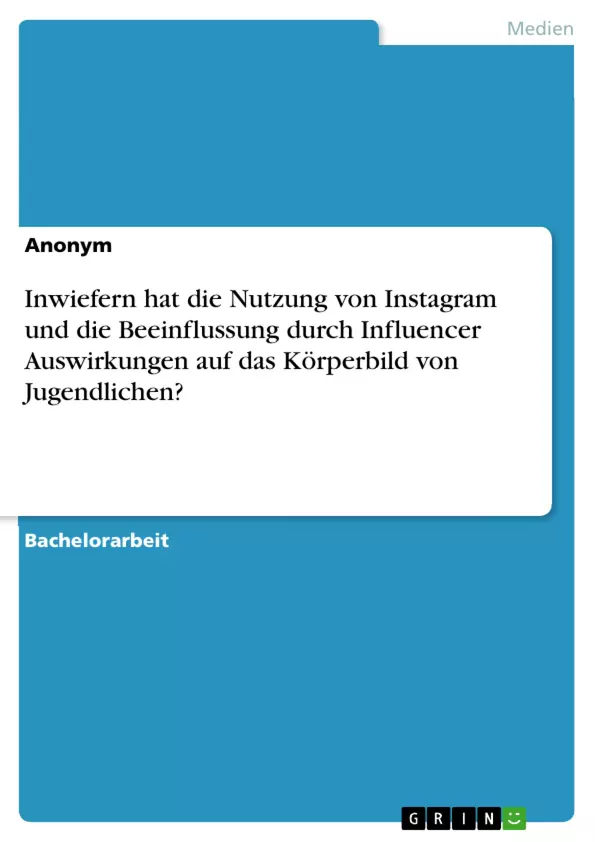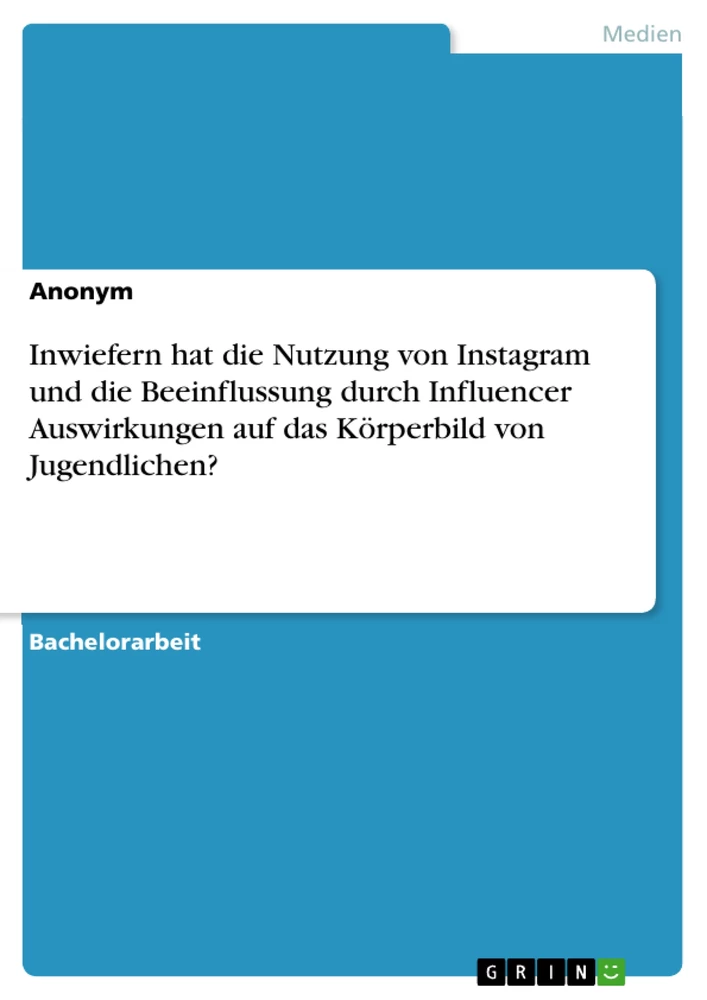
Inwiefern hat die Nutzung von Instagram und die Beeinflussung durch Influencer Auswirkungen auf das Körperbild von Jugendlichen?
Bachelorarbeit, 2022
54 Seiten, Note: 1,0
Medien / Kommunikation - Public Relations, Werbung, Marketing, Social Media
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Ziel der Arbeit
- 1.2 Forschungsstand
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 2 Jugend als Lebensphase
- 2.1 Begriffsbestimmungen
- 2.1.1 Jugend
- 2.1.2 Adoleszenz
- 2.1.3 Pubertät
- 2.2 Jugendspezifische Entwicklung
- 2.2.1 Entwicklungsaufgaben, Identität und das Selbst
- 3 Der Körper im Jugendalter
- 3.1 Begriffsbestimmung Körperbild
- 3.2 Bedeutung des Körperbildes während der Jugend
- 3.3 Positives, neutrales, negatives Körperbild
- 3.4 Einflussfaktoren zur Entstehung eines negativen Körperbildes
- 3.4.1 Biologische Faktoren
- 3.4.2 Psychologische Faktoren
- 3.4.3 Soziokulturelle Faktoren
- 3.4.4 Schönheits-/Körperideale
- 3.4.5 Geschlechtsspezifische Differenzen
- 3.4.6 Eltern
- 3.4.7 Peers
- 4 Medien
- 4.1 Veränderung des Medienkonsums
- 4.2 Mediale Begriffsbestimmungen Social Media, Soziale Plattformen
- 5 Instagram
- 5.1 Begriffsbestimmung Instagram
- 5.2 Funktionen von Instagram
- 5.3 Nutzungsverhalten
- 5.4 Selbstdarstellung auf Instagram
- 6 Influencer als Vorbilder und Vergleichsobjekte für das Körperbild
- 6.1 Begriffsbestimmung und Ranking beliebter Influencer
- 6.2 Fitnessinfluencerin Pamela Reif
- 6.3 Influencer Marketing
- 6.4 Trends auf Instagram
- 7 Theorie der sozialen Vergleichsprozesse als Erklärungsansatz
- 7.1 Vergleichsrichtungen
- 7.1.1 Horizontaler Vergleich
- 7.1.2 Abwärtsgerichteter Vergleich
- 7.1.3 Aufwärtsgerichteter Vergleich
- 7.2 Auswirkungen des sozialen Vergleichens auf das Körperbild
- 8 Gegenbewegungen und deren Auswirkungen auf das Körperbild Jugendlicher
- 8.1 Body-Positivity und Body-Neutrality
- 9 Zusammenführung der Auswirkungen: Diskussion
- 10 Limitationen
- 11 Unterstützungsmöglichkeiten Jugendlicher
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht den Einfluss von Instagram und seinen Influencern auf das Körperbild von Jugendlichen. Es wird analysiert, ob und inwieweit die Nutzung der Plattform zu positiven oder negativen Auswirkungen auf die Körperwahrnehmung und das Selbstwertgefühl junger Menschen führt. Die Arbeit vermeidet eine Verurteilung von Instagram, sondern konzentriert sich auf eine objektive Analyse der Plattform, ihrer Funktionen, der Rolle von Influencern und vorherrschender Trends.
- Die Relevanz des Körpers in der jugendlichen Lebensphase.
- Die Entstehung und Entwicklung des Körperbildes im Jugendalter.
- Der Einfluss von sozialen Medien, insbesondere Instagram, auf das Körperbild.
- Die Rolle von Influencern als Vorbilder und Vergleichsobjekte.
- Die Wirkung sozialer Vergleichsprozesse auf die Körperwahrnehmung.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und betont die Bedeutung des Körpers, insbesondere im Jugendalter. Sie stellt die Forschungsfrage nach dem Einfluss von Instagram und Influencern auf das Körperbild von Jugendlichen und skizziert den Aufbau der Arbeit.
2 Jugend als Lebensphase: Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe wie Jugend, Adoleszenz und Pubertät und beleuchtet die jugendspezifische Entwicklung, insbesondere die Entwicklungsaufgaben im Zusammenhang mit der Identitätsfindung und dem Selbstbild. Es wird der Zusammenhang zwischen der Körperwahrnehmung und der Identitätsentwicklung hergestellt.
3 Der Körper im Jugendalter: Der Begriff des Körperbildes wird präzise definiert, und die Bedeutung des Körperbildes während der Jugend wird hervorgehoben. Das Kapitel analysiert positive, neutrale und negative Körperbilder und beschreibt verschiedene Einflussfaktoren auf die Entstehung eines negativen Körperbildes, unterteilt in biologische, psychologische und soziokulturelle Faktoren, sowie den Einfluss von Schönheits- und Körperidealen, Eltern und Peers.
4 Medien: Kapitel 4 behandelt die Veränderung des Medienkonsums im Jugendalter und definiert den Begriff der sozialen Medien. Der Fokus liegt auf dem Nutzungsverhalten Jugendlicher und der Rolle der Medien als Sozialisationsinstanz.
5 Instagram: Dieses Kapitel beschreibt Instagram als Plattform und seine Funktionen. Es analysiert das Nutzungsverhalten Jugendlicher auf Instagram und die Bedeutung der Selbstdarstellung im Kontext der Identitätsfindung und des Körperbildes. Die Rolle des Algorithmus und die Bearbeitung von Bildern mit Filtern werden ebenfalls thematisiert.
6 Influencer als Vorbilder und Vergleichsobjekte für das Körperbild: Das Kapitel definiert den Begriff "Influencer" und analysiert deren Rolle als Vorbilder und Vergleichsobjekte. Die Fitnessinfluencerin Pamela Reif dient als Beispiel, um die Präsentation idealisierter Körperbilder zu untersuchen. Influencer Marketing und vorherrschende Trends (#thinspiration, #fitspiration) werden ebenfalls behandelt.
7 Theorie der sozialen Vergleichsprozesse als Erklärungsansatz: Dieses Kapitel erläutert die Theorie der sozialen Vergleichsprozesse nach Festinger und beschreibt die verschiedenen Vergleichsrichtungen (horizontal, abwärtsgerichtet, aufwärtsgerichtet). Es analysiert die Auswirkungen des sozialen Vergleichens auf das Körperbild im Kontext der Nutzung von Instagram.
8 Gegenbewegungen und deren Auswirkungen auf das Körperbild Jugendlicher: Das Kapitel beschreibt Gegenbewegungen wie Body-Positivity und Body-Neutrality und diskutiert deren Wirkung auf das Körperbild Jugendlicher. Es wird kritisch auf die Grenzen und potentiellen Nachteile dieser Bewegungen eingegangen.
Schlüsselwörter
Instagram, Influencer, Körperbild, Jugend, Adoleszenz, Selbstdarstellung, soziale Vergleichsprozesse, Identität, Selbstwertgefühl, Schönheitsideale, Body-Positivity, Body-Neutrality, Medienkonsum, Digital Natives, Fitspiration, Thinspiration.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Einfluss von Instagram und Influencern auf das Körperbild Jugendlicher
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Instagram und seinen Influencern auf das Körperbild Jugendlicher. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob und wie die Nutzung der Plattform die Körperwahrnehmung und das Selbstwertgefühl junger Menschen beeinflusst. Die Analyse ist objektiv und vermeidet eine Verurteilung von Instagram.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Relevanz des Körpers in der jugendlichen Lebensphase, die Entstehung und Entwicklung des Körperbildes im Jugendalter, den Einfluss sozialer Medien (insbesondere Instagram) auf das Körperbild, die Rolle von Influencern als Vorbilder und Vergleichsobjekte, sowie die Wirkung sozialer Vergleichsprozesse auf die Körperwahrnehmung. Zusätzlich werden Gegenbewegungen wie Body-Positivity und Body-Neutrality diskutiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Jugend als Lebensphase, Der Körper im Jugendalter, Medien, Instagram, Influencer als Vorbilder und Vergleichsobjekte, Theorie der sozialen Vergleichsprozesse, Gegenbewegungen, Diskussion der Ergebnisse, Limitationen und Unterstützungsmöglichkeiten für Jugendliche. Jedes Kapitel bearbeitet einen spezifischen Aspekt des Themas.
Wie wird der Einfluss von Instagram auf das Körperbild analysiert?
Die Analyse betrachtet verschiedene Aspekte: das Nutzungsverhalten Jugendlicher auf Instagram, die Bedeutung der Selbstdarstellung, die Rolle des Algorithmus, die Bildbearbeitung mit Filtern, die Wirkung von idealisierten Körperbildern von Influencern (am Beispiel Pamela Reif), und die Auswirkungen von sozialen Vergleichsprozessen (horizontal, abwärtsgerichtet, aufwärtsgerichtet).
Welche Rolle spielen Influencer in der Arbeit?
Influencer werden als Vorbilder und Vergleichsobjekte für Jugendliche analysiert. Die Arbeit untersucht, wie deren idealisierte Körperbilder die Körperwahrnehmung und das Selbstwertgefühl beeinflussen können. Das Influencer Marketing und vorherrschende Trends wie #thinspiration und #fitspiration werden ebenfalls thematisiert.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Theorie der sozialen Vergleichsprozesse nach Festinger, um die Auswirkungen des Vergleichens mit Influencern und anderen Nutzern auf das Körperbild zu erklären.
Welche Gegenbewegungen werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert die Gegenbewegungen Body-Positivity und Body-Neutrality und diskutiert kritisch deren Wirkung auf das Körperbild Jugendlicher und deren Grenzen und potentielle Nachteile.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Instagram, Influencer, Körperbild, Jugend, Adoleszenz, Selbstdarstellung, soziale Vergleichsprozesse, Identität, Selbstwertgefühl, Schönheitsideale, Body-Positivity, Body-Neutrality, Medienkonsum, Digital Natives, Fitspiration, Thinspiration.
Welche Limitationen werden in der Arbeit angesprochen?
Die Arbeit benennt die Limitationen der Studie, um die Ergebnisse kritisch einzuschätzen und mögliche Einschränkungen zu berücksichtigen.
Welche Unterstützungsmöglichkeiten für Jugendliche werden genannt?
Die Arbeit nennt mögliche Unterstützungsmöglichkeiten für Jugendliche, die mit einem negativen Körperbild zu kämpfen haben.
Details
- Titel
- Inwiefern hat die Nutzung von Instagram und die Beeinflussung durch Influencer Auswirkungen auf das Körperbild von Jugendlichen?
- Hochschule
- Pädagogische Hochschule Heidelberg
- Note
- 1,0
- Autor
- Anonym (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2022
- Seiten
- 54
- Katalognummer
- V1312468
- ISBN (Buch)
- 9783346794987
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Instagram Körperbild Jugend Theorie des sozialen Vergleichs
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 21,99
- Preis (Book)
- US$ 32,99
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2022, Inwiefern hat die Nutzung von Instagram und die Beeinflussung durch Influencer Auswirkungen auf das Körperbild von Jugendlichen?, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1312468
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-