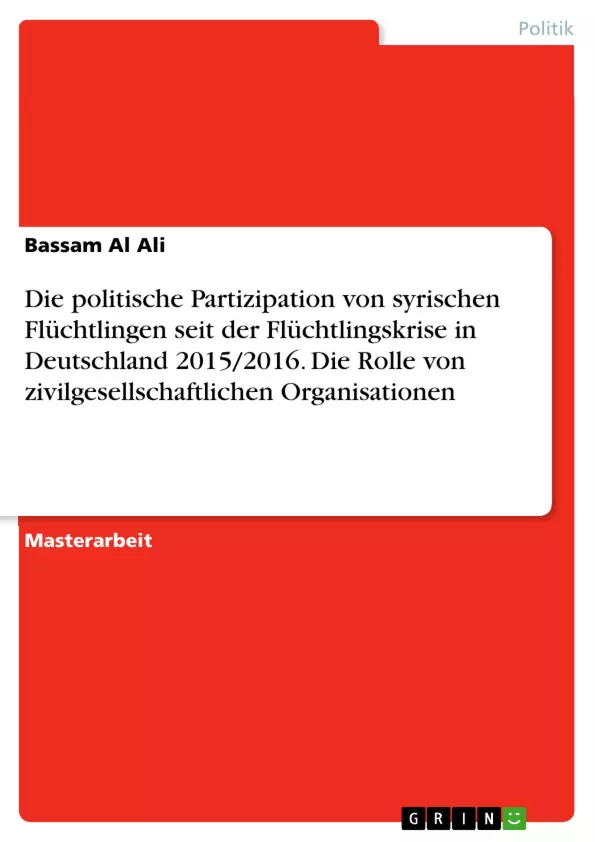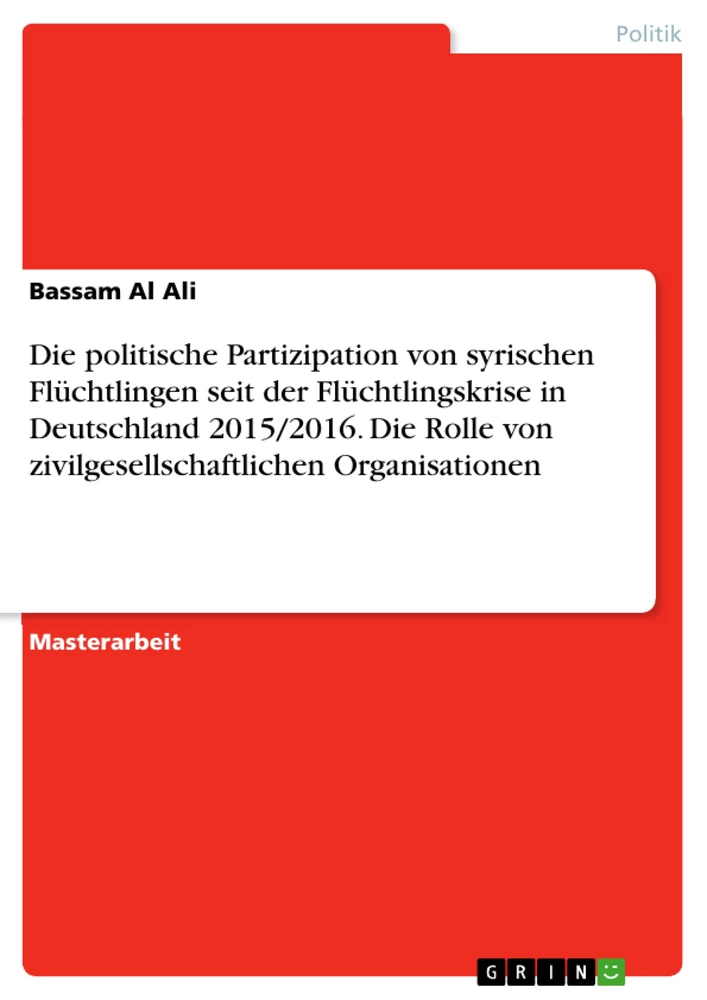
Die politische Partizipation von syrischen Flüchtlingen seit der Flüchtlingskrise in Deutschland 2015/2016. Die Rolle von zivilgesellschaftlichen Organisationen
Masterarbeit, 2022
94 Seiten, Note: 2,8
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- III. Überblick
- IV. Abstract.
- V. Abbildungsverzeichnis.........
- VI. Abkürzungsverzeichnis.
- 1. Einleitung.
- 1.1 Der Arabische Frühling
- 1.2 Die Bewegung in Syrien...
- 1.3 Die Folgen der Bewegung in Syrien.
- 2. Europäische Flüchtlingskrise ........
- 2.1 Folgen der Flüchtlingskrise in EU und DE
- 2.2 Zahlen und Fakten die „Flüchtlingskrise\" betreffend...
- 2.3 Abgrenzung des Begriffs,,Flüchtling“.
- 2.4 Der Begriff politisches Asyl...
- 2.5 Die Definition Asylbewerber und die rechtlichen Aufenthaltspapiere in Deutschland
- 2.6 Schutzquote der syrischen Geflüchteten
- 3. Die Theorie der politischen Gelegenheitsstrukturen..
- 3.1 Die Aspekte der Theorie von politischen Gelegenheitsstrukturen
- 3.2 Die Probleme des Ansatzes der politischen Gelegenheitsstrukturen.
- 3.3 Das Niveau der Bildungsqualifikation der syrischen Geflüchteten.
- 3.4 Zahlen und Fakten die „syrischen Flüchtlinge“ betreffend.
- 4. Politische Beteiligung: „,Forschungsstand\"..
- 4.1 Fakten über die politische Beteiligung......
- 4.2 Definition und Rolle der politischen Beteiligung in einer Demokratie......
- 4.3 Die formale politische Partizipation .......
- 4.4 Die informelle politische Partizipation
- 5. Die politische Partizipation der syrischen Flüchtlinge.........
- 5.1 Initiativen zur Förderung des politischen Engagements.
- 5.1.1 Die Herausforderungen von politischer Partizipation der syrischen Flüchtlinge.………………………………..
- 5.1.2 Die Rolle der syrischen Aktivist*innen in der Diaspora
- 5.2. Die aktiven syrischen zivilgesellschaftlichen Vereine in Deutschland..
- 5.3 Die Partizipation zum Thema Demonstrationen von „Adopt a Revolution\".
- 5.3.1 Die Partizipation zum Thema Freilassung der Gefangenen von „,Families for Freedom\".
- 5.4 Die Interviews mit den aktiven syrischen Vereinsmitgliedern von „Case Study“
- 6. Covid-19-Pandemie..
- 46.1 Aktuelle Situation und Problematik
- 6.1.1 Auswirkungen der Einschränkung der Bewerbungsfreiheit und des Lockdowns .........
- 6.1.2 Auswirkung von Covid-19 auf die Unterbringung in den Geflüchteten-Unterkünften.............
- 6.1.3 Auswirkung der Pandemie auf Asyl- und Migrationsverfahren
- 6.1.4 Auswirkung der Pandemie auf den demokratischen Rechtsstaat
- 7. Interpretation und Diskussion anhand der Case Study,,ZFD“
- 8. Fazit
- 9. Literaturverzeichnis.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit analysiert die Rolle von zivilgesellschaftlichen Organisationen in Bezug auf die politische Partizipation syrischer Flüchtlinge in Deutschland seit der Flüchtlingskrise 2015/2016. Sie befasst sich mit den Hintergründen und Ursachen der Flüchtlingskrise, den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die politische Partizipation von Geflüchteten und der Rolle von zivilgesellschaftlichen Organisationen als Brücke zwischen Flüchtlingen und Gesellschaft.
- Die Auswirkungen der Flüchtlingskrise 2015/2016 in Deutschland
- Die Rolle von zivilgesellschaftlichen Organisationen bei der Integration syrischer Flüchtlinge
- Die politische Partizipation von syrischen Flüchtlingen in Deutschland
- Die Theorie der politischen Gelegenheitsstrukturen
- Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die politische Partizipation von Geflüchteten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Masterarbeit ist in zwei Teile gegliedert: einen theoretischen und einen empirischen Teil. Der theoretische Teil beleuchtet die Hintergründe und Ursachen der Flüchtlingskrise 2015/2016 in Europa und Deutschland sowie die Definitionen von „Flüchtling“ und „Asyl“. Zudem wird die Theorie der politischen Gelegenheitsstrukturen im Kontext der politischen Beteiligung syrischer Flüchtlinge in Deutschland erläutert.
Der empirische Teil analysiert die politische Partizipation von syrischen Flüchtlingen anhand von Interviews und einer Case Study. Es werden verschiedene Initiativen zur Förderung des politischen Engagements von syrischen Flüchtlingen vorgestellt, wie z.B. „Adopt a Revolution“ und „Families for Freedom“.
Die Arbeit untersucht auch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die politische Partizipation von Geflüchteten und die Rolle von zivilgesellschaftlichen Organisationen als Brücke zwischen Flüchtlingen und Gesellschaft. Die Erkenntnisse aus der Case Study werden interpretiert und diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Masterarbeit befasst sich mit den Themenbereichen Flüchtlingskrise, politische Partizipation, Zivilgesellschaft, Integration, syrische Flüchtlinge, politische Gelegenheitsstrukturen, Covid-19-Pandemie, Case Study.
Details
- Titel
- Die politische Partizipation von syrischen Flüchtlingen seit der Flüchtlingskrise in Deutschland 2015/2016. Die Rolle von zivilgesellschaftlichen Organisationen
- Hochschule
- Georg-August-Universität Göttingen (Institut für Politikwissenschaften)
- Note
- 2,8
- Autor
- Bassam Al Ali (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2022
- Seiten
- 94
- Katalognummer
- V1313122
- ISBN (Buch)
- 9783346790491
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich thematisch mit der Rolle von zivilgesellschaftlichen Organisationen in Hinblick auf die politische Partizipation von syrischen Flüchtlingen in Deutschland. Die Rolle solcher Organisationen in Deutschland mit enger Verbindung zur politischen Partizipation von syrischen Flüchtlingen wird anhand von Studien und Interviews beleuchtet sowie dargestellt. Ebenfalls werden neue Erkenntnisse hinsichtlich der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die politische Beteiligung geflüchteter Menschen erzielt.
- Schlagworte
- Zivilgesellschaftliche Organisationen politische Partizipation Flüchtlingskrise in Deutschland 2015/2016 Syrische Flüchtlingen
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 39,99
- Preis (Book)
- US$ 50,99
- Arbeit zitieren
- Bassam Al Ali (Autor:in), 2022, Die politische Partizipation von syrischen Flüchtlingen seit der Flüchtlingskrise in Deutschland 2015/2016. Die Rolle von zivilgesellschaftlichen Organisationen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1313122
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-