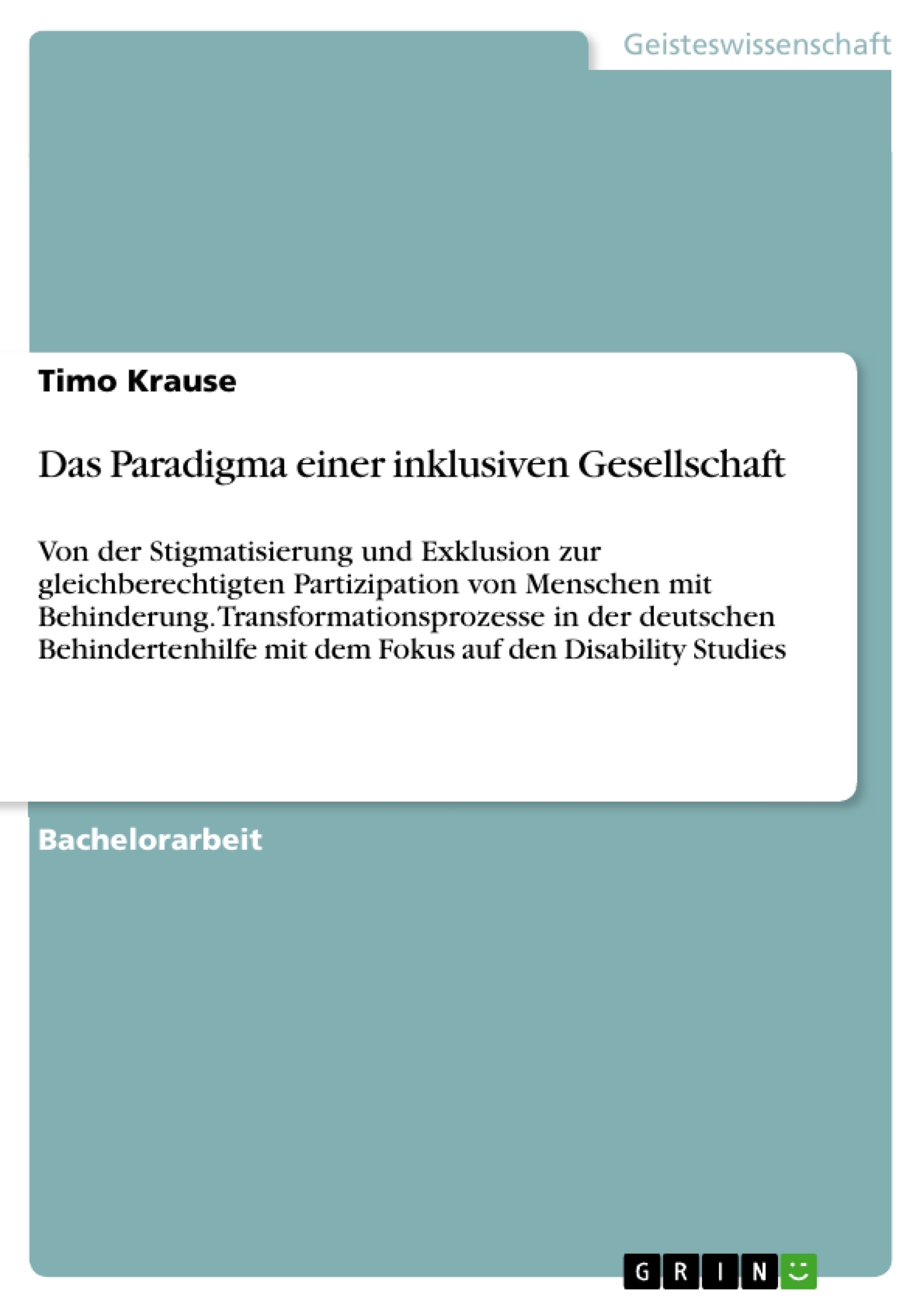Blick ins Buch
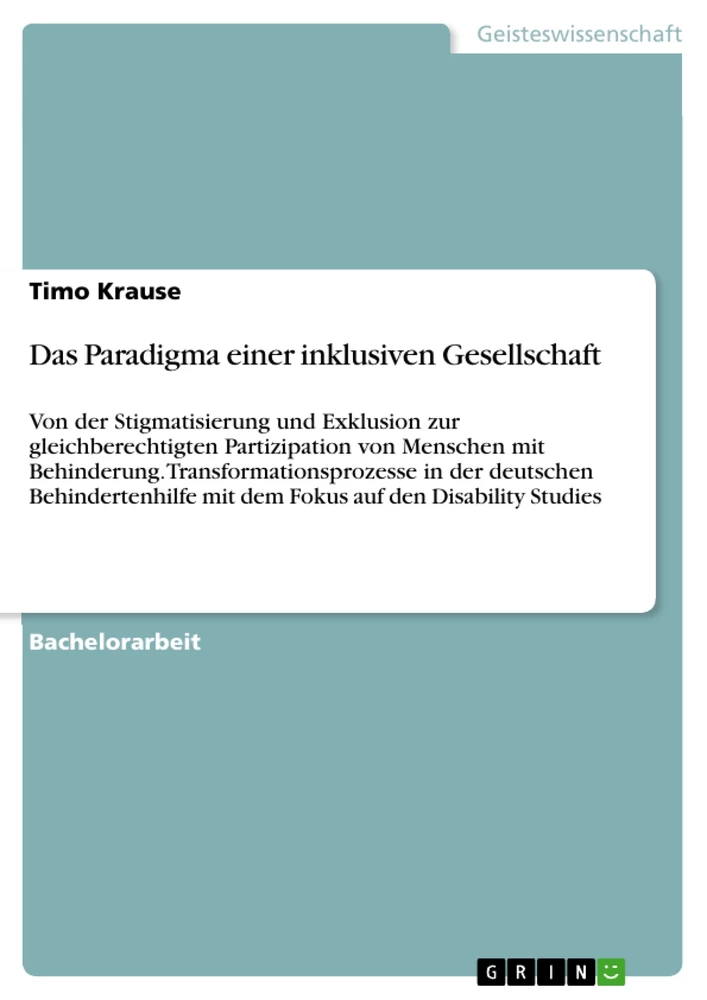
Das Paradigma einer inklusiven Gesellschaft
Von der Stigmatisierung und Exklusion zur gleichberechtigten Partizipation von Menschen mit Behinderung. Transformationsprozesse in der deutschen Behindertenhilfe mit dem Fokus auf den Disability Studies
Bachelorarbeit, 2022
80 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Die Entwicklung des Umgangs mit Menschen mit Behinderung innerhalb der deutschen Gesellschaftsordnung
- 1.1 Der Nationalsozialismus und die Perspektive der Eugenik
- 1.2 Die Entwicklung der Interessenvertretungen nach dem Zweiten Weltkrieg
- 2 Die Disability Studies – Ein Perspektivenwechsel auf Behinderung innerhalb Deutschlands?
- 2.1 Die Wissenschaft der Disability Studies und die Behindertenbewegungen
- 2.2 Die Etablierung der Disability Studies innerhalb Deutschlands
- 2.3 Die Macht der Normen und die Disability Studies – mit Ansätzen Foucaults
- 2.4 Das individuelle Modell von Behinderung und die Kritik der Disability Studies an diesem traditionellen Denkmuster
- 2.5 Das soziale Modell von Behinderung und dessen veränderte Denkweise
- 2.6 Die kritische Reflexion des sozialen Modells von Behinderung
- 2.7 Das kulturelle Modell von Behinderung und dessen vertieftes Verständnis
- 2.8 Die Disability Studies, das kulturelle Modell von Behinderung und deren kritische Reflexion der traditionellen Wissenschaftsansätze
- 2.9 Der Prozess der Kategorisierung und Differenzierung
- 2.10 Die Disability Studies und deren multidimensionale Perspektive
- 3 Das Potenzial der Disability Studies für die Transformation der deutschen Gesellschaftsordnung im Sinne des Paradigmas der Inklusion
- 3.1 Die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN-BRK)
- 3.2 Die Bundesrepublik Deutschland und deren Verpflichtungen als Teil der ratifizierenden Vertragsstaaten der UN-BRK
- 3.3 Die UN-BRK und das Paradigma der Inklusion innerhalb Deutschlands
- 3.4 Das Paradigma eines inklusiven Deutschlands und die Disability Studies
- 3.4.1 Die Disability Studies und deren Verständnis von Behinderung
- 3.4.2 Die Disability Studies und deren Forschungsparadigma
- 4 Abschluss der Arbeit
- 4.1 Zusammenfassung der Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellung
- 4.2 Das sozialarbeiterische Handlungsfeld der deutschen Behindertenhilfe
- 4.3 Ausblick – Das Paradigma einer inklusiven Gesellschaft
- 4.3.1 Das Stigma der Behinderung
- 4.3.2 Die Utopie einer guten Gesellschaft
- 4.3.3 Abschlusszitat
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit dem Paradigma einer inklusiven Gesellschaft und analysiert, wie die Transformationsprozesse in der deutschen Behindertenhilfe unter dem Fokus der Disability Studies vorangetrieben werden können. Die Arbeit strebt danach, ein tieferes Verständnis für die Entwicklung des Umgangs mit Menschen mit Behinderung in Deutschland zu entwickeln und das Potential der Disability Studies als transformative Kraft zu beleuchten. Die Arbeit thematisiert dabei folgende Schwerpunkte: * **Die historische Entwicklung des Umgangs mit Menschen mit Behinderung in Deutschland**: Von der Stigmatisierung und Exklusion im Nationalsozialismus hin zur Entwicklung von Interessenvertretungen nach dem Zweiten Weltkrieg. * **Die Disability Studies als Perspektivenwechsel**: Die Arbeit stellt die Disability Studies und deren Kritik an traditionellen Denkmustern von Behinderung vor, insbesondere an dem individuellen Modell und dem sozialen Modell. * **Das kulturelle Modell von Behinderung**: Die Arbeit beleuchtet das kulturelle Modell von Behinderung als alternative Denkweise und untersucht dessen Einfluss auf die Disability Studies. * **Das Potenzial der Disability Studies für die Inklusion**: Die Arbeit untersucht, wie die Disability Studies zur Umsetzung des Paradigmas der Inklusion in Deutschland beitragen können, mit besonderem Fokus auf die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN-BRK). * **Das Stigma der Behinderung**: Die Arbeit betrachtet die anhaltenden Herausforderungen und das Stigma, das Menschen mit Behinderung in der heutigen Gesellschaft weiterhin erleben.Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Bachelorarbeit ein und legt die Relevanz des Themas im Kontext der deutschen Behindertenhilfe dar. Kapitel 1 beleuchtet die historische Entwicklung des Umgangs mit Menschen mit Behinderung in Deutschland, beginnend mit der NS-Zeit und der Eugenik bis hin zur Entwicklung von Interessenvertretungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Kapitel 2 stellt die Disability Studies vor, fokussiert auf ihre Entstehung, ihre Kritik an traditionellen Modellen von Behinderung und das Konzept des kulturellen Modells von Behinderung. Kapitel 3 untersucht das Potenzial der Disability Studies für die Transformation der deutschen Gesellschaftsordnung im Sinne des Paradigmas der Inklusion, beleuchtet die UN-BRK und deren Bedeutung für die Umsetzung von Inklusion in Deutschland.Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Inklusion, Disability Studies, Behinderung, Stigmatisierung, Exklusion, gesellschaftliche Transformation, Interessenvertretung, UN-BRK, Deutschland, soziales Modell, kulturelles Modell, individuelles Modell. Die Arbeit befasst sich mit der kritischen Analyse des Umgangs mit Menschen mit Behinderung und strebt danach, den Wandel hin zu einer inklusiven Gesellschaft zu fördern.
Ende der Leseprobe aus 80 Seiten
- nach oben
Details
- Titel
- Das Paradigma einer inklusiven Gesellschaft
- Untertitel
- Von der Stigmatisierung und Exklusion zur gleichberechtigten Partizipation von Menschen mit Behinderung. Transformationsprozesse in der deutschen Behindertenhilfe mit dem Fokus auf den Disability Studies
- Hochschule
- Evangelische Hochschule Darmstadt, ehem. Evangelische Fachhochschule Darmstadt
- Note
- 1,0
- Autor
- Timo Krause (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2022
- Seiten
- 80
- Katalognummer
- V1313268
- ISBN (Buch)
- 9783346794475
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- paradigma gesellschaft stigmatisierung exklusion partizipation menschen behinderung transformationsprozesse behindertenhilfe fokus disability studies
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 34,99
- Preis (Book)
- US$ 50,99
- Arbeit zitieren
- Timo Krause (Autor:in), 2022, Das Paradigma einer inklusiven Gesellschaft, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1313268
Allgemein
Autoren
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen
Premium Services
FAQ
Marketing
Dissertationen
Leser & Käufer
Zahlungsmethoden

Copyright
- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Über GRIN
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-