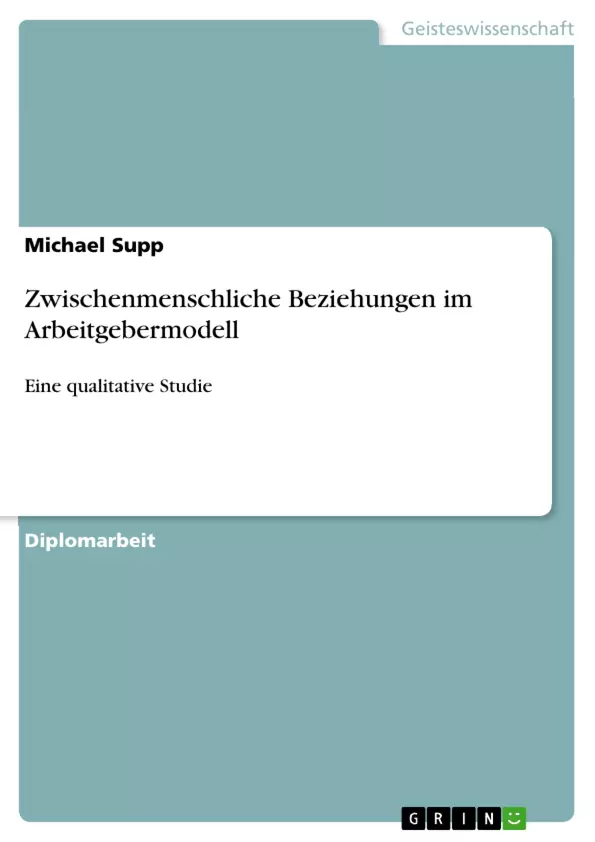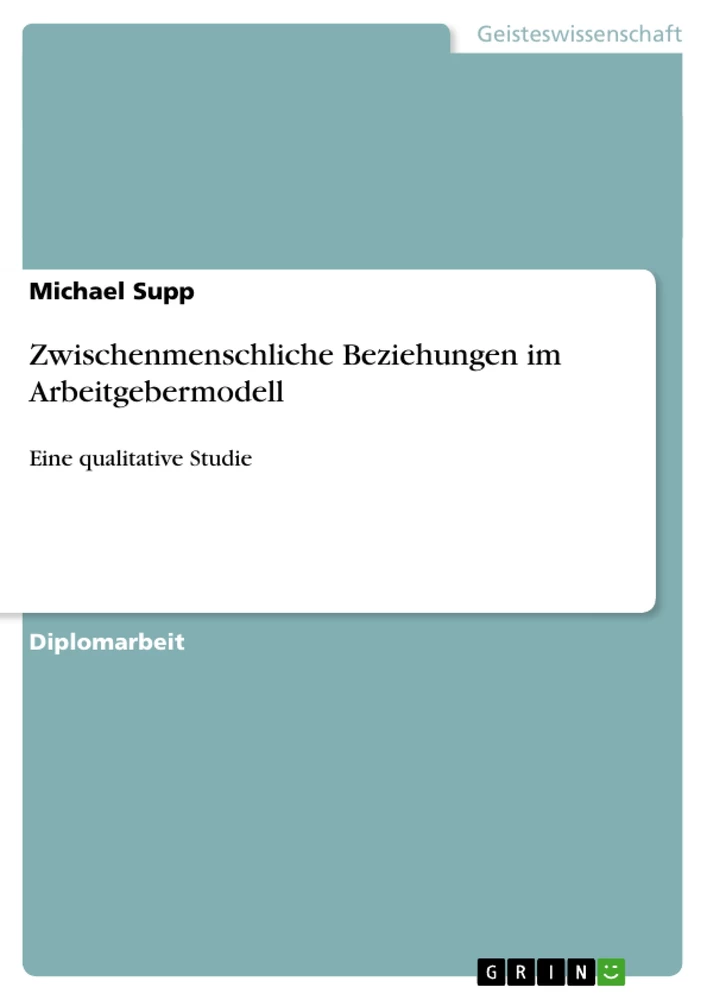
Zwischenmenschliche Beziehungen im Arbeitgebermodell
Diplomarbeit, 2009
109 Seiten, Note: 1.0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen von Behinderung
- Begriffsdefinition Selbstbestimmung
- Arbeitgebermodell
- Geschichtlicher Ursprung
- Inhalt und Aufbau des Arbeitgebermodells
- Zwischenmenschliche Beziehungen
- Begriffsbestimmung Beziehungen und soziale Interaktionen
- Das Wesen von zwischenmenschlichen Beziehungen
- Kognitive Repräsentationen von Beziehungen
- Strukturmerkmale von Beziehungen
- Rollenbeziehungen und persönliche Beziehungen
- Die Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung im Arbeitgebermodell
- Unterstützungsfunktionen von Beziehungen
- Austauschtheoretische Ansätze zur Erklärung zwischenmenschlicher Beziehungen
- Grundlegende Aspekte von zwischenmenschlichen Beziehungen
- Interaktionen innerhalb der Beziehungen
- Reziprozität versus Komplementarität
- Macht
- Intimität
- Interpersonale Wahrnehmung
- Commitment
- Beziehungszufriedenheit
- Zusammenfassung und Fragestellung
- Methoden
- Auswahl der Methode
- Methodisches Vorgehen
- Entwicklung des Interviewleitfadens
- Erhebung
- Auswertung
- Kritische Würdigung
- Die Interviewpaare
- Bernd und Matthias
- Gertrud und Sonja
- Berti und Stefan
- Riccarda und Anne
- Andreas und Frank
- Auswertung
- Soziale Unterstützung
- Instrumentelle soziale Unterstützung
- Psychische soziale Unterstützung
- Gewinn und Verlust
- Gewinn und Verlust Arbeitgeberseite
- Gewinn und Verlust Arbeitnehmerseite
- Beziehungszufriedenheit
- Intimität
- Commitment
- Commitment Arbeitgeberseite
- Commitment Arbeitnehmerseite
- Macht
- Bernd und Matthias
- Gertrud und Sonja
- Berti und Stefan
- Riccarda und Anne
- Andreas und Frank
- Spannungsverhältnis zwischen Macht und Intimität
- Selbstbestimmung
- Reziprozität und Komplementarität
- Gegenseitiger Umgang und Wertschätzung
- Psychische Unterstützung
- Machtverteilung und Rollenreziprozität
- Soziale Unterstützung
- Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die zwischenmenschlichen Beziehungen im Arbeitgebermodell, bei dem behinderte Menschen als Arbeitgeber fungieren und ihre persönlichen Assistenten selbst auswählen. Ziel ist die Erforschung und Analyse dieser Beziehungen, die bisher wenig untersucht wurden. Die Arbeit beleuchtet den Kontext dieser Beziehungen, den Einfluss verschiedener Faktoren auf die Beziehungsgestaltung und die Bedeutung von Selbstbestimmung im Rahmen des Modells.
- Zwischenmenschliche Beziehungen im Arbeitgebermodell
- Selbstbestimmung behinderter Menschen
- Rollenverteilung und Machtstrukturen in der Arbeitgeber-Assistent-Beziehung
- Soziale Unterstützung und Beziehungszufriedenheit
- Gewinn und Verlust für beide Seiten der Beziehung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt das Arbeitgebermodell, bei dem behinderte Menschen ihre Assistenten selbst einstellen und so ihre Selbstbestimmung fördern. Sie hebt die Forschungslücke bezüglich der zwischenmenschlichen Beziehungen in diesem Kontext hervor und skizziert den Aufbau der Arbeit. Die Arbeit fokussiert sich auf die Analyse dieser Beziehungen und ihrer verschiedenen Facetten. Das Modell, in dem der behinderte Mensch als Arbeitgeber fungiert und die Assistenzleistungen einen direkten Einfluss auf dessen Selbstbestimmung haben, wird als Ausgangspunkt der Untersuchung eingeführt.
Definitionen von Behinderung: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Definitionen von Behinderung. Es beleuchtet die Vielschichtigkeit des Begriffs und die damit verbundenen Herausforderungen für die Gestaltung von unterstützenden Beziehungen. Es dient als Grundlage für das Verständnis des Kontextes, in dem das Arbeitgebermodell und die darin stattfindenden Beziehungen zu betrachten sind. Die unterschiedlichen Perspektiven auf Behinderung, z.B. das medizinische oder das soziale Modell, werden kritisch beleuchtet.
Begriffsdefinition Selbstbestimmung: Dieses Kapitel definiert den zentralen Begriff der Selbstbestimmung im Kontext der Arbeit. Es beschreibt die Bedeutung von Autonomie und Entscheidungsfreiheit für behinderte Menschen und die Rolle des Arbeitgebermodells in der Förderung dieser Selbstbestimmung. Es wird eine klare Abgrenzung zu anderen, verwandten Begriffen vorgenommen, um eine präzise und eindeutige Grundlage für die weitere Analyse zu schaffen. Der Begriff wird sowohl theoretisch als auch praktisch unter verschiedenen Aspekten beleuchtet und definiert.
Arbeitgebermodell: Dieses Kapitel beschreibt das Arbeitgebermodell, seinen geschichtlichen Ursprung, seinen Aufbau und seine Funktionsweise. Es wird der Prozess der Auswahl und der Aufgaben der Assistenten erläutert. Die Bedeutung des Modells als Werkzeug zur Förderung der Selbstbestimmung behinderter Menschen wird detailliert dargestellt. Der Fokus liegt auf den strukturellen Aspekten des Modells und seiner theoretischen Grundlagen.
Zwischenmenschliche Beziehungen: Dieses Kapitel stellt die theoretischen Grundlagen für die Analyse der zwischenmenschlichen Beziehungen dar. Es werden verschiedene Konzepte und Theorien aus der Beziehungswissenschaft eingeführt und auf die spezifischen Gegebenheiten des Arbeitgebermodells angewendet. Hier werden verschiedene Aspekte von Beziehungen wie Machtstrukturen, Intimität, Commitment, Reziprozität und soziale Unterstützung diskutiert. Es dient als theoretisches Fundament für die empirische Untersuchung.
Schlüsselwörter
Arbeitgebermodell, Selbstbestimmung, Behinderung, zwischenmenschliche Beziehungen, soziale Interaktion, Macht, Intimität, Commitment, Reziprozität, Komplementarität, soziale Unterstützung, Assistenz, Interview, qualitative Forschung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Arbeitgebermodell und zwischenmenschlichen Beziehungen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die zwischenmenschlichen Beziehungen im Arbeitgebermodell, in dem Menschen mit Behinderungen ihre persönlichen Assistenten selbst auswählen und beschäftigen. Der Fokus liegt auf der Analyse dieser Beziehungen und den Einflussfaktoren auf deren Gestaltung, insbesondere im Hinblick auf Selbstbestimmung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie Selbstbestimmung behinderter Menschen, die Rollenverteilung und Machtstrukturen in der Arbeitgeber-Assistent-Beziehung, soziale Unterstützung und Beziehungszufriedenheit, sowie die Gewinne und Verluste für beide Seiten der Beziehung. Es werden verschiedene Definitionen von Behinderung diskutiert und das Arbeitgebermodell in seinem geschichtlichen Kontext und seiner Funktionsweise erläutert. Die theoretischen Grundlagen der zwischenmenschlichen Beziehungen, einschließlich Konzepte wie Intimität, Commitment, Reziprozität und Komplementarität, werden ausführlich dargestellt.
Welche Methode wurde angewendet?
Die Arbeit verwendet qualitative Forschungsmethoden, konkret Interviews mit Paaren aus Arbeitgeber*innen und Assistent*innen. Der Interviewleitfaden wurde speziell für die Erforschung der Beziehungen im Arbeitgebermodell entwickelt. Die Auswertung der Interviews fokussiert auf Aspekte wie soziale Unterstützung (instrumentell und psychisch), Gewinn und Verlust, Beziehungszufriedenheit, Intimität, Commitment, Macht, sowie das Spannungsverhältnis zwischen Macht und Intimität, Selbstbestimmung und Reziprozität/Komplementarität.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse der Interviews, analysiert diese im Kontext der theoretischen Grundlagen und zieht Schlussfolgerungen über die zwischenmenschlichen Beziehungen im Arbeitgebermodell. Konkrete Ergebnisse werden für verschiedene Aspekte der Beziehungen (soziale Unterstützung, Macht, Intimität etc.) für einzelne Interviewpaare dargestellt und im Gesamtkontext interpretiert.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Arbeitgebermodell, Selbstbestimmung, Behinderung, zwischenmenschliche Beziehungen, soziale Interaktion, Macht, Intimität, Commitment, Reziprozität, Komplementarität, soziale Unterstützung, Assistenz, Interview, qualitative Forschung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zur Einleitung, Definitionen von Behinderung und Selbstbestimmung, dem Arbeitgebermodell, zwischenmenschlichen Beziehungen, der Methodik, der Vorstellung der Interviewpaare, der Auswertung der Interviews und der Ergebnisse. Ein Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick über die einzelnen Kapitel und Unterkapitel.
Welche Forschungslücke schließt die Arbeit?
Die Arbeit schließt die Forschungslücke bezüglich der wenig untersuchten zwischenmenschlichen Beziehungen im Arbeitgebermodell. Sie leistet einen Beitrag zum Verständnis dieser Beziehungen und ihrer Bedeutung für die Selbstbestimmung behinderter Menschen.
Details
- Titel
- Zwischenmenschliche Beziehungen im Arbeitgebermodell
- Untertitel
- Eine qualitative Studie
- Hochschule
- Ludwig-Maximilians-Universität München
- Note
- 1.0
- Autor
- Michael Supp (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2009
- Seiten
- 109
- Katalognummer
- V131359
- ISBN (Buch)
- 9783640374533
- ISBN (eBook)
- 9783640374823
- Dateigröße
- 1205 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Zwischenmenschliche Beziehungen Arbeitgebermodell Eine Studie
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Michael Supp (Autor:in), 2009, Zwischenmenschliche Beziehungen im Arbeitgebermodell, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/131359
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-