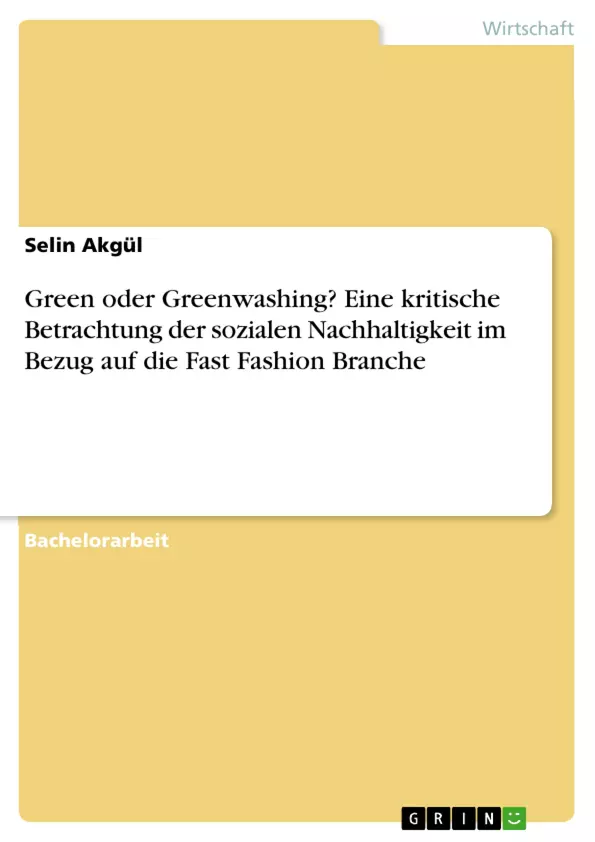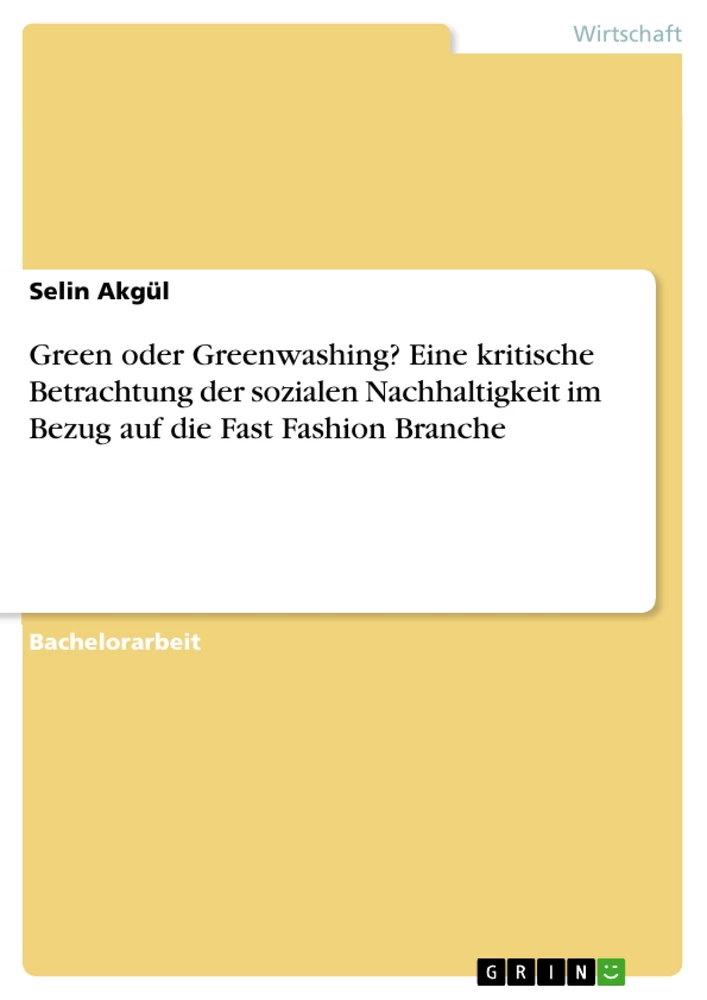
Green oder Greenwashing? Eine kritische Betrachtung der sozialen Nachhaltigkeit im Bezug auf die Fast Fashion Branche
Bachelorarbeit, 2022
80 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- I. ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
- II. ABBILDUNGSVERZEICHNIS
- 1 EINLEITUNG
- 1.1 PROBLEMSTELLUNG UND ZIELSETZUNG
- 1.2 METHODISCHES VORGEHEN UND STRUKTUR DER ARBEIT
- 2 FAST FASHION
- 2.1 DEFINITION DES GESCHÄFTSMODELLS
- 2.2 MODE UND IHR STELLENWERT IN DER GESELLSCHAFT
- 2.3 DIE URSACHEN FÜR FAST FASHION
- 2.3.1 DAS KONSUMVERHALTEN
- 2.3.2 EINFLUSS VON INFLUENCERN UND SOZIALEN MEDIEN
- 2.3.3 SCHNELLE GEWINNERZIELUNG UND BINDUNG DER KUNDSCHAFT
- 2.3.4 GLOBALISIERUNG
- 2.4 SLOW FASHION ALS GEGENBEWEGUNG
- 2.5 ZWISCHENFAZIT
- 3 SOZIALE NACHHALTIGKEIT
- 3.1 URSPRUNG: DAS DREI-SÄULEN-MODELL
- 3.2 DIE SOZIALEN ZIELE DER AGENDA 2030
- 3.3 DAS LIEFERKETTENSORGFALTSPFLICHTENGESETZ
- 3.4 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
- 3.4.1 CSR-KOMMUNIKATION
- 3.4.2 CSR-INSTRUMENTE UND MAẞNAHMEN FÜR MEHR GLAUBWÜRDIGKEIT
- 3.4.2.1 Code of Conduct
- 3.4.2.2 Sustainability-Reporting
- 3.4.2.3 Zertifizierung durch Textilsiegel
- 3.4.2.4 Beitritt in Sozialstandardinitiativen
- 3.5 ZWISCHENFAZIT
- 4 GREENWASHING
- 4.1 DEFINITION
- 4.2 KRITIK AN CSR-MAẞNAHMEN
- 4.3 METHODEN DES GREENWASHINGS
- 4.3.1 VERWIRRENDE UND VAGE BEGRIFFE
- 4.3.2 SELBSTENTWORFENE UND -ERFUNDENE LABELS
- 4.3.3 UNBELEGTE AUSSAGEN TREFFEN
- 4.3.4 EINSEITIGE BETRACHTUNG VON PRODUKTMERKMALEN
- 4.3.5 MANIPULATIVE UND SUGGESTIVE BILDER
- 4.4 ZWISCHENFAZIT
- 5 SOZIALE MISSSTÄNDE IN DER MODEBRANCHE
- 5.1 FALLBEISPIEL: EINSTURZ DES RANA PLAZA IN BANGLADESCH
- 5.2 FALLBEISPIEL: DIE CORONA-PANDEMIE
- 5.3 KRITISCHE ARBEITSBEDINGUNGEN UND SOZIALE AUSWIRKUNGEN
- 5.3.1 NICHT EXISTENZSICHERNDE LÖHNE
- 5.3.2 ÜBERMÄẞIGE ARBEITSZEITEN
- 5.3.3 FEHLENDE GESUNDHEIT UND SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ
- 5.3.4 ZWANGS- UND KINDERARBEIT
- 5.3.5 DISKRIMINIERUNG VON FRAUEN UND CHANCENUNGLEICHHEIT
- 5.4 ZWISCHENFAZIT
- 6 KRITISCHE BETRACHTUNG DER SOZIALEN NACHHALTIGKEIT BEI H&M
- 6.1 DAS UNTERNEHMEN H&M
- 6.2 CSR AUF SOZIALER EBENE BEI H&M
- 6.3 EXTERNE BEURTEILUNG UND KRITISCHE BETRACHTUNG DER SOZIALEN NACHHALTIGKEIT
- 6.4 ZWISCHENFAZIT
- 7 FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der kritischen Betrachtung der sozialen Nachhaltigkeit im Kontext der Fast Fashion Branche. Sie analysiert die Herausforderungen und Chancen, die mit der Produktion und dem Konsum von Kleidung im Zeitalter der Schnelllebigkeit verbunden sind.
- Das Geschäftsmodell der Fast Fashion
- Soziale Nachhaltigkeit und ihre Bedeutung für die Modebranche
- Greenwashing und seine Auswirkungen auf die Glaubwürdigkeit von CSR-Maßnahmen
- Soziale Missstände in der Textilindustrie
- Eine Fallstudie zur Analyse der sozialen Nachhaltigkeit bei H&M
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und definiert die Problemstellung sowie die Zielsetzung der Arbeit. Kapitel 2 beleuchtet das Geschäftsmodell der Fast Fashion und analysiert die Ursachen für die rasante Entwicklung dieser Branche. Hierbei werden insbesondere die Rolle des Konsumverhaltens, der Einfluss von Influencern und sozialen Medien, die schnelle Gewinnerzielung sowie die Globalisierung betrachtet. Das dritte Kapitel widmet sich dem Konzept der sozialen Nachhaltigkeit und beleuchtet verschiedene Aspekte, wie das Drei-Säulen-Modell, die sozialen Ziele der Agenda 2030, das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz und die Bedeutung von Corporate Social Responsibility (CSR). Kapitel 4 beleuchtet die Problematik des Greenwashings und die kritischen Methoden, mit denen Unternehmen versuchen, Nachhaltigkeit zu suggerieren, ohne diese wirklich zu praktizieren. In Kapitel 5 werden soziale Missstände in der Modebranche anhand konkreter Fallbeispiele, wie dem Einsturz des Rana Plaza in Bangladesch und der Corona-Pandemie, dargestellt. Zudem werden die problematischen Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie, wie nicht existenzsichernde Löhne, übermäßige Arbeitszeiten, fehlende Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, Zwangs- und Kinderarbeit sowie Diskriminierung von Frauen, analysiert. Im sechsten Kapitel wird das Unternehmen H&M als Fallbeispiel betrachtet und seine CSR-Aktivitäten auf sozialer Ebene kritisch beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Schlüsselwörter Fast Fashion, soziale Nachhaltigkeit, Greenwashing, CSR, Lieferketten, Arbeitsbedingungen, Textilindustrie, Konsumverhalten, Influencer, Globalisierung, Modebranche, H&M und Fallstudie. Die Analyse fokussiert auf die Auswirkungen der Fast Fashion auf die soziale Nachhaltigkeit und die Herausforderungen, die mit der Implementierung von CSR-Maßnahmen in dieser Branche verbunden sind.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Fast Fashion?
Fast Fashion bezeichnet ein Geschäftsmodell der Modeindustrie, das auf schnelle Produktion, niedrige Preise und ständig neue Kollektionen setzt, um den Massenkonsum zu fördern.
Was bedeutet Greenwashing in der Modebranche?
Greenwashing ist der Versuch von Unternehmen, sich durch vage Begriffe, unbelegte Aussagen oder manipulative Bilder ein umweltfreundliches und sozial verantwortliches Image zu geben, ohne dies wirklich umzusetzen.
Welche sozialen Missstände herrschen in der Textilindustrie?
Häufige Probleme sind Löhne unter dem Existenzminimum, übermäßige Arbeitszeiten, Kinderarbeit, Diskriminierung von Frauen und mangelnde Sicherheit am Arbeitsplatz.
Was war das Rana-Plaza-Unglück?
Der Einsturz des Rana-Plaza-Gebäudes in Bangladesch im Jahr 2013 ist ein zentrales Beispiel für die katastrophalen Sicherheitsmängel in der Fast-Fashion-Lieferkette.
Wie glaubwürdig ist das CSR-Engagement von H&M?
Die Arbeit untersucht kritisch die Diskrepanz zwischen der Selbstdarstellung von H&M und der Wirklichkeit der Arbeitsbedingungen in den Produktionsländern.
Details
- Titel
- Green oder Greenwashing? Eine kritische Betrachtung der sozialen Nachhaltigkeit im Bezug auf die Fast Fashion Branche
- Hochschule
- Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach
- Note
- 1,7
- Autor
- Selin Akgül (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2022
- Seiten
- 80
- Katalognummer
- V1315522
- ISBN (Buch)
- 9783346797704
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- green greenwashing eine betrachtung nachhaltigkeit bezug fast fashion branche
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 31,99
- Preis (Book)
- US$ 45,99
- Arbeit zitieren
- Selin Akgül (Autor:in), 2022, Green oder Greenwashing? Eine kritische Betrachtung der sozialen Nachhaltigkeit im Bezug auf die Fast Fashion Branche, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1315522
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-