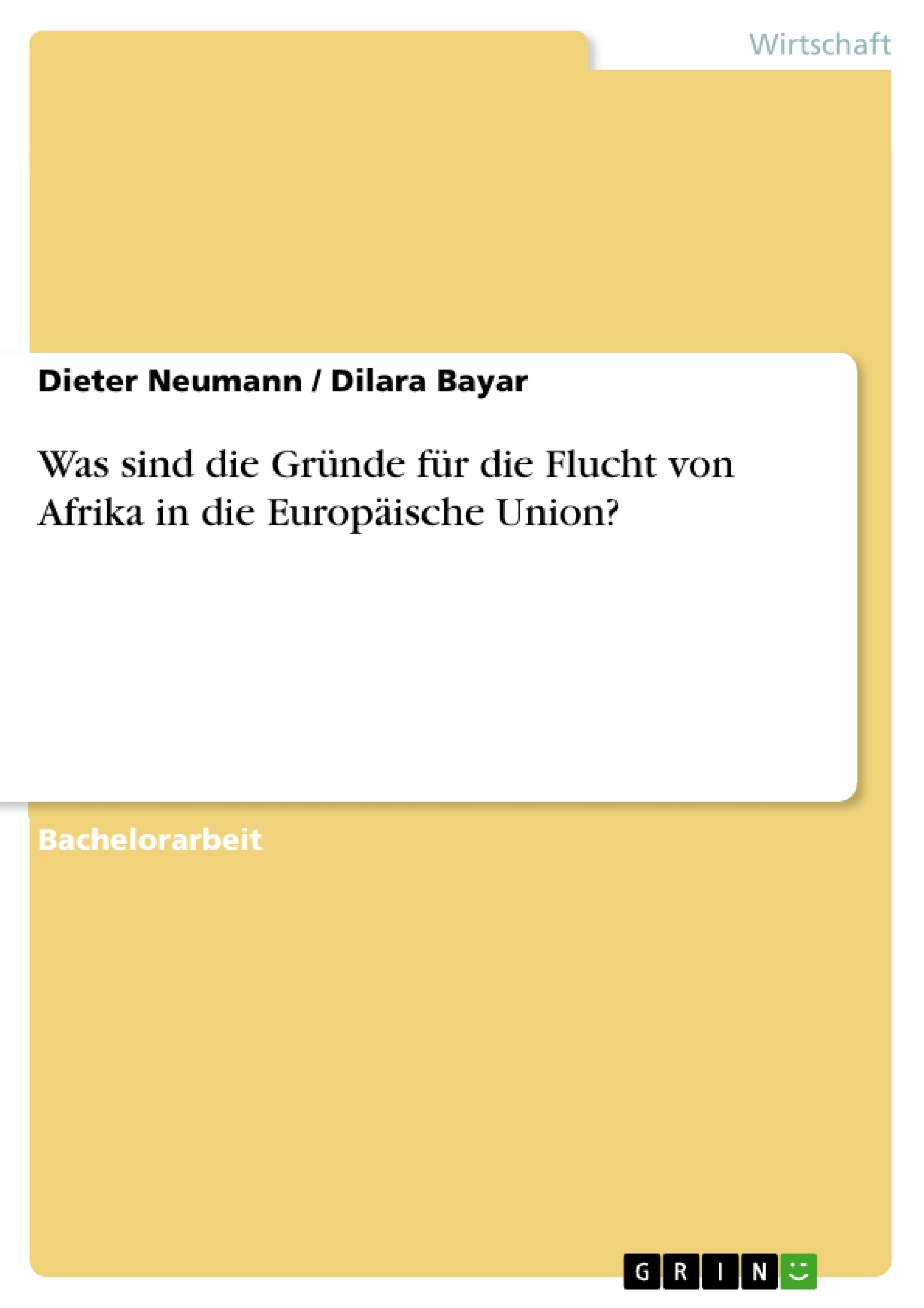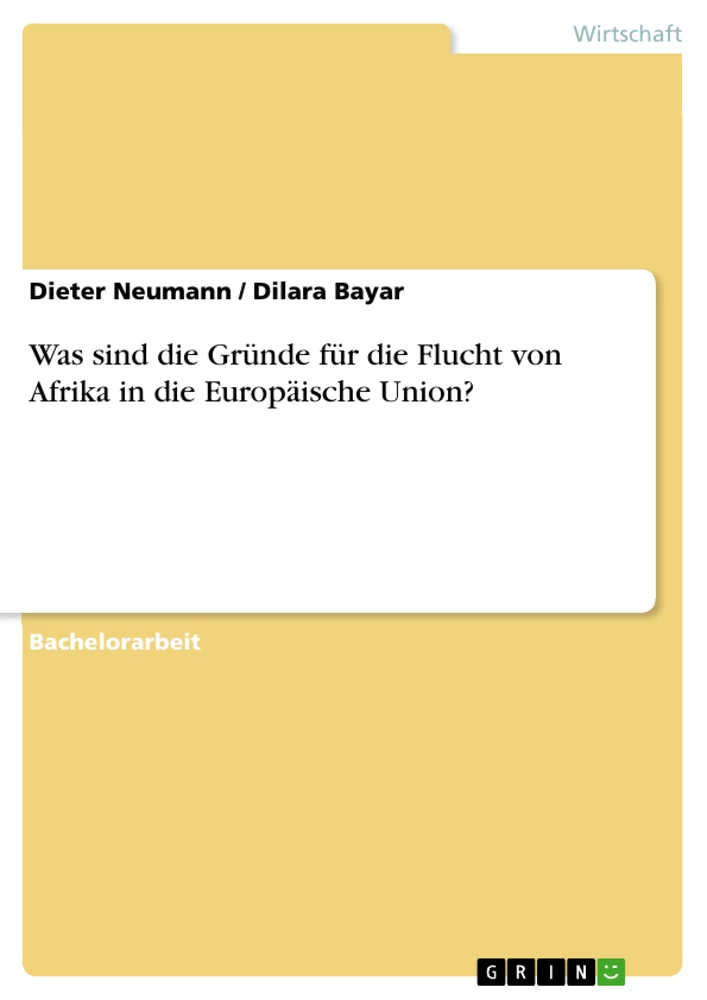
Was sind die Gründe für die Flucht von Afrika in die Europäische Union?
Bachelorarbeit, 2022
76 Seiten, Note: 2,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Ziel der Untersuchung
- 1.2 Aufbau des Buches
- 2 Grundlagen
- 2.1 Flucht und Migration: Definitionen
- 2.2 Migration von Afrika: Ehemalige Kolonialmächte als Hauptzielländer
- 2.3 Regionale Ausprägungen von Migration von Afrika in die Europäische Union
- 3 Gründe für Flucht und Migration
- 3.1 Gründe für die Flucht
- 3.1.1 Politische Gründe
- 3.1.2 Umweltbedingte Gründe
- 3.2 Gründe für die Migration
- 3.2.1 Theoretischer Hintergrund
- 3.2.2 Demografische Gründe
- 3.2.3 Ökonomische Gründe
- 3.2.4 Soziale Faktoren
- 3.2.5 Soziale Netzwerke
- 4 Regulierung der Flucht und Migration durch die Europäische Union
- 4.1 Die Asyl- und Migrationspolitik der europäischen Länder
- 4.2 Europäisch-afrikanische Kooperation in der Migrationspolitik
- 5 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Buch untersucht die Ursachen der Flucht von Afrika in die Europäische Union. Es beleuchtet sowohl die politischen und ökologischen Bedingungen in Afrika als auch die wirtschaftlichen, sozialen und demografischen Faktoren, die Menschen zur Flucht und Migration bewegen. Das Buch analysiert außerdem die Politik der Europäischen Union zur Regulierung von Flucht und Migration sowie die Zusammenarbeit mit afrikanischen Staaten in diesem Bereich.
- Flucht und Migration aus Afrika in die Europäische Union
- Politische, ökologische und wirtschaftliche Ursachen für Flucht und Migration
- Demografische und soziale Faktoren, die zur Flucht und Migration beitragen
- Die Rolle der Europäischen Union bei der Regulierung von Flucht und Migration
- Die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und Afrika in der Migrationspolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel des Buches definiert die Begriffe Flucht und Migration und skizziert die Herausforderungen, die diese Phänomene für die Europäische Union mit sich bringen. Das zweite Kapitel beleuchtet die historischen Wurzeln der Migration von Afrika in die Europäischen Union und untersucht die Rolle ehemaliger Kolonialmächte. Es analysiert auch die regionalen Unterschiede in der Migration von Afrika in die Europäische Union. Das dritte Kapitel konzentriert sich auf die Ursachen für Flucht und Migration. Es untersucht sowohl die politischen und ökologischen Bedingungen in Afrika als auch die wirtschaftlichen, sozialen und demografischen Faktoren, die Menschen zur Flucht und Migration bewegen. Das vierte Kapitel analysiert die Politik der Europäischen Union zur Regulierung von Flucht und Migration sowie die Zusammenarbeit mit afrikanischen Staaten in diesem Bereich. Das fünfte Kapitel fasst die wichtigsten Erkenntnisse des Buches zusammen und gibt einen Ausblick auf die Herausforderungen, die sich in Zukunft in Bezug auf Flucht und Migration stellen werden.
Schlüsselwörter
Flucht, Migration, Afrika, Europäische Union, Politik, Ökologie, Demografie, Wirtschaft, Soziales, Asyl, Integration, Entwicklungszusammenarbeit
Details
- Titel
- Was sind die Gründe für die Flucht von Afrika in die Europäische Union?
- Hochschule
- Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen; Standort Nürtingen
- Note
- 2,0
- Autoren
- Dieter Neumann (Autor:in), Dilara Bayar (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2022
- Seiten
- 76
- Katalognummer
- V1315568
- ISBN (Buch)
- 9783346798312
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Doppelautorenschaft siehe Titel
- Schlagworte
- Flucht Migration
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 31,99
- Preis (Book)
- US$ 45,99
- Arbeit zitieren
- Dieter Neumann (Autor:in), Dilara Bayar (Autor:in), 2022, Was sind die Gründe für die Flucht von Afrika in die Europäische Union?, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1315568
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-