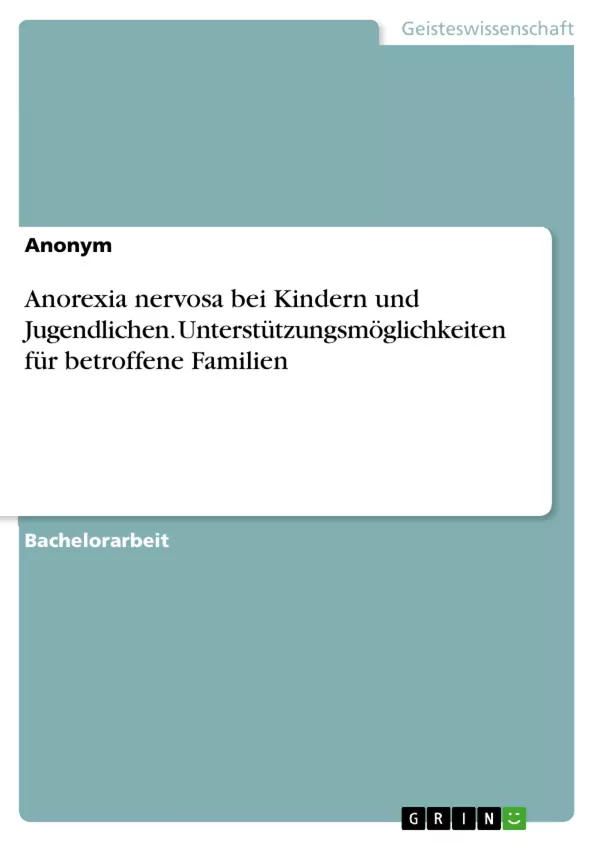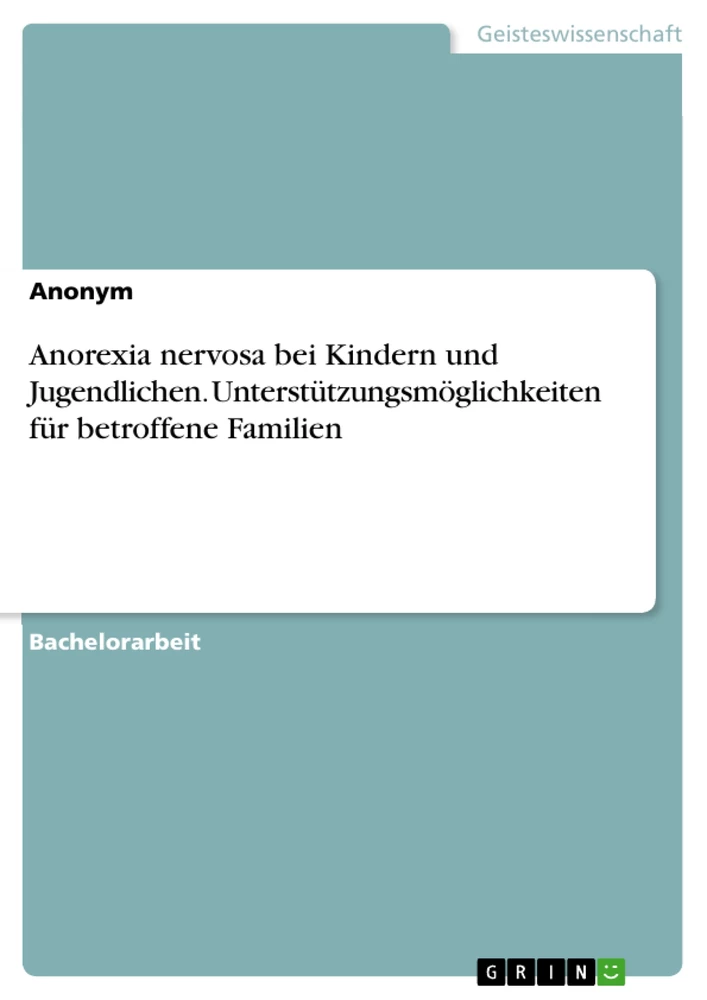
Anorexia nervosa bei Kindern und Jugendlichen. Unterstützungsmöglichkeiten für betroffene Familien
Bachelorarbeit, 2018
42 Seiten, Note: 2,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fallvignette
- Begriffsbestimmung
- Einführung
- Grundaussage des systemischen Theorieansatzes
- Krankheit und das System
- Familie und das System
- Mögliche Auswirkungen einer psychischen Diagnose
- Anorexia nervosa
- Erklärungsansätze
- Charakteristische Symptome
- Auswirkungen auf die Familie
- Die Familie
- Emotionale Folgen
- Partnerschaftliche Folgen
- Bedeutung für den Jugendlichen
- Unterstützungsmöglichkeiten
- Ressourcen
- Professionelle Unterstützung für Betroffene
- Professionelle Unterstützung für Angehörige
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit der Unterstützung von Familien, deren Kind an Anorexia nervosa erkrankt ist. Ziel ist es, anhand eines Fallbeispiels und theoretischer Grundlagen, Handlungsmöglichkeiten und Ressourcen aufzuzeigen, die Familien in dieser herausfordernden Situation helfen können.
- Der systemische Ansatz nach N. Luhmann und seine Anwendung auf die Problematik von Anorexia nervosa
- Die Auswirkungen von Anorexia nervosa auf die Familie, den Partner und den Jugendlichen selbst
- Die Bedeutung von Ressourcen und Unterstützungsmöglichkeiten für die Familie und den Betroffenen
- Die Rolle und Bedeutung der professionellen Unterstützung für beide Seiten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Bedeutung von Anorexia nervosa und die Herausforderungen für Familien beleuchtet. Anschließend wird ein Fallbeispiel vorgestellt, das den Ausgangspunkt für die Analyse bildet. In den folgenden Kapiteln werden zentrale Begriffe wie Familie, Partner und Jugendlicher definiert und der systemische Ansatz nach N. Luhmann erläutert. Es werden die Auswirkungen von Anorexia nervosa auf die Familie und die verschiedenen Ressourcen der Familienmitglieder beleuchtet. Die Arbeit endet mit einer Diskussion über Unterstützungsmöglichkeiten für Familien und Betroffene sowie mit einem Fazit, das die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfasst.
Schlüsselwörter
Anorexia nervosa, Systemtheorie, N. Luhmann, Familie, Partner, Jugendlicher, Ressourcen, Unterstützungsmöglichkeiten, professionelle Unterstützung, Fallbeispiel
Häufig gestellte Fragen
Wie können Familien unterstützt werden, wenn ein Kind an Anorexia nervosa erkrankt?
Unterstützung erfolgt durch Beratung, die Einbeziehung der Ressourcen aller Familienmitglieder und professionelle Hilfe, die sowohl auf den Betroffenen als auch auf die Angehörigen zugeschnitten ist.
Was besagt der systemische Ansatz nach Luhmann bei Essstörungen?
Der systemische Ansatz betrachtet Krankheit und Familie als miteinander verknüpfte Systeme. Er hilft dabei, Probleme und Unterstützungsmöglichkeiten an den richtigen Punkten des familiären Prozesses zu identifizieren.
Welche Symptome sind charakteristisch für Anorexia nervosa?
Die Arbeit erläutert die Voraussetzungen für eine Diagnose, zu denen unter anderem ein extremes Untergewicht, die bewusste Einschränkung der Nahrungsaufnahme und eine verzerrte Wahrnehmung des eigenen Körpers gehören.
Welche Folgen hat die Erkrankung für die Eltern und das Familiensystem?
Anorexia nervosa belastet die gesamte Familie emotional und kann zu partnerschaftlichen Problemen zwischen den Eltern führen. Oft ist das gesamte häusliche Gleichgewicht durch die Krankheit gestört.
Was ist für eine gute sozialarbeiterische Beratung in diesem Bereich wichtig?
Wichtig sind Fachwissen über das Krankheitsbild, eine systemische Sichtweise sowie die Fähigkeit, die individuellen Ressourcen der Familie zu aktivieren, um eine nachhaltige Unterstützung zu gewährleisten.
Details
- Titel
- Anorexia nervosa bei Kindern und Jugendlichen. Unterstützungsmöglichkeiten für betroffene Familien
- Hochschule
- Universität Kassel
- Note
- 2,0
- Autor
- Anonym (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2018
- Seiten
- 42
- Katalognummer
- V1315977
- ISBN (Buch)
- 9783346798688
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Anorexia Nervosa Familie Essstörung Kind
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2018, Anorexia nervosa bei Kindern und Jugendlichen. Unterstützungsmöglichkeiten für betroffene Familien, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1315977
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-