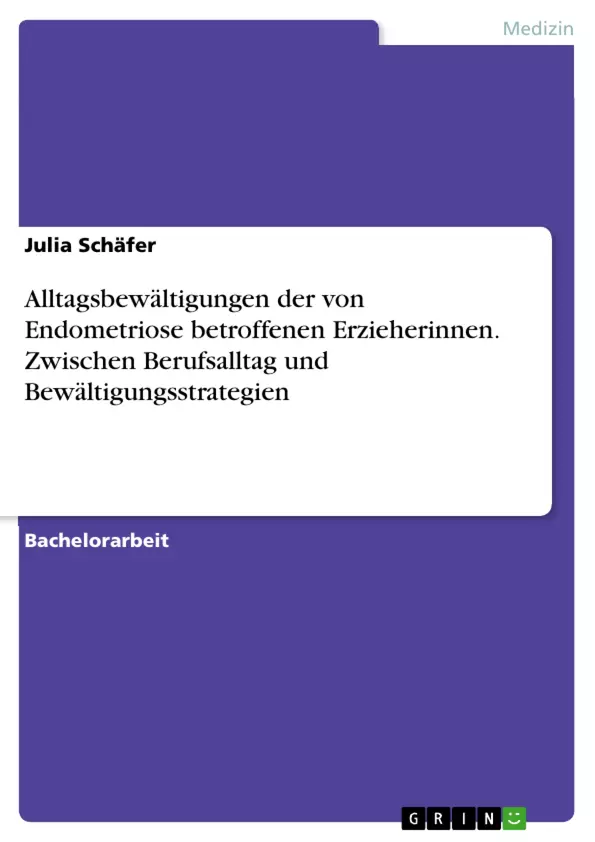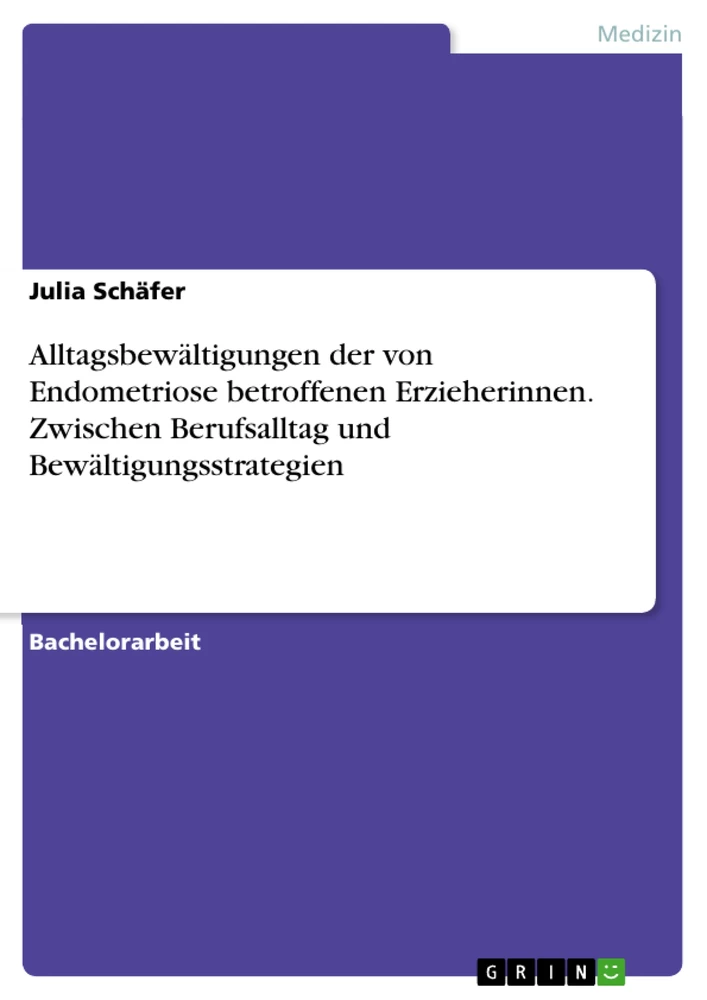
Alltagsbewältigungen der von Endometriose betroffenen Erzieherinnen. Zwischen Berufsalltag und Bewältigungsstrategien
Bachelorarbeit, 2022
130 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Methodenbeschreibung des Fragebogen „Erzieher:innen mit Herz und das Leben mit Endometriose“
- 1.1 Infos über die untersuchten Objekte
- 1.2 Infos über verwendete Materialien
- 1.3 Vorgehensweise der Untersuchung
- 1.4 Ergebnisse
- 2. Die chronische Erkrankung Endometriose und deren Bedeutsamkeit in der heutigen Zeit
- 2.1 Darstellung und Bedeutung der Erkrankung Endometriose
- 2.2 Symptome der Endometrioserkrankung
- 2.3 Das Entstehen der Endometrioseerkrankung
- 3. Berufsalltagsleiden von Endometriose betroffenen Erzieher:innen
- 3.1 Akuter Personalmangel
- 3.2 Die vielfältigen Tätigkeitsbereiche in Kindertagesstätten und deren alltäglichen Anforderungen
- 3.3 Einschränkungen anhand des bio-psycho-sozialen Modells
- 3.4 Stressbewältigung
- 4. Bewältigungsstrategien am Arbeitsplatz
- 4.1 Kommunikation im Team
- 4.2 Achtgebung der eigenen Gesundheit am Arbeitsplatz
- 4.3 Soziale Unterstützung
- 4.4 Schwerbehindertenausweis
- 4.5 Weiterbildungsmöglichkeiten zur Schmerzlinderung
- 4.6 Schmerzlinderung durch Bewegungseinheiten und Ruhe
- 4.7 Ernährung
- 5. Auseinandersetzung mit der Endometrioseerkrankung anhand von Unterstützungs-möglichkeiten
- 5.1 Selbsthilfeorganisation
- 5.2 Endometrioseberatung
- 5.3 Selbsthilfegruppen
- 5.4 Psychologische Begleitung
- 6. Das Selbsterkennen von Teufelskreisproblematiken und Steigerung der eigenen Lebens-qualitäten anhand von Therapieansatzmöglichkeiten
- 6.1 Naturheilkunde
- 6.2 Traditionelle Chinesische Medizin (TCM)
- 6.3 Akupunktur
- 6.4 Homöopathie
- 6.5 Systemische Autoregulationstherapie (SART)
- 6.6 Physiotherapie und Osteopathie
- 6.7 Massagetherapien
- 6.8 Entspannungsaktivitäten und Entspannungsübungen
- 6.9 Methode Wildfuchs
- 7. Schmerzreduktion anhand Methoden der Schulmedizin
- 7.1 Schmerztherapie
- 7.2 Hormontherapie
- 7.3 Operation
- 7.4 Rehabilitation
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit den Alltagsbewältigungen von Erzieher:innen, die unter Endometriose leiden. Sie untersucht, welchen Herausforderungen diese im Berufsalltag der Kindertagesstätte gegenüberstehen und welche Bewältigungsstrategien sie einsetzen können. Die Arbeit basiert auf einer empirischen Untersuchung mittels eines eigens entwickelten Fragebogens und beleuchtet die Erkrankung Endometriose, ihre Symptome und Ursachen. Besonderes Augenmerk liegt auf der Darstellung von Bewältigungsstrategien und Lösungsansätzen für Erzieher:innen, um den Berufsalltag trotz der Erkrankung zu meistern.
- Herausforderungen im Berufsalltag von Erzieher:innen mit Endometriose
- Bewältigungsstrategien im Berufsalltag
- Definition und Beschreibung der Erkrankung Endometriose
- Lösungsansätze und Unterstützungsmöglichkeiten für Erzieher:innen
- Achtgeben auf die eigene Gesundheit im Kontext der Endometriose
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Bachelorarbeit ein, stellt die Fragestellung vor und erläutert die methodische Vorgehensweise. Kapitel 1 beschreibt den Fragebogen „Erzieher:innen mit Herz und das Leben mit Endometriose“, die untersuchten Objekte, verwendete Materialien und die Vorgehensweise der Untersuchung. Kapitel 2 definiert die chronische Erkrankung Endometriose, beleuchtet ihre Symptome und Ursachen sowie ihre Relevanz in der heutigen Zeit. Kapitel 3 beschäftigt sich mit den Belastungen im Berufsalltag von Erzieher:innen mit Endometriose und untersucht die vielfältigen Tätigkeitsbereiche in Kindertagesstätten sowie deren Anforderungen im Kontext der Erkrankung. Die Bewältigungsstrategien am Arbeitsplatz werden in Kapitel 4 analysiert und die Themen Kommunikation im Team, Achtgebung der eigenen Gesundheit, soziale Unterstützung, Schwerbehindertenausweis, Weiterbildungsmöglichkeiten, Schmerzlinderung durch Bewegung und Ernährung werden beleuchtet. Kapitel 5 stellt verschiedene Unterstützungs-möglichkeiten für Betroffene vor, wie Selbsthilfeorganisationen, Endometrioseberatung, Selbsthilfegruppen und psychologische Begleitung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Endometriose, eine chronische Erkrankung, die vor allem Frauen betrifft und sich durch Schmerzen, Unfruchtbarkeit und andere Symptome manifestiert. Die Untersuchung befasst sich mit den Herausforderungen und Bewältigungsstrategien von Erzieher:innen mit Endometriose im Berufsalltag der Kindertagesstätte. Wichtige Themen sind dabei der Umgang mit Stress, die Bedeutung von sozialer Unterstützung, die Suche nach geeigneten Weiterbildungsmöglichkeiten sowie die Anwendung von Therapieansätzen zur Schmerzlinderung und Verbesserung der Lebensqualität.
Häufig gestellte Fragen
Wie wirkt sich Endometriose auf den Beruf der Erzieherin aus?
Die chronischen Schmerzen und körperlichen Beeinträchtigungen stellen im körperlich fordernden Kita-Alltag und bei Personalmangel eine enorme Herausforderung dar.
Welche Bewältigungsstrategien gibt es für den Arbeitsplatz?
Wichtige Strategien sind offene Kommunikation im Team, soziale Unterstützung, gesunde Ernährung sowie gezielte Ruhe- und Bewegungseinheiten zur Schmerzlinderung.
Welche schulmedizinischen Therapien werden bei Endometriose eingesetzt?
Dazu gehören Schmerztherapie, Hormonbehandlungen, operative Eingriffe und medizinische Rehabilitation.
Welche alternativen Heilmethoden können helfen?
Die Arbeit nennt unter anderem Traditionelle Chinesische Medizin (TCM), Akupunktur, Homöopathie, Osteopathie und Entspannungsübungen.
Wo finden betroffene Erzieherinnen Unterstützung?
Unterstützung bieten Selbsthilfeorganisationen, spezielle Endometrioseberatungsstellen, Selbsthilfegruppen und psychologische Begleitungen.
Details
- Titel
- Alltagsbewältigungen der von Endometriose betroffenen Erzieherinnen. Zwischen Berufsalltag und Bewältigungsstrategien
- Hochschule
- Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter
- Note
- 1,7
- Autor
- Julia Schäfer (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2022
- Seiten
- 130
- Katalognummer
- V1316617
- ISBN (Buch)
- 9783346795731
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- alltagsbewältigungen endometriose erzieherinnen zwischen berufsalltag bewältigungsstrategien
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 39,99
- Preis (Book)
- US$ 50,99
- Arbeit zitieren
- Julia Schäfer (Autor:in), 2022, Alltagsbewältigungen der von Endometriose betroffenen Erzieherinnen. Zwischen Berufsalltag und Bewältigungsstrategien, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1316617
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-