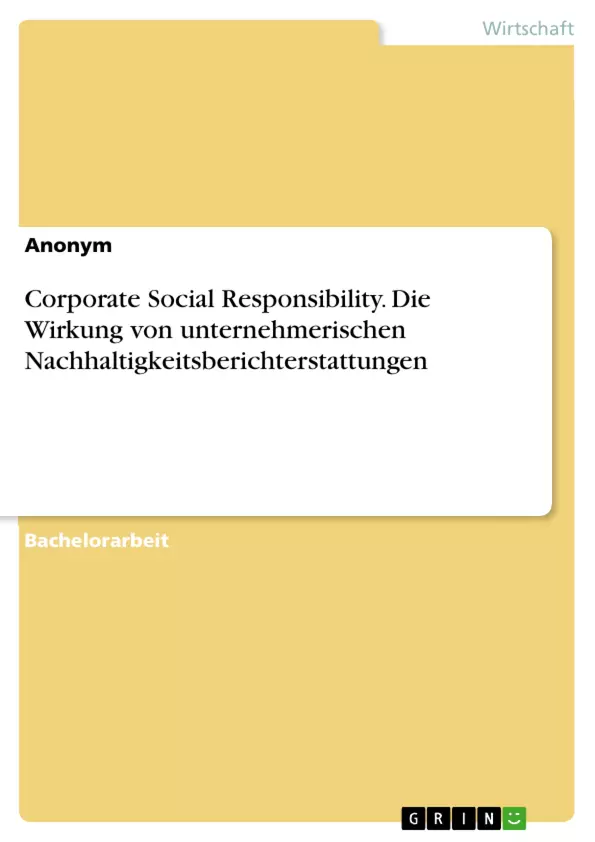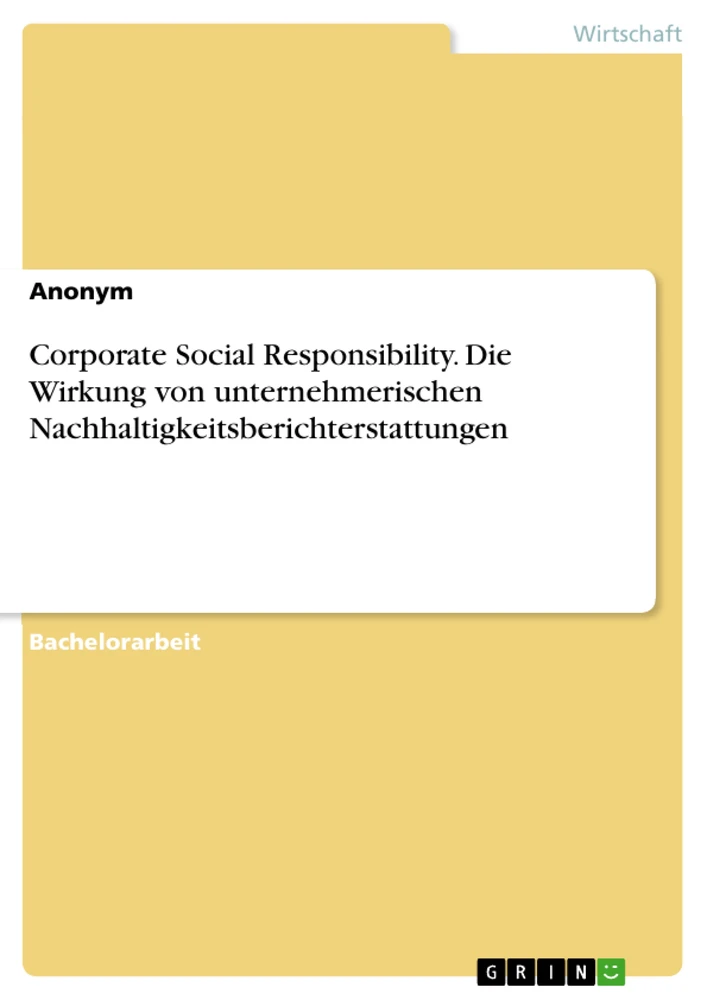
Corporate Social Responsibility. Die Wirkung von unternehmerischen Nachhaltigkeitsberichterstattungen
Bachelorarbeit
52 Seiten
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Motivation und Zielsetzung
- Vorgehensweise und Aufbau
- Corporate Social Responsibility
- Definition und Abgrenzung von ähnlichen Begriffen
- Historische Entwicklung der Nachhaltigkeitsberichterstattung
- Gesetzliche Regelung
- Theorien des Corporate Social Responsibility
- Agency Theorie
- Signal Theorie
- Legitimitätstheorie
- Stakeholder Theorie nach Freeman
- Shareholder-Value nach Friedman
- Triple Bottom Line nach Elkington
- Corporate Social Responsibility Pyramide nach Caroll
- Wirkungen von Corporate Social Responsibility Berichten
- Interne Auswirkungen des Unternehmens
- Wirksamkeit auf den Kapitalmarkt und den Eigenkapitalkosten
- Folgewirkungen auf den Unternehmenswert
- Corporate Social Responsibility Berichte als Erfolgsfaktor
- Unternehmensreputation und soziale Ziele
- Steigerung der Profitabilität
- Weitere unternehmensspezifische Wirkungen des Nachhaltigkeitsberichtes
- Schattenseiten der Wirksamkeit des Nachhaltigkeitsberichtes
- Greenwashing
- Impression Management
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Wirkung von unternehmerischer Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ziel ist es, die verschiedenen Theorien des Corporate Social Responsibility (CSR) darzustellen und die Auswirkungen von Nachhaltigkeitsberichten sowohl auf das Unternehmen selbst als auch auf externe Stakeholder zu untersuchen.
- Definition und Abgrenzung von CSR
- Theorien des CSR und deren Implikationen für die Berichterstattung
- Interne und externe Wirkungen von Nachhaltigkeitsberichten
- Potenzielle Schattenseiten der Nachhaltigkeitsberichterstattung
- Bedeutung von CSR für Unternehmenserfolg und Reputation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Motivation und die Zielsetzung der Arbeit darlegt. Anschließend wird das Konzept der Corporate Social Responsibility (CSR) definiert und von ähnlichen Begriffen abgegrenzt. Die historische Entwicklung der Nachhaltigkeitsberichterstattung wird erläutert und die rechtlichen Rahmenbedingungen werden vorgestellt. Kapitel 3 befasst sich mit den wichtigsten Theorien des CSR, wobei die Agency Theorie, die Signal Theorie, die Legitimitätstheorie, die Stakeholder Theorie nach Freeman, die Shareholder-Value nach Friedman, die Triple Bottom Line nach Elkington und die Corporate Social Responsibility Pyramide nach Caroll beleuchtet werden. Kapitel 4 analysiert die Wirkungen von CSR-Berichten, sowohl intern auf das Unternehmen als auch extern auf den Kapitalmarkt und die Stakeholder.
Schlüsselwörter
Corporate Social Responsibility, Nachhaltigkeitsberichterstattung, Agency Theorie, Signal Theorie, Legitimitätstheorie, Stakeholder Theorie, Shareholder-Value, Triple Bottom Line, Greenwashing, Impression Management, Unternehmensreputation, Kapitalmarkt, Nachhaltigkeit
Häufig gestellte Fragen
Was untersucht diese Bachelorarbeit zum Thema CSR?
Die Arbeit analysiert die Wirkungen und Motive der unternehmerischen Nachhaltigkeitsberichterstattung (Corporate Social Responsibility).
Welche Theorien werden zur Erklärung von CSR herangezogen?
Es werden unter anderem die Agency Theorie, Signal Theorie, Legitimitätstheorie und die Stakeholder Theorie nach Freeman erläutert.
Was versteht man unter „Greenwashing“?
Greenwashing bezeichnet den Versuch von Unternehmen, sich durch gezielte Desinformation oder irreführende Berichte ein umweltfreundliches Image zu geben, ohne entsprechende Maßnahmen umzusetzen.
Welche internen Auswirkungen hat ein Nachhaltigkeitsbericht?
Berichte können die Eigenkapitalkosten beeinflussen, den Unternehmenswert steigern und die Reputation sowie die Mitarbeiterzufriedenheit verbessern.
Was ist die „Triple Bottom Line“ nach Elkington?
Ein Konzept, das besagt, dass Unternehmen nicht nur ökonomische, sondern auch soziale und ökologische Ziele gleichermaßen verfolgen sollten.
Was beschreibt die CSR-Pyramide nach Carroll?
Sie unterteilt unternehmerische Verantwortung in vier Ebenen: ökonomische, rechtliche, ethische und philanthropische Verantwortung.
Details
- Titel
- Corporate Social Responsibility. Die Wirkung von unternehmerischen Nachhaltigkeitsberichterstattungen
- Hochschule
- Universität Augsburg
- Autor
- Anonym (Autor:in)
- Seiten
- 52
- Katalognummer
- V1317852
- ISBN (Buch)
- 9783346799609
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- corporate social responsibility wirkung nachhaltigkeitsberichterstattungen
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), Corporate Social Responsibility. Die Wirkung von unternehmerischen Nachhaltigkeitsberichterstattungen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1317852
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-