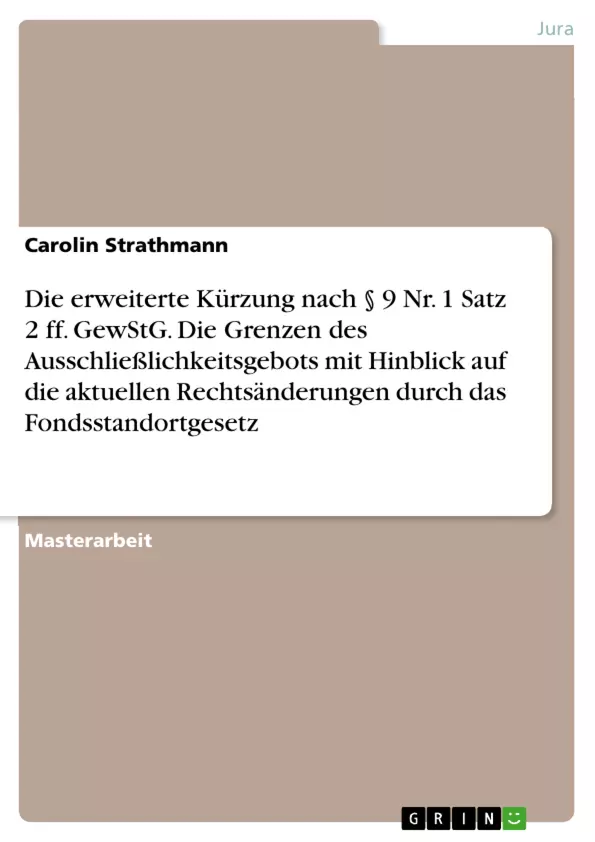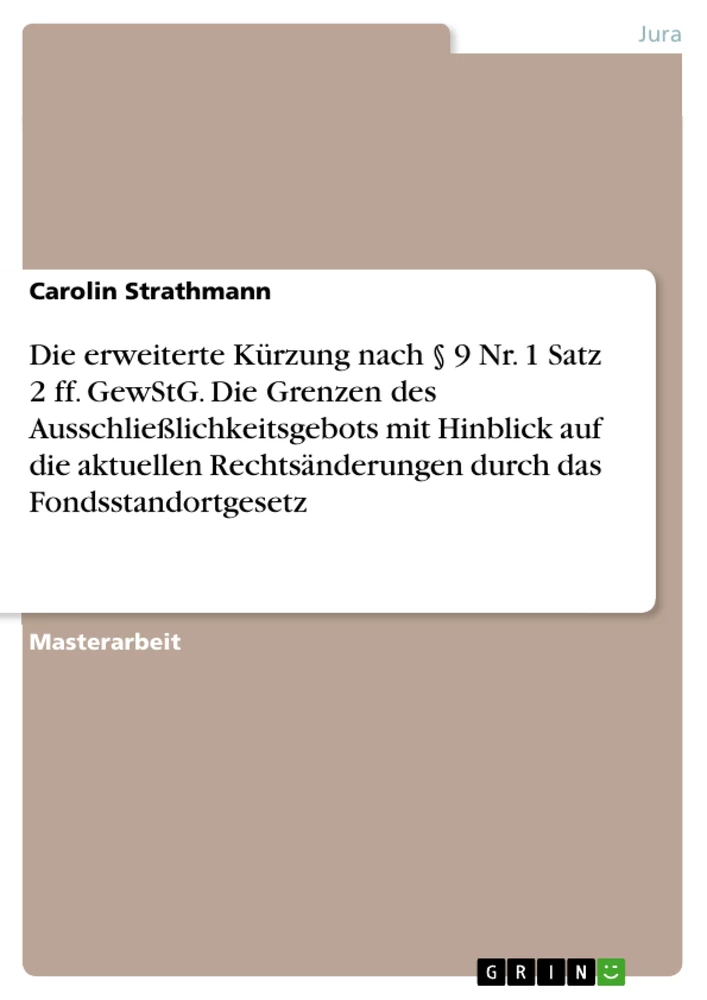
Die erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 ff. GewStG. Die Grenzen des Ausschließlichkeitsgebots mit Hinblick auf die aktuellen Rechtsänderungen durch das Fondsstandortgesetz
Masterarbeit, 2022
61 Seiten, Note: 2,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Relevanz des Themas
- Zielsetzung der Arbeit
- Methodische Vorgehensweise
- Grundsätze der erweiterten Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 ff. GewStG
- Anwendungsbereich und Regelungszweck der Vorschrift
- Verwaltung und Nutzung als vermögensverwaltende Tätigkeit
- Eigener Grundbesitz
- Umfang der Begünstigung
- Zulässige Nebentätigkeiten
- Antragserfordernis – Wahlrecht zwischen der einfachen und der erweiterten Kürzung
- Ausschließlichkeitsgebot des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG
- Tätigkeitsbezogene Ausschließlichkeit
- Reine Vermögensverwaltung in Abgrenzung zur Gewerblichkeit
- Lieferung von Strom
- Grundbesitzbezogene Ausschließlichkeit
- Ausschließlich eigener Grundbesitz
- Weitervermietung von fremdem Grundbesitz
- Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen
- Zeitraumbezogene Ausschließlichkeit
- Ausübung im gesamten Erhebungszeitraum
- Probleme beim unterjährigen Erwerb
- Veräußerung als Verstoß gegen das Ausschließlichkeitskriterium
- Entwicklungstendenzen der restriktiven Auslegung
- Strenges Ausschließlichkeitserfordernis
- Gesichtspunkt der Geringfügigkeit
- Entwicklungstendenzen infolge der jüngeren BFH-Rechtsprechung
- Neue gesetzliche Unschädlichkeitsgrenzen durch das Fondsstandortgesetz
- Unschädliche Einnahmen aus der Lieferung von Strom
- Unschädliche Einnahmen aus unmittelbaren Vertragsbeziehungen mit Mietern
- Bedeutung für die Praxis
- Mögliche Strukturierungsmaßnahmen bei kürzungsschädlichen Tätigkeiten
- Risikominimierung durch Auslagerung
- Risikoidentifizierung
- Auslagerung auf anderen Rechtsträger
- Separierung von Betriebsvorrichtungen über ein Treuhandmodell
- Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums
- Notwendige Umstrukturierungsschritte
- Schlussbetrachtung
- Zusammenfassende Würdigung
- Kritische Betrachtung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Masterthesis befasst sich mit der erweiterten Kürzung der Gewerbesteuer nach § 9 Nr. 1 Satz 2 ff. GewStG und analysiert die Grenzen des Ausschließlichkeitsgebots im Kontext aktueller Rechtsänderungen durch das Fondsstandortgesetz.
- Anwendungsbereich und Regelungszweck der erweiterten Kürzung
- Das Ausschließlichkeitsgebot und seine Bedeutung für die Gewerbesteuerkürzung
- Die Entwicklungstendenzen der restriktiven Auslegung des Ausschließlichkeitsgebots
- Die Auswirkungen des Fondsstandortgesetzes auf die erweiterte Kürzung
- Strukturierungsmaßnahmen zur Vermeidung kürzungsschädlicher Tätigkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas vor und erläutert die Zielsetzung und die methodische Vorgehensweise der Arbeit.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel untersucht die Grundlagen der erweiterten Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 ff. GewStG, wobei der Fokus auf Anwendungsbereich, Regelungszweck und die relevanten Tatbestandsmerkmale gelegt wird.
- Kapitel 3: Die Analyse des Ausschließlichkeitsgebots im Kontext der erweiterten Kürzung steht im Mittelpunkt dieses Kapitels. Es werden die verschiedenen Aspekte des Gebots, wie die tätigkeitsbezogene, grundbesitzbezogene und zeitraumbezogene Ausschließlichkeit, beleuchtet.
- Kapitel 4: Die Entwicklungstendenzen der restriktiven Auslegung des Ausschließlichkeitsgebots werden in diesem Kapitel untersucht. Die jüngere Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs und die Auswirkungen des Fondsstandortgesetzes auf das Ausschließlichkeitsgebot werden analysiert.
- Kapitel 5: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit möglichen Strukturierungsmaßnahmen, die Unternehmen zur Vermeidung kürzungsschädlicher Tätigkeiten ergreifen können. Auslagerungsmodelle und die Separierung von Betriebsvorrichtungen werden im Detail betrachtet.
Schlüsselwörter
Erweiterte Kürzung, Gewerbesteuer, Ausschließlichkeitsgebot, Fondsstandortgesetz, Vermögensverwaltung, Grundbesitz, Nebentätigkeiten, Strukturierungsmaßnahmen, Rechtsprechung, Bundesfinanzhof.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die erweiterte Grundstückskürzung?
Es handelt sich um eine gewerbesteuerliche Begünstigung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG, die es Immobilienunternehmen ermöglicht, Erträge aus der Verwaltung eigenen Grundbesitzes von der Gewerbesteuer zu befreien.
Was besagt das Ausschließlichkeitsgebot?
Das Gebot verlangt, dass das Unternehmen ausschließlich eigenen Grundbesitz verwaltet. Jede darüber hinausgehende gewerbliche Tätigkeit kann die gesamte Kürzung gefährden.
Welche Änderungen brachte das Fondsstandortgesetz für Immobilieninvestoren?
Das Gesetz führte Unschädlichkeitsgrenzen ein, z.B. für Einnahmen aus der Lieferung von Strom (Photovoltaik) oder mieternahen Dienstleistungen, solange diese bestimmte Prozentsätze der Einnahmen nicht überschreiten.
Sind Betriebsvorrichtungen schädlich für die erweiterte Kürzung?
Ja, die Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen gilt grundsätzlich als kürzungsschädlich. Die Arbeit diskutiert hierzu Strukturierungsmaßnahmen wie Treuhandmodelle zur Risikominimierung.
Warum ist die Wahl der Rechtsform für die Kürzung relevant?
Die Kürzung ist besonders für Kapitalgesellschaften attraktiv, da sie die Steuerbelastung auf der Gesellschaftsebene von etwa 30 % auf circa 15 % senken kann, was die Solvenz und Finanzierungskraft stärkt.
Details
- Titel
- Die erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 ff. GewStG. Die Grenzen des Ausschließlichkeitsgebots mit Hinblick auf die aktuellen Rechtsänderungen durch das Fondsstandortgesetz
- Hochschule
- Hochschule Aalen
- Note
- 2,0
- Autor
- Carolin Strathmann (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2022
- Seiten
- 61
- Katalognummer
- V1318896
- ISBN (Buch)
- 9783346799111
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- kürzung satz gewstg grenzen ausschließlichkeitsgebots hinblick rechtsänderungen fondsstandortgesetz
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 31,99
- Preis (Book)
- US$ 45,99
- Arbeit zitieren
- Carolin Strathmann (Autor:in), 2022, Die erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 ff. GewStG. Die Grenzen des Ausschließlichkeitsgebots mit Hinblick auf die aktuellen Rechtsänderungen durch das Fondsstandortgesetz, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1318896
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-