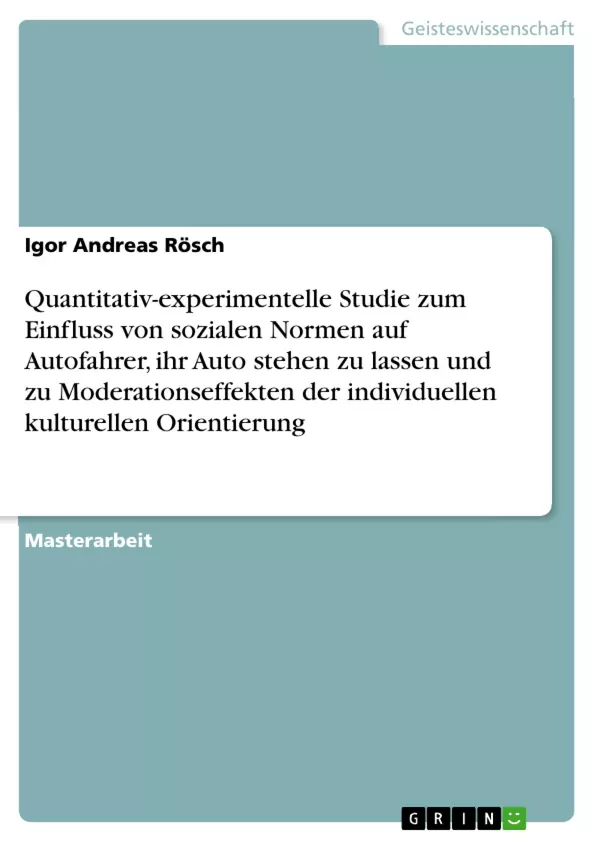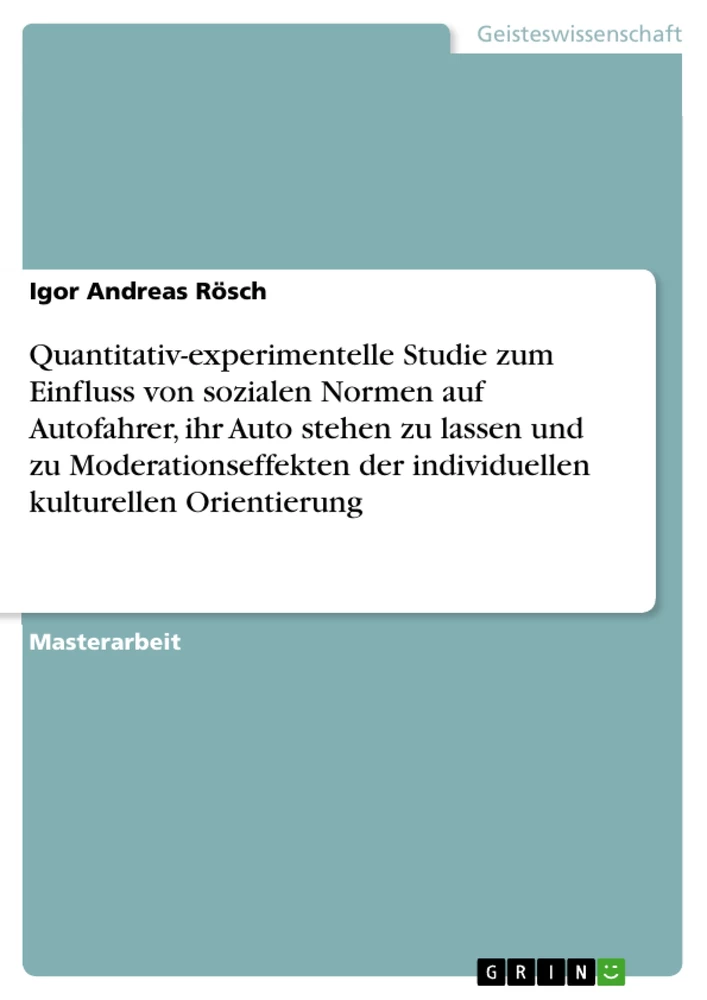
Quantitativ-experimentelle Studie zum Einfluss von sozialen Normen auf Autofahrer, ihr Auto stehen zu lassen und zu Moderationseffekten der individuellen kulturellen Orientierung
Masterarbeit, 2021
105 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Abstract¹
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht den Einfluss sozialer Normen auf die Absicht von Autofahrern, ihr Fahrzeug zugunsten umweltschonender Verkehrsmittel stehen zu lassen. Die Studie zielt darauf ab, die Vorhersagekraft und Varianzaufklärung von Modellen zur Erklärung verkehrsbezogener Verhaltensabsichten zu verbessern. Dabei werden injunktive und deskriptive soziale Normen im Sinne von Cialdini, Reno und Kallgren (1990) berücksichtigt, sowie individualpsychologische Determinanten aus der Theorie des geplanten Verhaltens von Ajzen (1991) und der Normaktivierungstheorie von Schwartz (1977). Zusätzlich wird der Einfluss der individuellen kulturellen Orientierung im Sinne der Individualismus-Kollektivismus-Dimension von Hofstede (1980) auf die Wirkung sozialer Normen untersucht.
- Einfluss sozialer Normen auf die Absicht zur Wahl umweltschonender Verkehrsmittel
- Integration individualpsychologischer Determinanten in das Normkonzept
- Moderationseffekte der individuellen kulturellen Orientierung
- Verbesserung der Vorhersagekraft und Varianzaufklärung von Modellen zur Erklärung verkehrsbezogener Verhaltensabsichten
- Relevanz für die Praxis: Entwicklung von wirksamen Kommunikationsmaßnahmen zur Förderung umweltfreundlicher Verkehrsmittel
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Dieses Kapitel stellt die Problemstellung der Studie dar und führt in das Thema der Verkehrswende ein. Es beleuchtet den steigenden Bedarf an umweltfreundlichen Verkehrsmitteln und die Bedeutung der Verhaltensänderung von Autofahrern. Außerdem werden die theoretischen Grundlagen der Studie, wie die Theorie des geplanten Verhaltens und die Normaktivierungstheorie, vorgestellt.
- Kapitel 2: Theoretische Grundlagen
Dieses Kapitel diskutiert die relevanten Theorien und Konzepte im Detail. Es werden die Theorie des geplanten Verhaltens von Ajzen (1991), die Normaktivierungstheorie von Schwartz (1977) und das Normkonzept von Cialdini et al. (1990) erläutert.
- Kapitel 3: Forschungsdesign und Methodik
Dieses Kapitel beschreibt das Forschungsdesign der Studie, die Datenerhebungsmethode und die verwendeten Messinstrumente. Es erklärt die Wahl der Stichprobe, das Experiment und die statistischen Analysen, die durchgeführt werden sollen.
- Kapitel 4: Ergebnisse
Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Studie und analysiert die Daten im Hinblick auf die Forschungsfragen. Es untersucht den Einfluss von injunktiven und deskriptiven sozialen Normen auf die Absicht zur Wahl umweltschonender Verkehrsmittel und betrachtet die Moderationseffekte der individuellen kulturellen Orientierung.
- Kapitel 5: Diskussion
Dieses Kapitel interpretiert die Ergebnisse der Studie im Lichte des theoretischen Rahmens und diskutiert die Implikationen für die Praxis. Es reflektiert die Stärken und Schwächen der Studie und gibt Empfehlungen für zukünftige Forschungsaktivitäten.
Schlüsselwörter
Soziale Normen, Theorie des geplanten Verhaltens, Normaktivierungstheorie, injunktive und deskriptive Normen, Absicht zur Wahl umweltschonender Verkehrsmittel, Individualismus-Kollektivismus-Dimension, Verkehrswende, Verhaltensänderung, Nachhaltigkeit.
Details
- Titel
- Quantitativ-experimentelle Studie zum Einfluss von sozialen Normen auf Autofahrer, ihr Auto stehen zu lassen und zu Moderationseffekten der individuellen kulturellen Orientierung
- Hochschule
- FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, München früher Fachhochschule (Hochschulzentrum München)
- Veranstaltung
- Studiengang Wirtschaftspsychologie
- Note
- 1,0
- Autor
- Igor Andreas Rösch (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2021
- Seiten
- 105
- Katalognummer
- V1318945
- ISBN (Buch)
- 9783346797865
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Die Arbeit wurde vom FOM Hochschulzentrum München für die Teilnahme am wissenschaftlichen Wettbewerb "Hochschulpreis des Referats für Arbeit und Wirtschaft 2022" der Stadt München ausgewählt, da im Rahmen der Untersuchung Einwohner*innen der Stadt München befragt wurden. Die Arbeit ist aber vor allem deshalb von Interesse für Städte und Gemeinden, da ein sozialpsychologischer Ansatz zur Förderung der Nutzung klimaschonender Verkehrsmittel aufgegriffen und mit etablierten entscheidungspsychologischen Konzepten verknüpft wird.
- Schlagworte
- Injunktive und deskriptive soziale Normen Theorie des geplanten Verhaltens Normaktiverungstheorie Absicht zur Wahl umweltschonender Verkehrsmittel Individualismus-Kollektivismus-Dimension
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 39,99
- Preis (Book)
- US$ 50,99
- Arbeit zitieren
- Igor Andreas Rösch (Autor:in), 2021, Quantitativ-experimentelle Studie zum Einfluss von sozialen Normen auf Autofahrer, ihr Auto stehen zu lassen und zu Moderationseffekten der individuellen kulturellen Orientierung, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1318945
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-