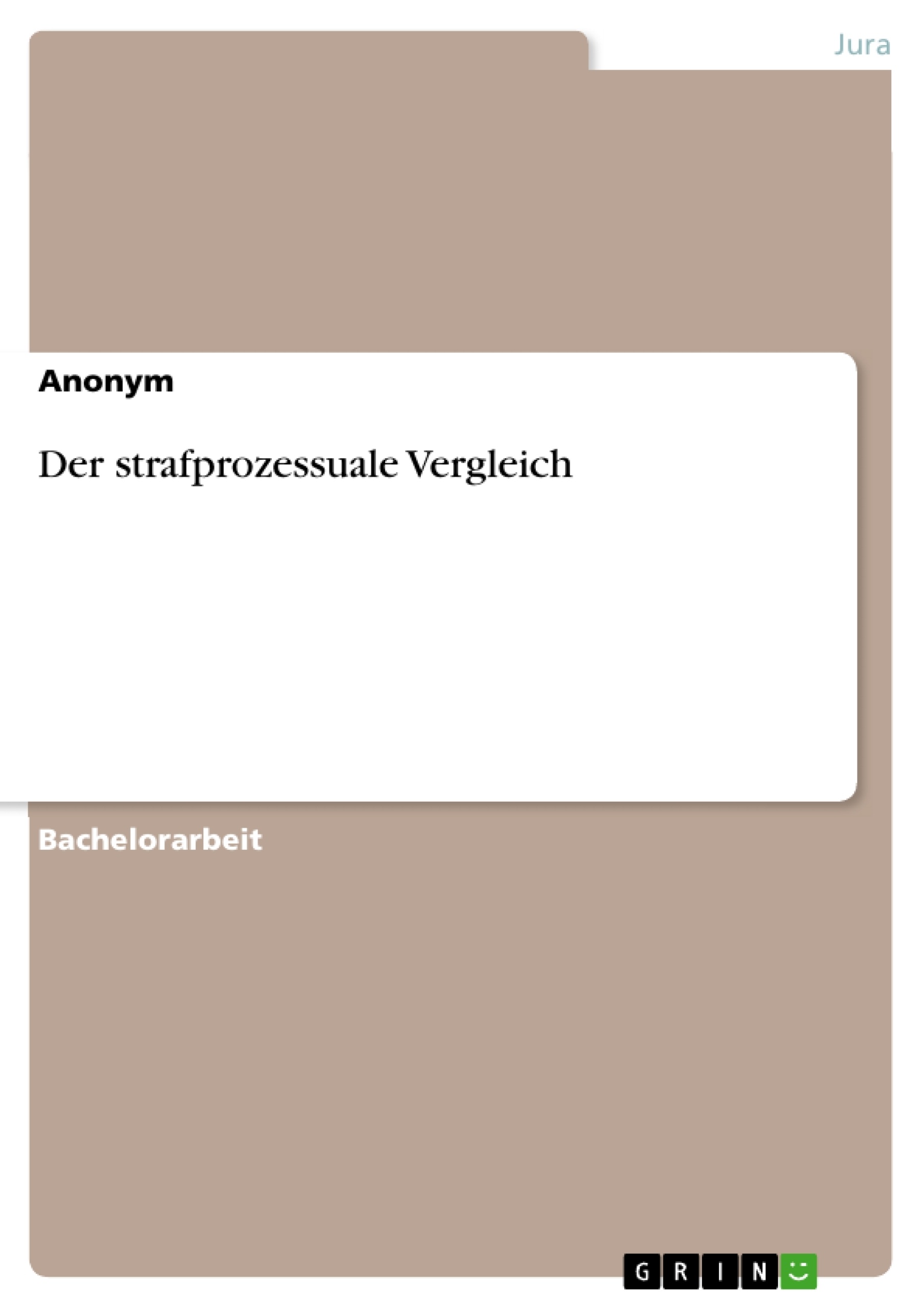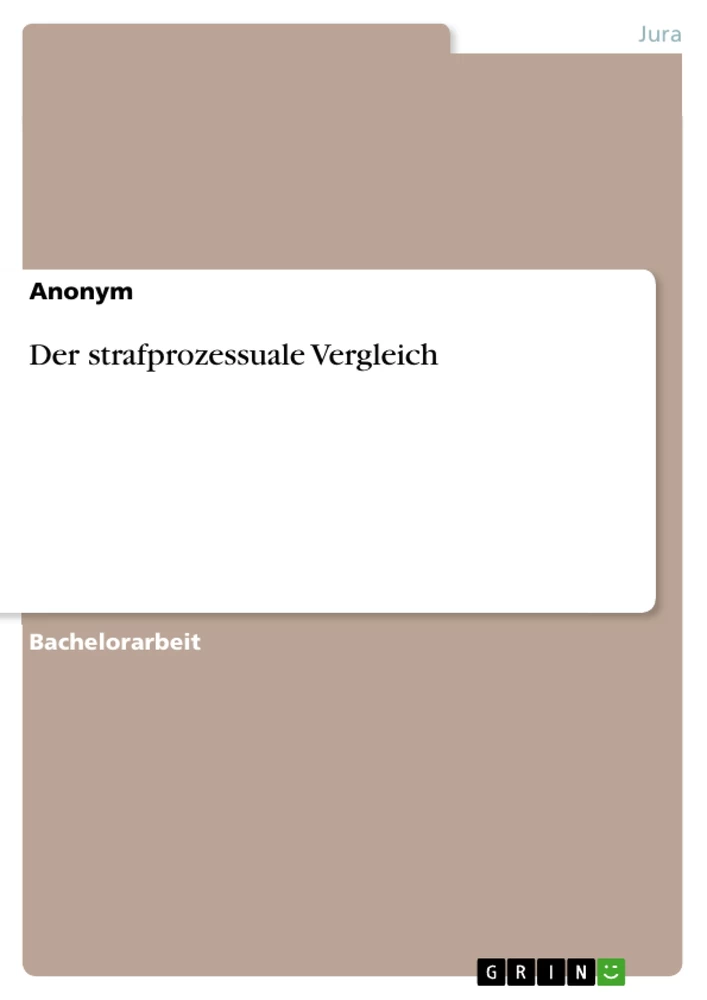
Der strafprozessuale Vergleich
Bachelorarbeit, 2019
59 Seiten, Note: 1,9
Leseprobe
A. Inhaltsverzeichnis
B. Bearbeitung der Themenstellung
I. Einleitung
II. Entstehung, Begriff und Mechanismus
1. Entstehung
2. Begriff und Mechanismus
III. Zweck und Systematik des § 257c StPO
IV. Prozessuale Bedeutung aus Sicht der Prozessbeteiligten und der Wissenschaft
1. Strafverfolgungsorgane
2. Verteidigung
3. Verletzter
4. Strafprozessrechtswissenschaft
V. Probleme der Verständigung
1. Verfassungsrechtliche Grundsätze des Strafverfahrens
2. Verfahrensgrundsätze der Strafprozessordnung
VI. Reaktion und Entwicklung der höchstrichterlichen Rechtsprechung
1. Anfänge
a) Detlef Deal aus Mauschelhausen
b) BGH - Entscheidung v. 28. August 1997
c) Entscheidung des Großen Senats für Strafsachen v. 03.März 2005
2. Das Verständigungsgesetz v. 29. Juli 2009
3. Das Grundsatzurteil des BVerfG v. 19.März 2013 zum VerstG
VII. Voraussetzungen und Zustandekommen einer zulässigen Verständigung
1. Beteiligte
2. Gegenstand der Verständigung
a) Zulässiger Gegenstand
aa) Rechtsfolgen
bb) Prozessverhalten der Beteiligten
cc) Sonstige verfahrensbezogene Maßnahmen
b) Grenzen der Zulässigkeit
aa) Geeignetheit des Falles S. 32 bb) Schuldspruch sowie Maßregeln der Besserung und Sicherung
cc) Rechtsmittelverzicht
3. Geständnis als Teil der Verständigung
4. Gang des Verständigungsverfahrens
5. Belehrungspflicht
6. Bindungswirkung der Verständigung
VIII. Urteilsabfassung
IX. Rechtsmittelbefugnis
X. Fehlerfolgen gescheiterter oder missbräuchlicher Absprachen
1. Beweisverwertungsverbot
2. Strafmildernde Berücksichtigung des Geständnisses
3. Ausübung unzulässigen Drucks
4. Informelle Absprachen
XI. Strafbarkeitsrisiken für die Verfahrensbeteiligten
XII. Schlussbetrachtung
C. Literaturverzeichnis
Details
- Titel
- Der strafprozessuale Vergleich
- Hochschule
- FernUniversität Hagen
- Veranstaltung
- Strafrecht
- Note
- 1,9
- Autor
- Anonym (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2019
- Seiten
- 59
- Katalognummer
- V1319574
- ISBN (Buch)
- 9783346799708
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Urteilsabsprache Deal prozessualer Vergleich Verständigung im Strafverfahren
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 30,99
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2019, Der strafprozessuale Vergleich, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1319574
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-