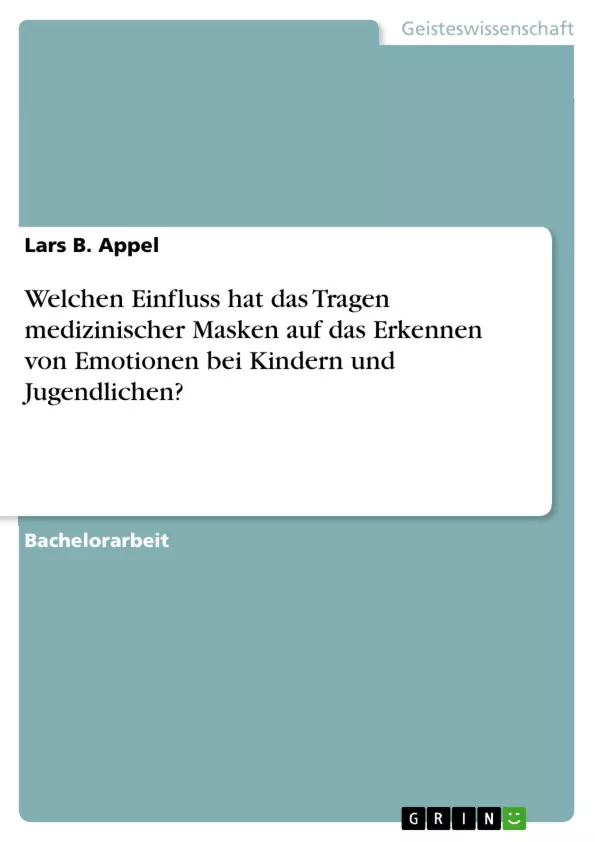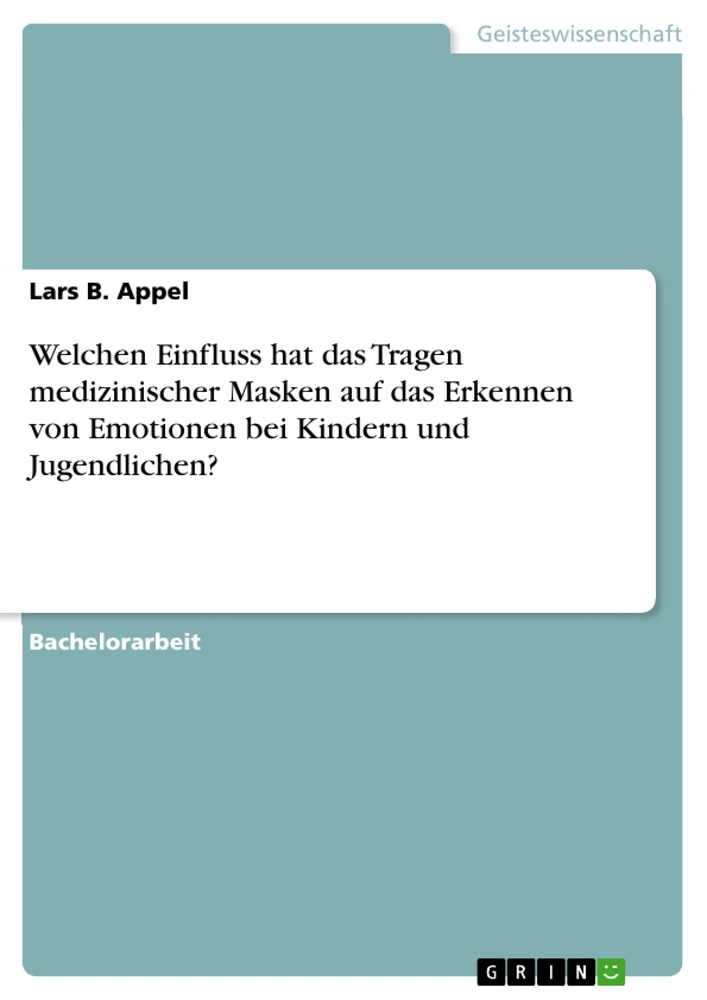
Welchen Einfluss hat das Tragen medizinischer Masken auf das Erkennen von Emotionen bei Kindern und Jugendlichen?
Bachelorarbeit, 2022
50 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Hintergrund
- Erkennen von Emotionen
- Basisemotionen nach Ekman
- Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie
- Aktueller Forschungsstand
- Methode
- Ergebnisse
- Stichprobe
- Allgemeine Angaben zu den Bildern
- Vergleich Bilder mit versus Bilder ohne Maske
- Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit dem Einfluss von medizinischen Masken auf die Emotionserkennung bei Kindern und Jugendlichen. Sie untersucht, ob und inwiefern das Tragen von Masken die Fähigkeit, Emotionen in Gesichtern zu erkennen, beeinträchtigt. Darüber hinaus werden mögliche Auswirkungen auf die kindliche und psychische Entwicklung, wie z. B. die Empathieentwicklung oder soziale Kompetenzen, erörtert.
- Emotionserkennung und ihre Bedeutung in der Entwicklung
- Die Auswirkungen von Masken auf die nonverbale Kommunikation
- Die Erforschung der Emotionserkennung bei Kindern und Jugendlichen im Kontext der Corona-Pandemie
- Mögliche Auswirkungen von Beeinträchtigungen in der Emotionserkennung auf die soziale Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und das Ziel der Bachelorarbeit vor. Es wird der aktuelle Forschungsstand zur Emotionserkennung im Kontext der Corona-Pandemie beleuchtet und die Relevanz des Themas hervorgehoben.
- Kapitel 2: Der theoretische Hintergrund beleuchtet die Erkennung von Emotionen und die Basisemotionen nach Ekman. Die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie und der aktuelle Forschungsstand zur Emotionserkennung im Zusammenhang mit dem Tragen von Masken werden ebenfalls behandelt.
- Kapitel 3: Die Methode beschreibt das Untersuchungsdesign und den methodischen Zugang der Bachelorarbeit. Der Prozess der Erstellung des Fragebogens und die angewandte Methodik werden erläutert.
- Kapitel 4: Die Ergebnisse der Studie werden vorgestellt und analysiert. Es werden die Stichprobe, allgemeine Angaben zu den Bildern sowie der Vergleich von Bildern mit und ohne Maske dargestellt.
Schlüsselwörter
Emotionserkennung, Masken, Kinder, Jugendliche, Corona-Pandemie, Nonverbale Kommunikation, Empathie, Soziale Entwicklung, Psychologie, Empirische Forschung
Häufig gestellte Fragen
Beeinträchtigen Masken die Emotionserkennung bei Kindern?
Die Bachelorthesis untersucht mittels eines Fragebogens, ob Kinder und Jugendliche Emotionen schlechter erkennen, wenn das Gesicht durch eine medizinische Maske verdeckt ist.
Welche psychologischen Folgen kann eine erschwerte Emotionserkennung haben?
Es werden Auswirkungen auf die Empathieentwicklung und soziale Kompetenzen sowie potenzielle Folgen für die allgemeine psychische Entwicklung diskutiert.
Was sind die Basisemotionen nach Ekman?
Die Arbeit definiert grundlegende Emotionen, die kulturübergreifend an spezifischen visuellen Merkmalen im Gesicht erkannt werden können.
Gibt es bereits viele Studien zu diesem Thema bei Kindern?
Zum Stand März 2022 gab es kaum Studien, die speziell Kinder und Jugendliche auf Beeinträchtigungen durch das Maskentragen hin untersuchten.
Welche Relevanz hat das Thema für die Soziale Arbeit?
Die Erkenntnisse liefern wichtige Implikationen für den Umgang mit Kindern in sozialen Einrichtungen während und nach der Pandemie.
Details
- Titel
- Welchen Einfluss hat das Tragen medizinischer Masken auf das Erkennen von Emotionen bei Kindern und Jugendlichen?
- Hochschule
- Hochschule Fresenius Frankfurt
- Note
- 1,0
- Autor
- Lars B. Appel (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2022
- Seiten
- 50
- Katalognummer
- V1321503
- ISBN (Buch)
- 9783346806857
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- medizinische Masken FFP2 Emotionen Einflüsse durch Masken Corona Folgen von Corona Folgen von Coronaverordnungen auf Kinder und Jugendliche Kinder und Jugendliche Soziale Arbeit Bachelorthesis Einschränkungen aufgrund der Corona Pandemie Studie zum Tragen von Masken Quantitative Sozialforschung COVID-19 Maskenpflicht Emotionserkennung Empathie Empathieentwicklung psychische Entwicklung kindliche Entwicklung soziale Kompetenzen Fragebogen Mimik Basisemotionen nach Ekman Wahrnehmung von Emotionen im Gesicht Beeinträchtigungen in der Emotionserkennung Was sind Emotionen Coronavirus-Schutzverordnungen Studien zur Emotionserkennung Pandemie soziales Urteilungsvermögen wahrgenommene Vertrauenswürdigkeit Sympathie verhaltensauffällige Kinder Gefühle empirische Forschung Neurologische Forschungen Bezugspersonen Lebensqualität Nervensystem Schutzfunktionen Gestik Gesichtsausdrücke soziale Verstärker zwischenmenschliche Interaktionen soziale Interaktionen Gespräche nonverbale Kommunikation Gesichtsforschung Paul Ekman Ekmans Theorie Kontaktbeschränkungen Homeschooling Lockdown Schulschließungen Kitaschließungen digitaler Unterricht Quarantäne aktueller Forschungsstand Verhaltensstörungen delinquentes Verhalten deviantes Verhalten Empathiebeeinträchtigung Emotionstraining Prävention kriminellen Verhaltens Heranwachsende SPSS deskriptive Statistiken Statistik Stichprobe Mittelwert Median Standartabweichung Histogramm somatische Reaktionen Kindeswohl psychisches Wohlbefinden Signifikanz Sozialarbeiter Sozialprofessionen vulnerable Kinder KDEF Psychologische Folgen durch das Tragen von Masken Entwicklungspsychologie Einfluss medizinischer Masken Studie Studie zu Folgen von Corona Studienarbeit zu Corona Emotionserkennung Kinder Forschung zu Corona Forschung zu Coronaverordnungen Forschung zum Tragen von Masken Forschung zur Emotionserkennung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Lars B. Appel (Autor:in), 2022, Welchen Einfluss hat das Tragen medizinischer Masken auf das Erkennen von Emotionen bei Kindern und Jugendlichen?, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1321503
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-