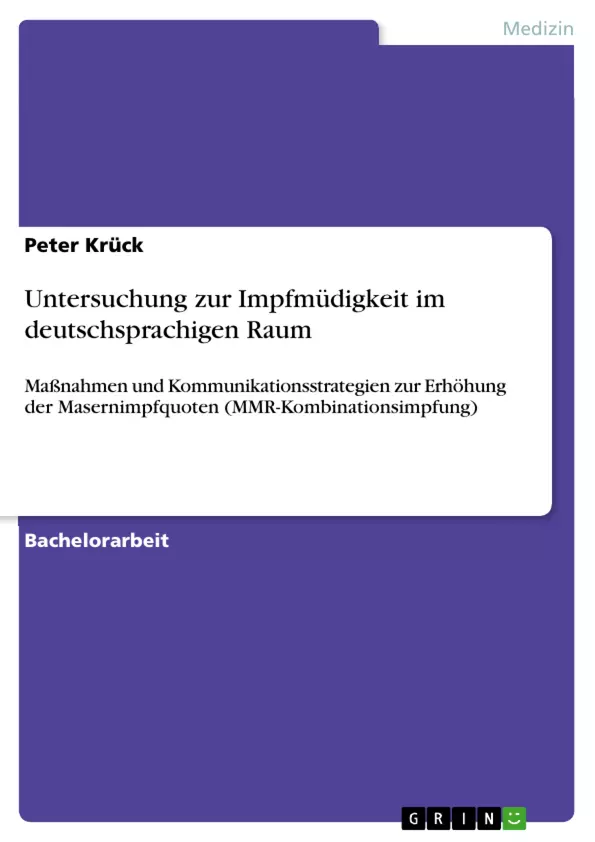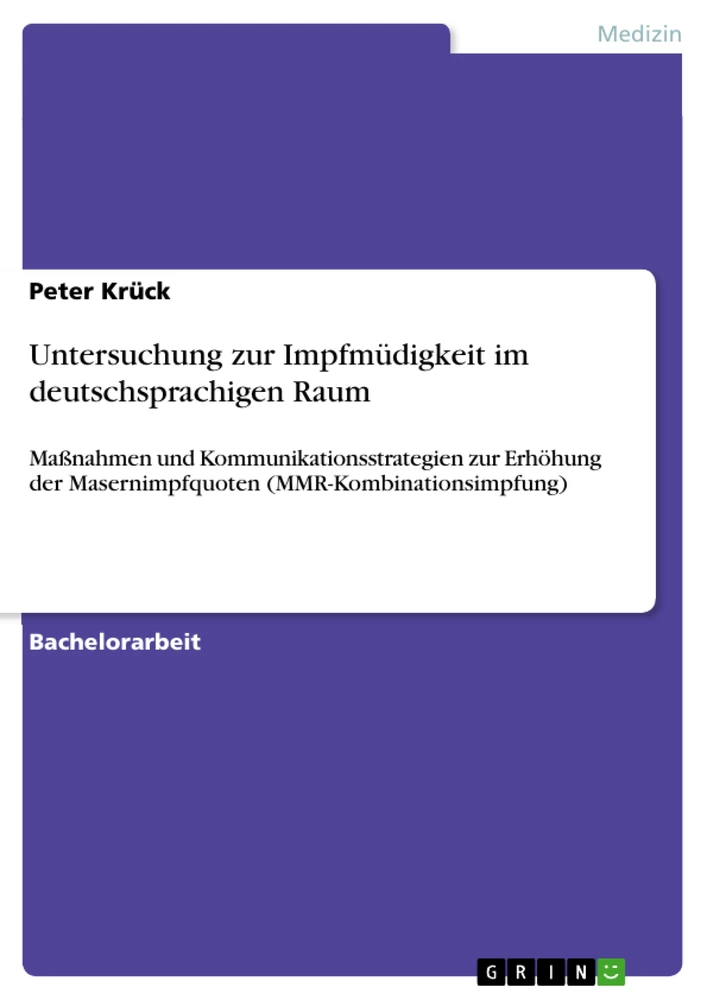
Untersuchung zur Impfmüdigkeit im deutschsprachigen Raum
Bachelorarbeit, 2015
40 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 2. Medienberichte...
- 3. Auswertung der Medienberichte....
- 3.1. Impfquoten in Deutschland und Österreich......
- 3.2. Akteure und Risiko-Gruppen....
- 3.2.1. Impfgegner und Impfskeptiker..\li>
- 3.2.2. Eltern....
- 3.2.3. Jugendliche und junge Erwachsene....
- 3.2.4. Migranten und Flüchtlinge.......
- 3.2.5. Gesundheitspersonal....
- 3.3. Gründe für die Impfmüdigkeit..\
- 3.3.1. Fehlinformationen im Internet………
- 3.3.2. Zweifel an der Wirksamkeit der Impfungen ......
- 3.3.3. Sicherheitsbedenken und Impfrisiko
- 3.3.4. Verharmlosung der Krankheit...\li>
- 3.3.5. Mangelndes Krankheitsbewusstsein...\li>
- 3.3.6. Zugangsbarrieren......
- 3.3.7. Sonstige.........
- 3.4. Durchgeführte Impfkampagnen und Maßnahmen zur Erhöhung der Impfraten......
- 3.4.1. Deutschlandweit.......
- 3.4.2. Österreichweit...\li>
- 3.4.3. Regional..........\li>
- 3.5. Diskutierte Ideen zur Erhöhung der Impfraten......
- 3.5.1. Impfpflicht.......
- 3.5.2. Kita-Aufnahme und Einschulung nur mit Impfschutz...\li>
- 3.5.3. Kostenlose Impfungen .......
- 3.5.4. Kopplung von Sozialleistungen an den Impfstatus….....
- 3.5.5. Sonstige...\li>
- 3.6. Fazit..\li>
- 4. Kommunikationsstrategien und Maßnahmen aus der Fachliteratur……….\li>
- 4.1. Strategien gerichtet an Patienten..\
- 4.1.1. Allgemeine Hinweise......
- 4.1.2. Routinekontrollen...\li>
- 4.1.3. Erinnerungs- und Rückrufsysteme...\li>
- 4.1.4. Social Media und Webseiten...\li>
- 4.1.5. Hausbesuche und Vertrauenspersonen....
- 4.1.6. Organisation und verbesserter Zugang...\li>
- 4.2. Strategien gerichtet an das Gesundheitspersonal....
- 4.2.1. Informationsmaterial und Aufklärung...\li>
- 4.2.2. Erinnerungen und technische Unterstützung...\li>
- 4.2.3. Feedback.\li>
- 4.3. Fazit..\li>
- 4.1. Strategien gerichtet an Patienten..\
- 5. Conclusio...\li>
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die aktuelle Situation der Impfmüdigkeit im deutschsprachigen Raum, insbesondere im Hinblick auf die MMR-Impfung (Masern, Mumps, Röteln). Sie analysiert die Ursachen für die Impfmüdigkeit und beleuchtet vergangene sowie aktuelle Maßnahmen zur Erhöhung der Impfraten. Die Arbeit identifiziert Kommunikationsstrategien und Maßnahmen aus der Fachliteratur, die dazu beitragen könnten, die Impfquoten für die MMR-Impfung zu verbessern.
- Analyse der Impfmüdigkeit im deutschsprachigen Raum
- Untersuchung der Ursachen für die Impfmüdigkeit
- Bewertung der Wirksamkeit von Maßnahmen zur Erhöhung der Impfraten
- Identifizierung von Kommunikationsstrategien und Maßnahmen zur Verbesserung der Impfkommunikation
- Entwicklung von Empfehlungen für die zukünftige Impfkommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung zum Thema und erläutert die Bedeutung der MMR-Impfung für die öffentliche Gesundheit. Das zweite Kapitel behandelt die Medienberichterstattung über Masern und die MMR-Impfung und analysiert die Darstellung von Impfquoten, Risikogruppen und den Ursachen der Impfmüdigkeit. Kapitel 3 beleuchtet die durchgeführten Impfkampagnen und Maßnahmen im deutschsprachigen Raum sowie diskutierte Ideen zur Erhöhung der Impfraten. Das vierte Kapitel präsentiert Kommunikationsstrategien und Maßnahmen aus der Fachliteratur, die sich an Patienten und das Gesundheitspersonal richten. Schließlich bietet das fünfte Kapitel eine Zusammenfassung der Ergebnisse und zeigt mögliche Handlungsempfehlungen auf.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Impfmüdigkeit, MMR-Impfung, Masern, Kommunikationsstrategien, Gesundheitskommunikation, Impfquoten und Medienanalyse im deutschsprachigen Raum.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptgründe für Impfmüdigkeit bei der MMR-Impfung?
Zu den identifizierten Gründen zählen Fehlinformationen im Internet, Zweifel an der Wirksamkeit, Sicherheitsbedenken (Impfrisiko), die Verharmlosung der Krankheit Masern sowie Zugangsbarrieren.
Welche Risikogruppen für mangelnden Impfschutz werden analysiert?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Gruppen wie Impfskeptiker, Eltern, Jugendliche, junge Erwachsene, Migranten, Flüchtlinge und sogar das Gesundheitspersonal.
Welche Maßnahmen zur Erhöhung der Impfraten werden diskutiert?
Diskutiert werden unter anderem die Einführung einer Impfpflicht, die Koppelung der Kita-Aufnahme an den Impfschutz, kostenlose Impfangebote sowie verbesserte Erinnerungs- und Rückrufsysteme.
Wie kann die Kommunikation für Impfungen verbessert werden?
Empfohlen werden Strategien wie die Nutzung von Social Media, Informationsmaterial für Gesundheitspersonal, Routinekontrollen beim Arzt und der Einsatz von Vertrauenspersonen.
Was ergab die Medienanalyse zu Masern?
Die Analyse deutschsprachiger Nachrichten zeigt, wie Masern kommuniziert werden und wie Medienberichte die öffentliche Wahrnehmung von Impfquoten und Risiken beeinflussen.
Details
- Titel
- Untersuchung zur Impfmüdigkeit im deutschsprachigen Raum
- Untertitel
- Maßnahmen und Kommunikationsstrategien zur Erhöhung der Masernimpfquoten (MMR-Kombinationsimpfung)
- Hochschule
- Wirtschaftsuniversität Wien
- Note
- 1,0
- Autor
- Peter Krück (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2015
- Seiten
- 40
- Katalognummer
- V1322543
- ISBN (Buch)
- 9783346804174
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Impfmüdigkeit Masern MMR Impfung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 18,99
- Arbeit zitieren
- Peter Krück (Autor:in), 2015, Untersuchung zur Impfmüdigkeit im deutschsprachigen Raum, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1322543
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-