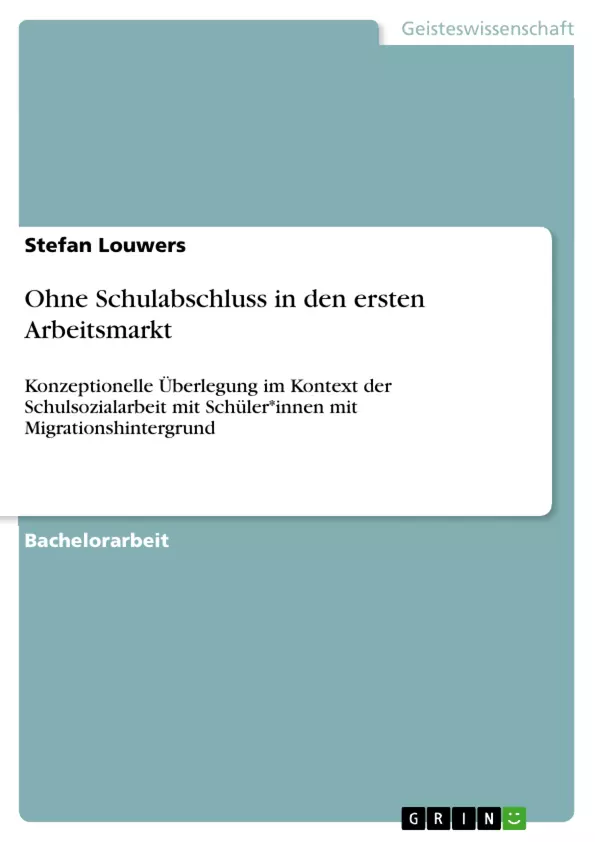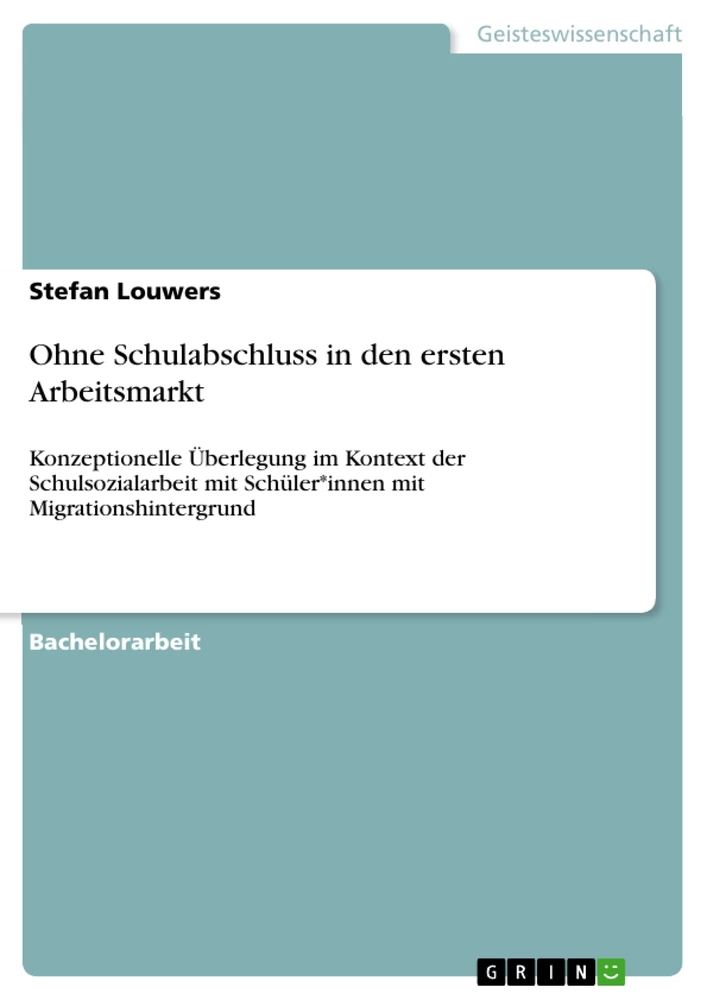
Ohne Schulabschluss in den ersten Arbeitsmarkt
Bachelorarbeit, 2022
80 Seiten, Note: 1
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Scheitern des Übergangs vom Bildungssystem in den ersten Arbeitsmarkt
- Statistischer Überblick über die gescheiterten Schulabschlüsse
- Einflussnehmende Faktoren
- Schulabsentismus
- Migrationshintergrund
- Geschlecht
- Unterschiede auf Grund des sozialen Status
- Stigmatisierung und die Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt
- Unterstützungsangebote in der BRD
- Institutionalisierte Maßnahmen auf Bundesebene
- Modellprojekte auf Landesebene
- Konzeptionelle Überlegungen
- Konzepte in der Sozialen Arbeit
- Aufgabe der Schulsozialarbeit im Kontext des Übergangs von der Schule in den ersten Arbeitsmarkt
- Überlegungen zur Gestaltung von Präventionsmaßnahmen
- Netzwerkarbeit
- Elternarbeit
- Praktika und Projektarbeit
- Übergang von der Schule in den Beruf
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text befasst sich mit dem Scheitern des Übergangs von der Schule in den ersten Arbeitsmarkt und analysiert die Ursachen für den Mangel an qualifizierten Schulabschlüssen, insbesondere bei Schüler*innen mit Migrationshintergrund. Der Fokus liegt auf der Identifizierung von Einflussfaktoren und der Erforschung von Unterstützungsmaßnahmen im Kontext der Schulsozialarbeit.
- Analyse der Gründe für gescheiterte Schulabschlüsse
- Bedeutung des Migrationshintergrunds für Bildungserfolg
- Herausforderungen der Integration von Schüler*innen mit Migrationshintergrund
- Bewertung von Unterstützungsangeboten in Deutschland
- Entwicklung von Präventionsmaßnahmen in der Schulsozialarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Relevanz eines qualifizierten Schulabschlusses für den Berufseinstieg und stellt die Problematik der Bildungsungleichheit im Zusammenhang mit dem Migrationshintergrund dar. Das zweite Kapitel geht auf die Ursachen für gescheiterte Schulabschlüsse ein und untersucht Einflussfaktoren wie Schulabsentismus, Migrationshintergrund, Geschlecht und den sozialen Status. Es analysiert die Chancen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund auf dem Arbeitsmarkt und diskutiert die Auswirkungen von Stigmatisierung. Im dritten Kapitel werden konzeptionelle Überlegungen für die Schulsozialarbeit im Kontext des Übergangs von der Schule in den ersten Arbeitsmarkt vorgestellt. Es werden verschiedene Konzepte der Sozialen Arbeit und Präventionsmaßnahmen wie Netzwerkarbeit, Elternarbeit, Praktika und Projektarbeit sowie die Gestaltung eines erfolgreichen Übergangs von der Schule in den Beruf diskutiert.
Schlüsselwörter
Der Text beschäftigt sich mit den zentralen Themen der Bildungsungleichheit, des Migrationshintergrunds, des Schulabschlusses, der Schulsozialarbeit und der Integration in den Arbeitsmarkt. Wichtige Aspekte sind die Analyse von Einflussfaktoren auf den Bildungserfolg, die Entwicklung von Präventionsmaßnahmen und die Optimierung von Unterstützungsangeboten für Schüler*innen mit Migrationshintergrund.
Häufig gestellte Fragen
Welche Folgen hat ein fehlender Schulabschluss auf dem Arbeitsmarkt?
Ohne qualifizierten Abschluss ist es fast unmöglich, sich auf dem ersten Arbeitsmarkt zu etablieren, da selbst einfache Ausbildungsberufe meist mindestens einen Hauptschulabschluss voraussetzen.
Welche Faktoren beeinflussen den Schulerfolg am stärksten?
Wesentliche Faktoren sind der soziale Status, die ethnische Herkunft (Migrationshintergrund), das Geschlecht sowie Probleme wie Schulabsentismus.
Warum scheitern Jugendliche mit Migrationshintergrund häufiger an Schulabschlüssen?
Die Arbeit analysiert Hinderungsgründe wie mangelnde Chancengleichheit, Stigmatisierung und sprachliche oder soziale Barrieren im Bildungssystem.
Welche Rolle spielt die Schulsozialarbeit beim Übergang in den Beruf?
Schulsozialarbeit leistet wichtige Präventionsarbeit durch Netzwerkarbeit, Elternarbeit und die Unterstützung bei Praktika, um den Übergang in den Arbeitsmarkt zu sichern.
Welche Unterstützungsangebote gibt es in Deutschland?
Es existieren institutionalisierte Maßnahmen auf Bundesebene sowie verschiedene Modellprojekte der Länder, die gezielt benachteiligte Jugendliche fördern.
Wie kann Prävention gegen Schulabbruch gestaltet werden?
Durch eine enge Verzahnung von Schule, Elternhaus und Betrieben sowie durch praxisorientierte Projektarbeit, die den Wert von Bildung verdeutlicht.
Details
- Titel
- Ohne Schulabschluss in den ersten Arbeitsmarkt
- Untertitel
- Konzeptionelle Überlegung im Kontext der Schulsozialarbeit mit Schüler*innen mit Migrationshintergrund
- Hochschule
- Hochschule Emden/Leer
- Note
- 1
- Autor
- Stefan Louwers (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2022
- Seiten
- 80
- Katalognummer
- V1322686
- ISBN (Buch)
- 9783346806147
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Schulsystem Bildung Migration Soziale Arbeit Schule Jugendliche Schulabschluss Beruf Ausbildung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 31,99
- Preis (Book)
- US$ 45,99
- Arbeit zitieren
- Stefan Louwers (Autor:in), 2022, Ohne Schulabschluss in den ersten Arbeitsmarkt, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1322686
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-