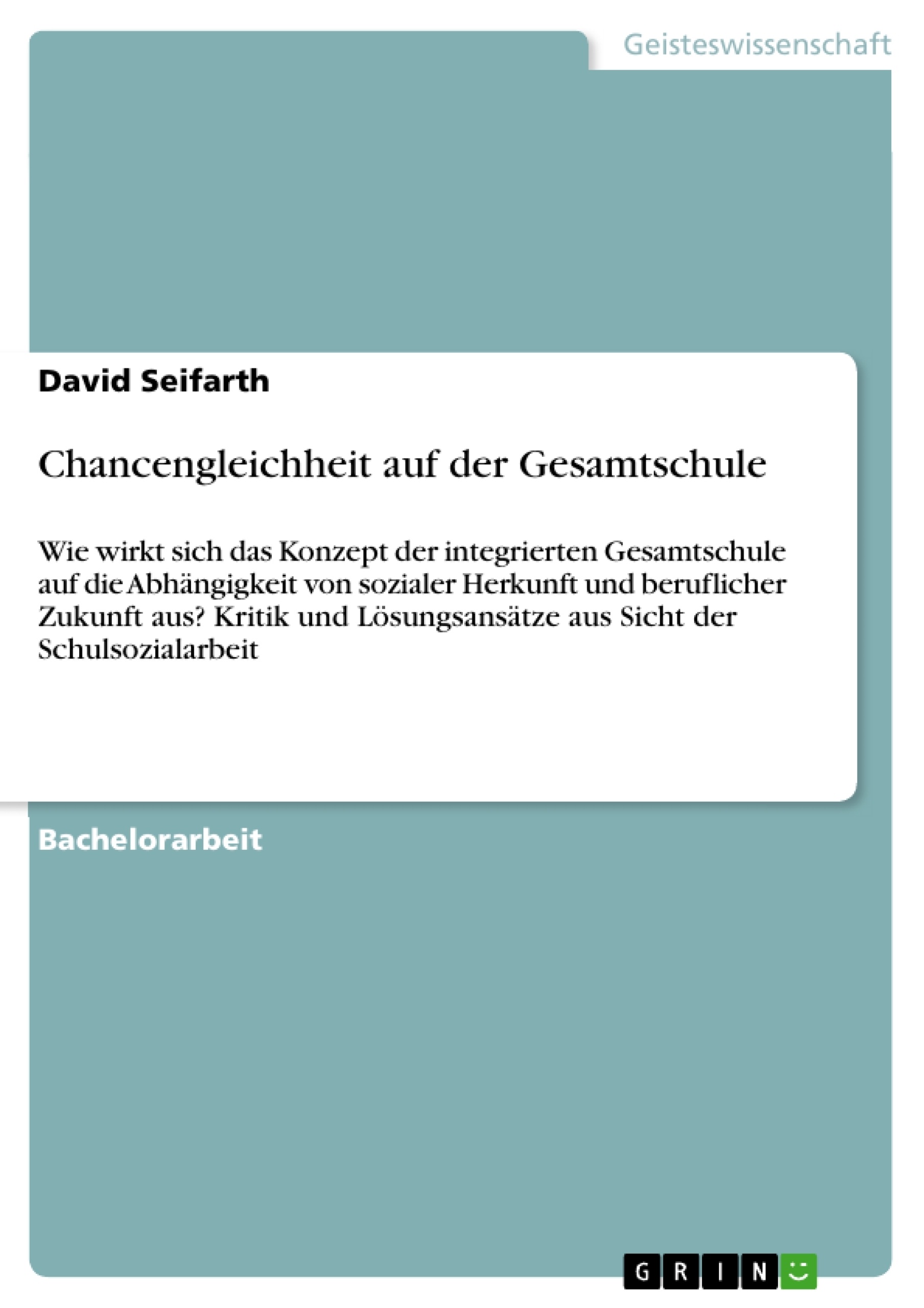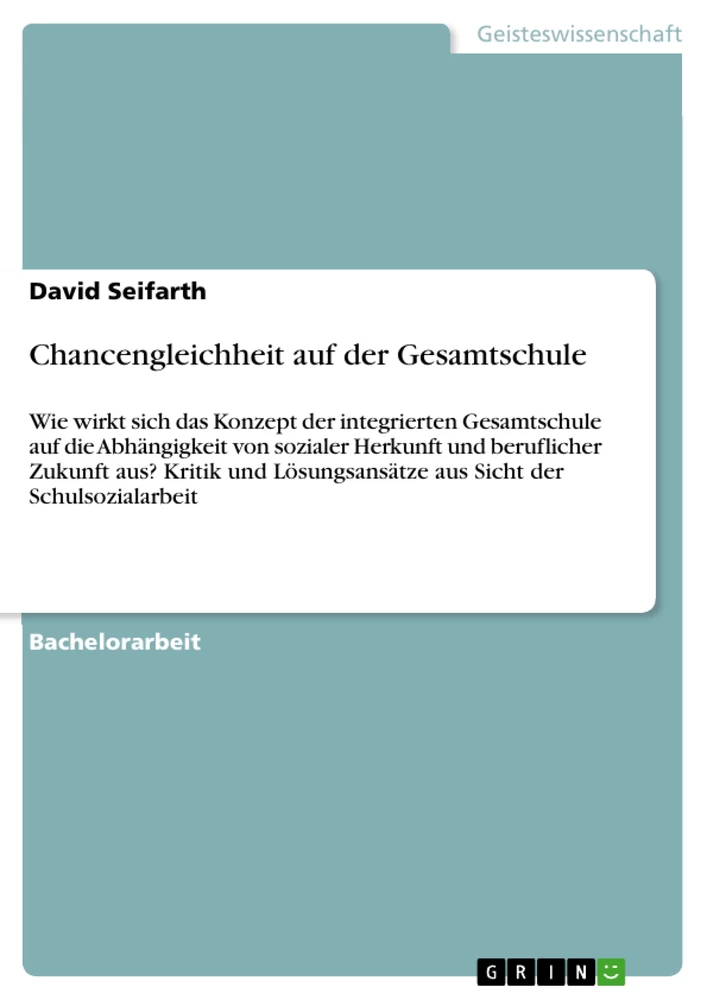
Chancengleichheit auf der Gesamtschule
Bachelorarbeit, 2022
58 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Definitionen
- 2.1.1 Chancengleichheit
- 2.1.2 Soziale Ungleichheit in der Schule
- 2.1.3 Bildungssystem
- 2.2 Habitus und Kapitaltheorie von Pierre Bourdieu
- 2.2.1 Habitus und Kapital
- 2.2.2 Abhängigkeit von Habitus und beruflicher Zukunft
- 2.2.3 Berufsvererbung als Einflussfaktor auf die Berufswahl
- 3. Integrierte Gesamtschule als Lösung?
- 3.1 Konzept der Integrierten Gesamtschule
- 3.1.1 Entwicklung der integrierten Gesamtschulen
- 3.1.2 Motive und Philosophie der Gesamtschulen
- 3.2 Vorteile der Gesamtschule
- 3.3 Kritik am Konzept der Gesamtschule
- 4. Lösungsansätze der Schulsozialarbeit
- 4.1 Begriff der Schulsozialarbeit
- 4.2 Rechtliche Bestimmungen der Schulsozialarbeit/Jugendhilfe
- 4.3 Leitbild der Schulsozialarbeit
- 5. Lösungsansätze der Schulsozialarbeit
- 5.1 Einzelberatung
- 5.1.1 Folgen von Kapitalmangel durch Einzelberatungen entgegenwirken
- 5.2 Angebote für Schulverweigerer
- 5.2.1 Definition Schuldistanzierung
- 5.2.2 Kapitals-Steigerung durch Angebote für schuldistanzierte Kinder und Jugendliche
- 5.3 Ganztagsangebote in Gesamtschulen
- 5.3.1 Definition und Ziele der Ganztagsschulen
- 5.3.2 Kapitals-Steigerung, von Schulsozialarbeiter*innen durch Angebote der Ganztagsschulen
- 5.4 Steigerung der beruflichen Perspektiven durch Kooperationen mit Bildungspartnern
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Auswirkungen des Konzepts der integrierten Gesamtschule auf die Abhängigkeit von sozialer Herkunft und beruflicher Zukunft. Sie analysiert die Herausforderungen der Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem und stellt die Rolle der Schulsozialarbeit in der Bewältigung dieser Herausforderungen dar.
- Soziale Ungleichheit im Bildungssystem
- Das Konzept der integrierten Gesamtschule
- Chancengleichheit und die Rolle der Schulsozialarbeit
- Kapitaltheorie und Habitus-Theorie von Pierre Bourdieu
- Lösungsansätze der Schulsozialarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema der Chancengleichheit und der sozialen Ungleichheit im deutschen Bildungssystem. Sie beleuchtet die Bedeutung der sozialen Herkunft und der beruflichen Zukunft im Zusammenhang mit Bildungserfolg. Im Anschluss werden die theoretischen Grundlagen der Chancengleichheit, der sozialen Ungleichheit und der Kapitaltheorie von Pierre Bourdieu erörtert. Das Konzept der integrierten Gesamtschule als möglicher Lösungsansatz zur Reduzierung von Bildungsungleichheiten wird vorgestellt und kritisch beleuchtet. Die Arbeit analysiert die Rolle der Schulsozialarbeit und ihre Interventionsmöglichkeiten zur Bewältigung von Ungleichheiten. Es werden verschiedene Lösungsansätze vorgestellt, darunter Einzelberatung, Angebote für Schulverweigerer, Ganztagsangebote und Kooperationen mit Bildungspartnern.
Schlüsselwörter
Chancengleichheit, soziale Ungleichheit, Bildungssystem, Gesamtschule, Schulsozialarbeit, Kapitaltheorie, Habitus, Pierre Bourdieu, Lösungsansätze, Einzelberatung, Schulverweigerung, Ganztagsschule, Kooperationen mit Bildungspartnern.
Häufig gestellte Fragen
Fördert die Gesamtschule tatsächlich die Chancengleichheit?
Die Arbeit untersucht kritisch, inwiefern das Konzept der integrierten Gesamtschule die Abhängigkeit des Bildungserfolgs von der sozialen Herkunft verringert.
Was besagt Bourdieus Theorie der "Berufsvererbung"?
Sie beschreibt den Prozess, bei dem Kinder oft denselben sozialen Status und ähnliche Berufe wie ihre Eltern erreichen, bedingt durch den familiären Habitus.
Welche Rolle spielt die Schulsozialarbeit bei der Chancengleichheit?
Schulsozialarbeit bietet Interventionen wie Einzelberatung und Ganztagsangebote, um Bildungsbenachteiligungen aktiv entgegenzuwirken.
Was versteht man unter "Schuldistanzierung"?
Es bezeichnet das Phänomen, wenn Schüler sich innerlich oder physisch von der Schule zurückziehen, oft aufgrund mangelnden Kapitals oder fehlender Perspektiven.
Wie können Kooperationen mit Bildungspartnern helfen?
Durch die Zusammenarbeit mit externen Partnern können berufliche Perspektiven gestärkt und der Übergang in die Arbeitswelt erleichtert werden.
Details
- Titel
- Chancengleichheit auf der Gesamtschule
- Untertitel
- Wie wirkt sich das Konzept der integrierten Gesamtschule auf die Abhängigkeit von sozialer Herkunft und beruflicher Zukunft aus? Kritik und Lösungsansätze aus Sicht der Schulsozialarbeit
- Hochschule
- Katholische Fachhochschule Mainz
- Note
- 1,0
- Autor
- David Seifarth (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2022
- Seiten
- 58
- Katalognummer
- V1324138
- ISBN (Buch)
- 9783346808370
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Chancengleichheit integrierte Gesamtschule soziale Herkunft beruflische Zukunft Lösungsansätze Schulsozialarbeit
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- David Seifarth (Autor:in), 2022, Chancengleichheit auf der Gesamtschule, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1324138
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-