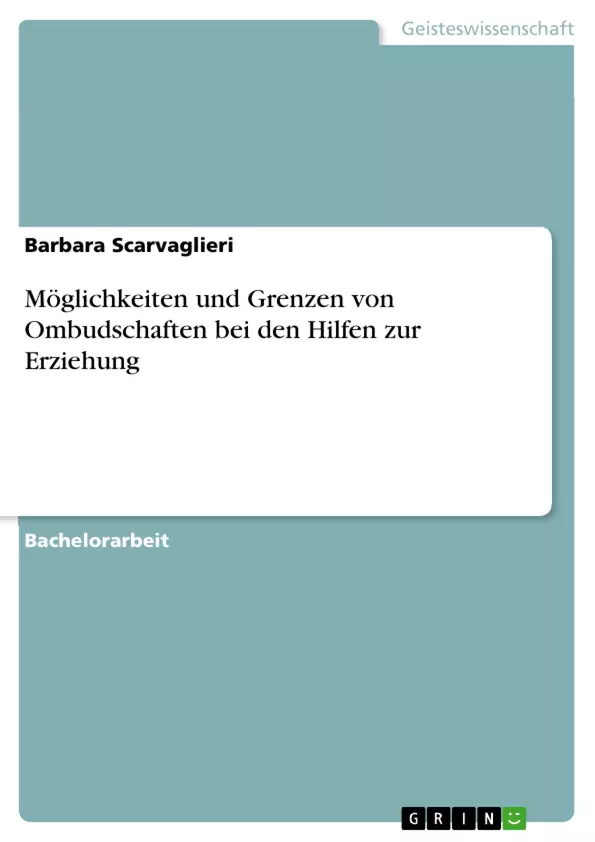Möglichkeiten und Grenzen von Ombudschaften bei den Hilfen zur Erziehung
Bachelorarbeit, 2021
71 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hilfen zur Erziehung
- 2.1. Vom RJWG zum SGB VIII – der Paradigmenwechsel
- 2.2. Definition und Voraussetzungen der Hilfearten nach § 27 SGB VIII
- 2.3. Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII, Nachbetreuung nach § 41a SGB VIII
- 2.4. Kosten vs. Fachlichkeit
- 2.5. Lebenslagen der Adressaten
- 2.6. Geschlossene Unterbringung
- 3. Kontrollmechanismen
- 3.1. Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte im SGB VIII
- 3.1.1. Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe nach § 1 SGB VIII
- 3.1.2. Selbstorganisierte Zusammenschlüsse zur Selbstvertretung nach § 4 a SGB VIII
- 3.1.3. Wunsch und Wahlrecht nach § 5 SGB VIII
- 3.1.4. Beteiligung von Kindern und Jugendlichen nach § 8 SGB VIII und § 8b Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII
- 3.1.5. Beratung nach § 10a SGB VIII
- 3.1.6. Mitwirkung, Hilfeplan nach § 36 SGB VIII
- 3.1.7. Partizipation und Beschwerde im Rahmen der Betriebserlaubnis/Heimaufsicht nach §§ 45- 48 a SGB VIII
- 3.1.8. Jugendhilfeausschuss nach § 71 SGB VIII
- 3.2. Verwaltungskontrolle und Rechtsschutz
- 3.2.1. Verwaltungskontrolle
- 3.2.2. Rechtsschutz
- 3.1. Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte im SGB VIII
- 4. Ombudschaften
- 4.1. Entstehung und Entwicklung der Ombudschaften
- 4.2. Selbstverständnis und Arbeitsweise
- 4.2.1. Definition und Legitimation ombudschaftlichen Handelns
- 4.2.2. Tätigkeitsfelder, Beratung und Haltung
- 4.2.3. Unabhängigkeit und Einbindung ehrenamtlicher Mitarbeiter
- 4.2.4. Evaluation und fachpolitische Öffentlichkeitsarbeit
- 4.3. Möglichkeiten von Ombudschaften
- 4.3.1. Ausgleich der Machtasymmetrie
- 4.3.2. Partizipation, Selbstwirksamkeit und Nachhaltigkeit
- 4.3.3. Unabhängige Beschwerdeinstanzen als Unterstützung und Kontrolle
- 4.3.4. Fachdiskurs, Öffentlichkeitsarbeit und Lobbyarbeit
- 4.4. Grenzen von Ombudschaften
- 4.4.1. Fachkräfte -,,Woher nehmen, wenn nicht stehlen?"
- 4.4.2. Herausforderungen im realen Umfeld
- 4.4.3. Der Sozialstaat in der Pflicht – Ressourcenmangel als externe Limitierung
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Rolle von Ombudschaften im Kontext der Hilfen zur Erziehung. Sie untersucht die Möglichkeiten und Grenzen dieser Instanzen bei der Unterstützung und Kontrolle von Hilfen zur Erziehung, insbesondere hinsichtlich der Einhaltung von Rechten und der Stärkung von Partizipation und Selbstwirksamkeit der betroffenen jungen Menschen.
- Entwicklung und Legitimation von Ombudschaften in der Jugendhilfe
- Aufgaben und Arbeitsweise von Ombudschaften
- Potenziale von Ombudschaften zur Stärkung von Rechten und Selbstbestimmung
- Herausforderungen und Grenzen des ombudschaftlichen Handelns
- Der Beitrag von Ombudschaften zur Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein, indem sie die Relevanz des Themas Ombudschaften in der Jugendhilfe darlegt. Sie beleuchtet die aktuelle Situation der Hilfen zur Erziehung, die Herausforderungen in Bezug auf die Sicherstellung der Rechte und die Förderung der Partizipation der betroffenen Jugendlichen.
- Kapitel 2: Hilfen zur Erziehung
Dieses Kapitel bietet einen Überblick über das deutsche System der Hilfen zur Erziehung. Es beschreibt die historischen Entwicklungen, die rechtlichen Grundlagen und die verschiedenen Formen der Hilfen. Weiterhin werden die Lebenslagen der Adressaten sowie die Problematik der geschlossenen Unterbringung beleuchtet.
- Kapitel 3: Kontrollmechanismen
Kapitel 3 analysiert die im SGB VIII verankerten Kontrollmechanismen und Mitwirkungsrechte. Es werden verschiedene Instrumente, wie z. B. die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, die Beratungsmöglichkeiten und die Rolle des Jugendhilfeausschusses, vorgestellt und kritisch betrachtet.
- Kapitel 4: Ombudschaften
Dieses zentrale Kapitel befasst sich mit den Ombudschaften. Es beschreibt die Entstehung und Entwicklung dieser Instanzen, ihre Aufgaben, Arbeitsweise und ihr Selbstverständnis. Zudem werden die Möglichkeiten und Grenzen von Ombudschaften in Bezug auf die Unterstützung und Kontrolle der Hilfen zur Erziehung beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Begriffen der Hilfen zur Erziehung, der Partizipation und Selbstbestimmung, der Kontrolle und Qualitätssicherung, sowie den Möglichkeiten und Grenzen von Ombudschaften in der Jugendhilfe. Weitere wichtige Themen sind die Rechte von Kindern und Jugendlichen, die Machtasymmetrie im System der Hilfen zur Erziehung, die Bedeutung der Fachlichkeit und Ressourcenmangel.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die gesetzliche Grundlage für Ombudsstellen in der Jugendhilfe?
Die gesetzliche Grundlage ist der neu eingefügte § 9a im SGB VIII durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz.
Welche Aufgabe haben Ombudschaften bei den Hilfen zur Erziehung?
Sie fungieren als externe, unabhängige Anlaufstellen, die Kinder, Jugendliche und Familien bei Konflikten mit dem Jugendamt beraten und unterstützen.
Was sind die Möglichkeiten von Ombudschaften?
Sie helfen, Machtasymmetrien auszugleichen, stärken die Partizipation der Betroffenen und fördern die Einzelfallgerechtigkeit sowie die Rechtsstaatlichkeit.
Wo liegen die Grenzen ombudschaftlichen Handelns?
Grenzen ergeben sich oft durch Fachkräftemangel, fehlende finanzielle Ressourcen und Herausforderungen im realen administrativen Umfeld.
Was versteht man unter dem "Wunsch- und Wahlrecht" (§ 5 SGB VIII)?
Es ist das Recht der Leistungsberechtigten, zwischen verschiedenen Einrichtungen und Diensten zu wählen und Wünsche zur Gestaltung der Hilfe zu äußern.
Details
- Titel
- Möglichkeiten und Grenzen von Ombudschaften bei den Hilfen zur Erziehung
- Hochschule
- Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten
- Note
- 1,0
- Autor
- Barbara Scarvaglieri (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2021
- Seiten
- 71
- Katalognummer
- V1326134
- ISBN (Buch)
- 9783346812933
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- möglichkeiten grenzen ombudschaften hilfen erziehung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 31,99
- Preis (Book)
- US$ 45,99
- Arbeit zitieren
- Barbara Scarvaglieri (Autor:in), 2021, Möglichkeiten und Grenzen von Ombudschaften bei den Hilfen zur Erziehung, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1326134
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-